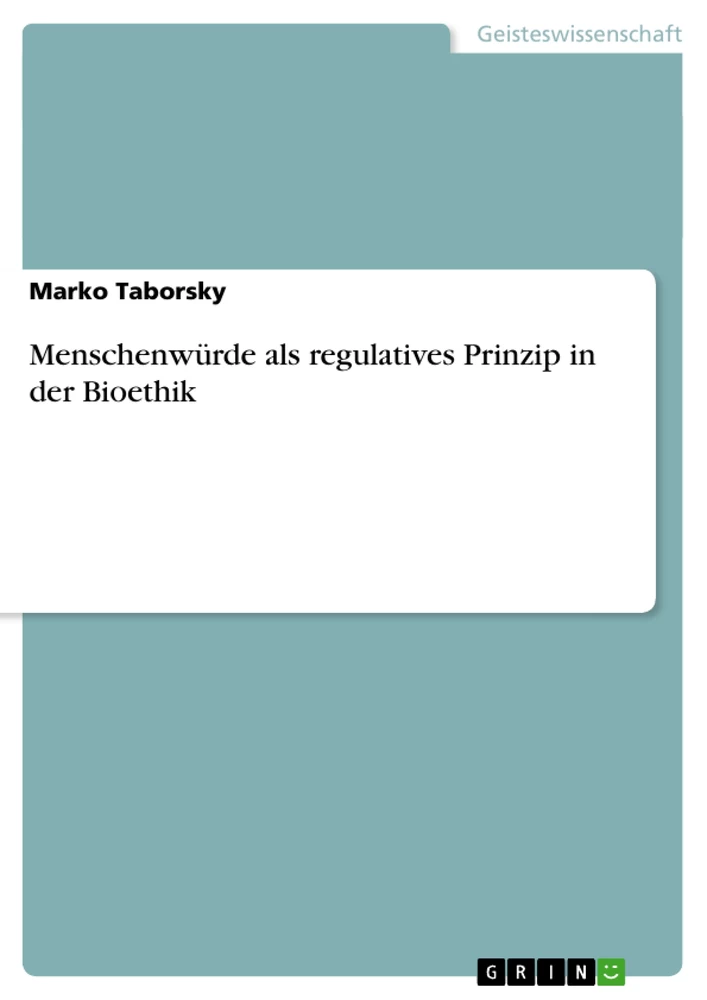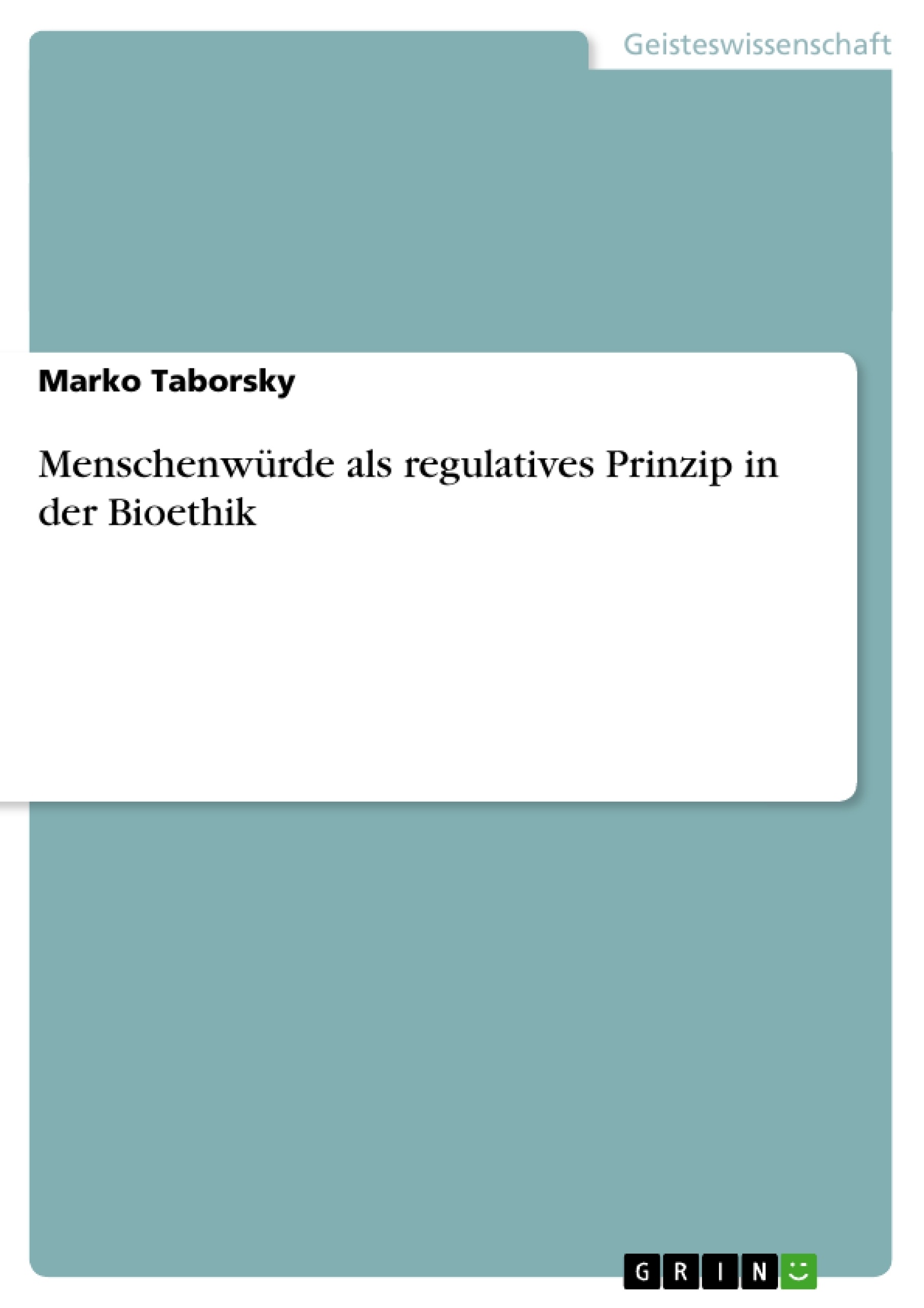Marko Taborsky
HS: Menschenwürde als regulatives Prinzip in der Ethik SomSem 99
Positionspapier: Menschenwürde als regulatives Prinzip in der Bioethik
Das Anliegen dieses Positionspapiers ist es nicht Verhaltensrichtlinien für den Einzelnen in spezifischen Situationen oder Problemstellungen, sondern soll eine konsensfähige Basis für einen Diskurs bieten. Dabei sollen allgemein (staatlich) anerkannte Menschenrechte, wie sie Verfassungen aufweisen, zu Grunde liegen und im Rahmen der Bioethik erörtert werden. Allerdings bildet dieses Theoriegerüst basierend auf dem Begriff Menschenwürde zwangsläufig einen Analyseapparat für spezifische Entscheidungen, die auf Analogien bzw. Disanalogien beruhen. Was analog bzw. disanalog im Kontext ist entscheidet das System bzw. die Diskussionsgrundlage, in diesem Fall die Menschenwürde im Rahmen der Bioethik. Wir wären also im Bereich der angewandten Ethik, die zum Teil auf sozialwissenschaftlichen Fragestellungen bzw. Erkenntnissen und Prämissen basiert. Es soll ein System errichtet werden, auf das die Kasuistik referieren können soll. Es erscheint mir sehr schwer und auch höchst komplex ein System errichten zu wollen, das zum einen eine allgemeine Theorie, basierend auf metaphysischen und psychosozialen Herleitungen, sein soll, zum anderen auch eine verbindliche Grundlage oder zumindest Analyseebene der entsprechenden Kasuistik sein soll.
Eine nicht rein deduktive Herleitung kann zu keinem Absolutum wie dem geforderten Begriff der Menschenwürde führen. Die Basis der ganzen Konzeption beruht auf einem allgemeinem Konsens zwischen Individuum, Gesellschaft und Staat, aber nicht auf einem unumstößlichen und absoluten Anspruch des Einzelnen auf seine Würde. An und für sich erlaubt eine solche Konzeption eigentlich jedwede Entscheidung in jedem Einzelfall, da ihre Grundlage, die Menschenwürde, leider variabel und nicht absolut ist, solange sie nicht rein deduktiv hergeleitet wurde sondern auf einem Konsens der Gesellschaft beruht. Ein vernünftiges Postulat oder ein Konsens bilden keine Grundlage für eine Theorie oder ein System, sondern geben bestenfalls eine gute Hypothese her.
Persönliche Meinung:
Die ganze Thematik ist sehr schwer greifbar, da ihr die Basis fehlt. Dieses Fehlen einer Metaebene verunmöglicht eigentlich auch eine spezifische Entscheidung im Rahmen der Kasuistik.
Wenn Sie in ein Auto steigen und nur daran glauben müssen, daß ein Motor inhärent zum Wagen ist, sie es aber nicht wissen, dann kann es sehr gefährlich sein den Wagen anzulassen, denn es könnte auch eine Autobombe sein, die dem Wagen inhärent ist. Oder :
Wir bauen ein großes Haus auf Stelzen, die aus dem Wasser ragen, aber wissen nicht wo der Grund ist oder wie dick die Stelzen unter Wasser sind und ob sie unser Haus überhaupt tragen werden oder auch erst mit der Zeit verfallen und unser Haus zum Untergang bringen.
Nachtrag zum 7.6. : Menschenwürde und Würde der Kreatur, Begriffsdeutung
Eigentlich stellen sich zwei Fragen:
1. Was ist Menschenwürde ?
2. Gibt es eine absolute Menschenwürde ?
1. Laut Balzer, Rippe, Schaber wird zwischen kontingenter und inhärenter Würde unterschieden. Kontingente Würde bezieht sich auf ästhetische, soziale oder expressive Normen, d.h. einer Person, Sache, Tier wird aufgrund ihrer Eigenschaften oder Tätigkeiten ein Würde zugeschrieben. Diese Würde ist allerdings ganz bestimmt nicht absolut, denn ihre Zuteilung kann durch Verlust bestimmter Eigenschaften oder Änderung des allgemeinen Normengefüges verlorengehen. Eine welke Pflanze strahlt weder ,,Würde" aus, noch wird ihr aus ästhetischen Gesichtspunkten eine Würde zugesprochen. Der alltägliche Sprachgebrauch ist mit Sicherheit eine große Bürde durch welche der Begriff der Menschenwürde in den Köpfen der meisten Menschen eine eher unförmige Masse darstellt, als ein logisches Fundament für ihre Existenz bietet. Solange wir von kontingenter Menschenwürde sprechen, bezieht das immer den alltäglichen Gebrauch des Wortes Würde mit ein, läßt uns aber kein theoretisches Gerüst erkennen, das einen Absolutheitsanspruch des Begriffes Menschenwürde begründen könnte.
2. Inhärente Menschenwürde, Menschenwürde als Eigenschaft eines menschlichen Wesens trifft diesen Punkt eher, ist aber schwer zu belegen. Dazu setzt sich der zugrundeliegende Text mit vier unzulänglichen Konzeptionen des Begriffs der inhärenten Menschenwürde auseinander. 1. Die imago dei - Konzeption scheitert an jedem ungläubigem Menschen, ebenso wie kein Theologe jene Eigenschaften zu bestimmen weiß, welche der Ebenbildlichkeit zwischen Mensch und Gott zu Grunde liegen. 2. Die kantische Konzeption ist zu restriktiv, sie findet nur begrenzt Anwendung wenn es um Grenzfragen geht, da innerhalb der kantschen Konzeption Würde absolut und ein Abwägen nicht möglich ist (Bsp. GG § 218 und die Entscheidungen des BVG). 3. Menschenwürde als die Fähigkeit Würde einfordern zu können als inhärente Würde zu bezeichnen fällt mir sehr schwer zu verstehen. Hier wird entweder eine potentielle Handlung zur Eigenschaft verklärt oder einfach biologische Gegebenheit mißachtet. Wenn ein Kleinkind oder ein geistig Behinderter keine Menschen sind, dann muß diese Konzeption schon allein aus Plausibilitätsgründen ebenso wie aus Mangel an Intersubjektivität abgelehnt werden. 4. Menschenwürde als Gruppe moralischer Rechte. Man kann kein Absolutum aus sozialpsychologischen Erwägungen herleiten. Sozialpsychologische Herleitungen taugen höchstens für einen kontingenten Menschenwürdebegriff.
3. Abschließend kann man nur sagen, daß eine allgemeine und auch anwendbare Konzeption des Begriffs der Menschenwürde noch aussteht oder vielleicht sogar unmöglich ist. Es könnte gut sein das Menschenwürde einen rein westlich, humanistisch konstruierten Begriff darstellt, der durch Naturrecht oder Metaphysik nicht ableitbar ist. Damit ist jener Menschenwürdebegriff gemeint, den wir uns alle wünschen oder glauben durch unsere Werte und Institutionen aufrechtzuerhalten, auch wenn eine logische bzw. vernünftige Grundlage dafür fehlt.
Häufig gestellte Fragen zu: Positionspapier: Menschenwürde als regulatives Prinzip in der Bioethik
Was ist das Ziel dieses Positionspapiers?
Das Ziel des Positionspapiers ist es, eine konsensfähige Basis für einen Diskurs über Menschenwürde im Rahmen der Bioethik zu bieten. Es soll keine Verhaltensrichtlinien für Einzelpersonen in spezifischen Situationen geben, sondern eine Grundlage für die Diskussion von allgemein anerkannten Menschenrechten, wie sie in Verfassungen verankert sind.
Worauf basiert das Theoriegerüst des Papiers?
Das Theoriegerüst basiert auf dem Begriff der Menschenwürde und bildet einen Analyseapparat für spezifische Entscheidungen, die auf Analogien bzw. Disanalogien beruhen. Die Grundlage für die Bewertung von Analogien und Disanalogien ist die Menschenwürde im Kontext der Bioethik.
Welchen Ansatz verfolgt das Papier in Bezug auf die angewandte Ethik?
Das Papier zielt darauf ab, ein System zu errichten, auf das sich die Kasuistik (Fallstudien) beziehen kann. Dieses System soll eine allgemeine Theorie, basierend auf metaphysischen und psychosozialen Herleitungen, sowie eine verbindliche Grundlage oder zumindest Analyseebene für die Kasuistik darstellen.
Welche Kritik äußert der Autor an einer nicht rein deduktiven Herleitung der Menschenwürde?
Der Autor kritisiert, dass eine nicht rein deduktive Herleitung nicht zu einem Absolutum wie dem geforderten Begriff der Menschenwürde führen kann. Er argumentiert, dass die Basis der Konzeption auf einem allgemeinen Konsens zwischen Individuum, Gesellschaft und Staat beruht, aber nicht auf einem unumstößlichen Anspruch des Einzelnen auf seine Würde. Dies könne zu variablen Entscheidungen führen, da die Grundlage, die Menschenwürde, nicht absolut ist.
Welche persönlichen Bedenken äußert der Autor?
Der Autor äußert Bedenken, dass die Thematik schwer greifbar ist, da ihr die Basis fehlt. Dieses Fehlen einer Metaebene verunmögliche eine spezifische Entscheidung im Rahmen der Kasuistik.
Welchen Nachtrag zum Thema Menschenwürde und Würde der Kreatur liefert der Autor?
Der Autor stellt zwei grundlegende Fragen: Was ist Menschenwürde? Und gibt es eine absolute Menschenwürde?
Wie unterscheidet der Autor zwischen kontingenter und inhärenter Würde?
Der Autor bezieht sich auf Balzer, Rippe und Schaber, die zwischen kontingenter und inhärenter Würde unterscheiden. Kontingente Würde bezieht sich auf ästhetische, soziale oder expressive Normen, während inhärente Würde eine Eigenschaft eines menschlichen Wesens ist, die aber schwer zu belegen ist.
Welche Konzeptionen der inhärenten Menschenwürde werden kritisiert?
Der Autor setzt sich kritisch mit vier Konzeptionen auseinander: 1. Die imago dei-Konzeption (Ebenbildlichkeit Gottes) scheitert an Ungläubigen. 2. Die kantische Konzeption ist zu restriktiv. 3. Menschenwürde als Fähigkeit, Würde einzufordern, wird als unzureichend betrachtet. 4. Menschenwürde als Gruppe moralischer Rechte wird als nicht absolut herleitbar kritisiert.
Zu welchem Schluss kommt der Autor bezüglich des Begriffs der Menschenwürde?
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass eine allgemeine und anwendbare Konzeption des Begriffs der Menschenwürde noch aussteht oder vielleicht sogar unmöglich ist. Er vermutet, dass Menschenwürde ein rein westlich, humanistisch konstruierter Begriff sein könnte, der nicht durch Naturrecht oder Metaphysik ableitbar ist.
Welche Schlussfolgerung zieht der Autor in Bezug auf das Handeln nach dem Prinzip der Menschenwürde?
Der Autor argumentiert, dass es besser ist, nach dem Prinzip der Menschenwürde zu handeln, auch wenn eine logische Grundlage dafür fehlt. Somit stellt Menschenwürde quasi ein vernünftiges Postulat im Rahmen der allgemeinen Ethik dar.
- Quote paper
- Marko Taborsky (Author), 1999, Menschenwürde als regulatives Prinzip in der Bioethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96042