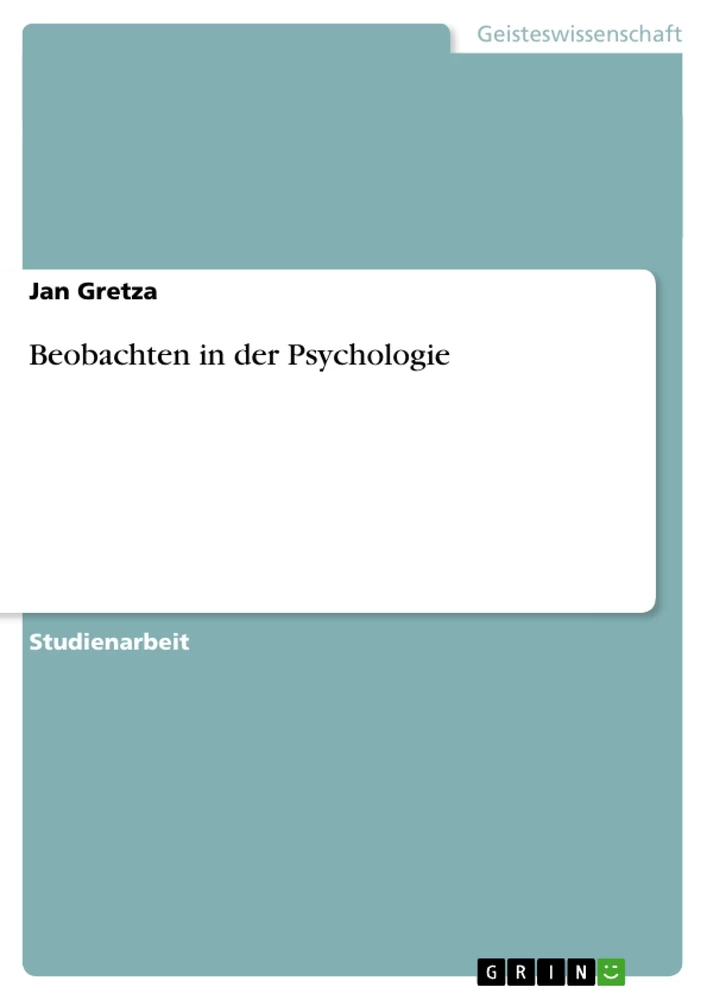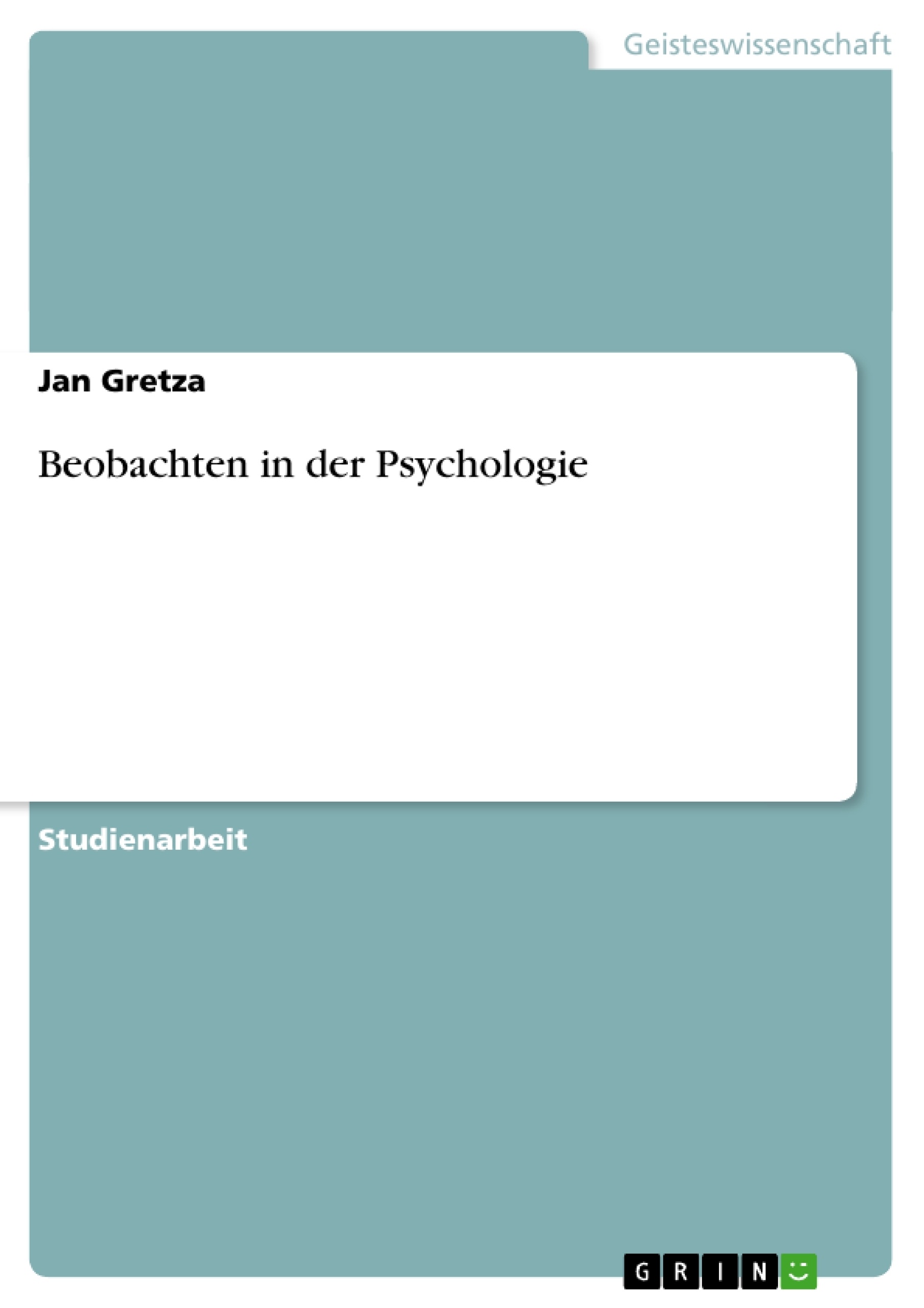Wie können wir die Welt um uns herum wirklich verstehen, wenn unsere Wahrnehmung stets von subjektiven Filtern und unbewussten Annahmen geprägt ist? Dieses Buch enthüllt die Prinzipien der systematischen Beobachtung als Schlüssel zur Erfassung objektiver Erkenntnisse in einer Vielzahl von Disziplinen, von der Verhaltensforschung bis zur Marktforschung. Es beleuchtet, wie sich wissenschaftliche Beobachtung von alltäglichem, zufälligem Wahrnehmen unterscheidet, indem es die Bedeutung von Planmäßigkeit, Selektivität und Zielgerichtetheit hervorhebt. Leserinnen und Leser lernen, wie sie Erkundungsbeobachtungen nutzen, um ein umfassendes Verständnis des Untersuchungsfelds zu erlangen, bevor sie sich in spezifische Beobachtungen vertiefen. Die Unterscheidung zwischen teilnehmenden und nicht-teilnehmenden Beobachtungen sowie offenen und verdeckten Ansätzen wird detailliert erläutert, wobei die jeweiligen Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Validität der Ergebnisse diskutiert werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von Beobachtungsplänen, die von freien bis hin zu hochstandardisierten Methoden reichen, um sicherzustellen, dass die Datenerhebung präzise und reproduzierbar ist. Die Prozesse der Selektion, Abstraktion und Klassifikation werden als grundlegende Schritte zur Reduktion von Komplexität und zur Identifizierung relevanter Muster vorgestellt. Techniken wie Ereignis- und Zeitstichproben werden untersucht, um die Erfassung von Daten zu optimieren und Verzerrungen zu minimieren. Das Buch behandelt auch die entscheidende Rolle des Beobachtertrainings, um die intersubjektive Übereinstimmung zu erhöhen und subjektive Einflüsse zu reduzieren. Abschließend werden die Herausforderungen bei der Auswertung und Interpretation von Beobachtungsdaten erörtert, wobei Reliabilität und Validität als zentrale Kriterien für die Beurteilung der Qualität der Ergebnisse hervorgehoben werden. Ob Feldstudie, Laborstudie oder seminaturalistisches Setting – dieses Werk bietet einen umfassenden Leitfaden für alle, die ihre Beobachtungsfähigkeiten verbessern und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage empirischer Evidenz treffen möchten, und liefert wertvolle Einblicke für Forschende, Studierende und Praktiker in den Bereichen Psychologie, Soziologie, Marketing und darüber hinaus. Die Kunst der systematischen Beobachtung wird somit zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden, der die Welt präziser erfassen und interpretieren will.
1. Zusammenfassung
Es werden verschiedene Aspekte und Formen der wissenschaftlichen, systematischen Beobachtung dargestellt, insbesondere werden die Erstellung eines Beobachtungsplanes und die Probleme verschiedener Beobachtungsformen und -methoden angerissen.
1. Einleitung
Unter Beobachten versteht man nach Laatz (1993) "das Sammeln von Erfahrungen in einem nichtkommunikativen Prozeß mit Hilfe sämtlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten", was jedoch meistens auf die visuelle Wahrnehmung beschränkt ist. Im Gegensatz zur Alltagsbeobachtung, die durchaus 'zufällig' bzw. willkürlich erfolgen kann, d.h. nicht zwangsweise zielgerichtet ist und auch nicht unbedingt aktiv den Beobachtungsgegenstand in den Mittelpunkt des Interesses rückt, ist die wissenschaftliche, systematische Beobachtung dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Beobachter planvoll, selektiv und zielgerichtet vorgehen, was die für ernsthafte empirische Untersuchungen notwendige größtmögliche intersubjektive Überprüfbarkeit der Beobachtung garantieren soll.
Es ist sinnvoll, vor der eigentlichen Beobachtung - soweit möglich - eine allgemeine
Beobachtung des gesamten Untersuchungsfeldes durchzuführen, um einen Überblick über die Situation zu gewinnen und so besser entscheiden zu können, welche Aspekte den Schwerpunkt der eigentlichen Beobachtung bilden sollen (so ist es bei der Beobachtung einer Tierkolonie beispielsweise angebracht, diese vor der systematischen Beobachtung erst allgemein zu erkunden, um sich sowohl mit den Örtlichkeiten als auch mit dem generellen Verhalten der Tiere vertraut zu machen). Dies kann man als Erkundungsbeobachtung bezeichnen.
Generell läßt sich die Form einer Beobachtung in zweierlei Hinsicht unterscheiden: Zum einen differenziert man zwischen teilnehmenden und nicht-teilnehmenden Beobachtungen, zum anderen zwischen offenen und verdeckten Beobachtungen. Unter einer teilnehmenden Beobachtung versteht man eine Beobachtung, bei der der Beobachter selbst Teil des zu beobachtenden Geschehens ist, er also z.B. mit zu beobachtenden Personen mehr oder weniger aktiv interagiert. Eine nicht-teilnehmende Beobachtung erfolgt aus einer vom Beobachtungsgeschehen unabhängigen Position heraus (beispielsweise die Beobachtung der obigen Tierkolonie aus sicherer Entfernung). Bei der verdeckten Beobachtung versucht der Beobachter im Gegensatz zur offenen Beobachtung, so gut wie möglich seine Rolle als Beobachter gegenüber den Beobachtungsobjekten zu verbergen.
Weiterhin ist es von Bedeutung, in welcher Umgebung eine Beobachtung durchgeführt wird, d.h. ob sie in dem für die Beobachtungsobjekte gewohnten Setting (Feldstudie), im Labor (Laborstudie) oder in einem im Labor möglichst natürlich konstruierten (seminaturalistischen) Setting stattfindet.
2. Methoden
Vor der eigentlichen Beobachtung stehen in den meisten Fällen zwei wesentliche
Vorbereitungsphasen: zum einen das Erstellen eines Beobachtungsplanes, und zum anderen das Training der Beobachter. Je nachdem, in wie weit der Beobachtungsplan die Beobachtung in Hinsicht auf zu berücksichtigende Objekte, irrelevante Geschehnisse, Deutungsrahmen, Zeit und Ort der Beobachtung sowie Art des Protokollierens einschränkt, spricht man von freien (oder nicht-standardisierten), halbstandardisierten oder von standardisierten Beobachtungen. Eine freie Beobachtung verzichtet im wesentlichen gänzlich auf eine Einschränkung des Beobachters und dient meist dazu, sich einen Überblick über bislang unbekannte Gebiete zu verschaffen, wie z.B. im Rahmen einer Erkundungsbeobachtung. Von einer halbstandardisierten Beobachtung spricht man, wenn nur einige Aspekte der Beobachtung eingegrenzt (oder präzise vorgegeben) werden, von einer standardisierten Beobachtung, wenn die Planung der Beobachtung vollständig präzisiert ist.
Die Filterung der zu beobachtenden Objekte sowie der irrelevanten Geschehnisse bezeichnet man als Selektion. Die Beobachtung wird auf wenige, genau überschaubare Objekte und Ereignisse eingegrenzt, so zum Beispiel bei der Beobachtung einer Tierkolonie auf nur wenige, klar erkennbare Verhaltensmuster eines Einzeltieres.
Die Einteilung des Verhaltens bzw. der beobachtbaren Merkmale und Ereignisse in in eben jene Muster bzw. übergeordnete Kategorien bezeichnet man als Abstraktion. Gemeint ist dabei das Herauslösen eines konkreten Merkmals bzw. Ereignisses aus seiner "historischen Einmaligkeit" und die Reduktion auf seine eigentliche Bedeutung. Als Beispiel im Rahmen der Beobachtung einer Vogelkolonie könnte hierbei die Abstraktion des konkreten Ereignisverlaufes, der aus Wenden eines Altvogels zum Jungen, dem mehrfachen Hochwürgen von Nahrung mit leicht geöffnetem Schnabel sowie dem häppchenweise geschehenden Abholen der Nahrung aus dem Schnabel des Altvogels durch das Junge besteht, durch den Begriff "Füttern des Jungvogels" dienen.
Sind Selektion und Abstraktion durchgeführt, so folgt die Zuordnung von Zeichen und Symbolen zu den einzelnen abstrahierten Merkmals- und Ereignisklassen. Hierbei werden Merkmale und Ereignisse mit ähnlicher bzw. logisch zusammenhängender Bedeutung in den verschiedenen Klassen zusammengefaßt. Diesen Vorgang bezeichnet man als Klassifikation. Beispielsweise könnte man verschiedene Arten einer Tierart, sich zu Artikulieren, bei der Beobachtung in einer Klasse zusammenfassen und demzufolge mit ähnlicher Symbolik beim Protokollieren versehen.
Schließlich erfolgt im Rahmen der Systematisierung die Ordnung der verschiedenen beobachteten bzw. vorgegebenen (z.B. Zeit und Ort) Größen zu einem übersichtlichen Gesamtprotokoll mit dem Ziel, die für das konkrete Untersuchungsziel relevanten Informationen leicht verfügbar zu machen. Hierbei muß entschieden werden, wie bei der Auswahl der Stichprobe aus dem gesamten (nicht gänzlich beobachtbaren) Untersuchungsfeld vorgegangen werden soll: Soll es sich um eine Ereignisstichprobe oder eine Zeitstichprobe handeln? Bei einer Ereignisstichprobe wird darauf verzichtet, die beobachteten Ereignisse in einem zeitlichen Schema zu erfassen, es wird lediglich erfaßt, ob bzw. wie häufig ein bestimmtes Ereignis eintritt. Eine Zeitstichprobe unterteilt die Beobachtung in feste Zeitabschnitte, in denen entweder kontinuierlich ein Beobachtungsobjekt fokussiert wird, oder in denen jeweils das Beobachtungsobjekt aus einer mehrere Objekte umfassenden Menge neu gewählt wird. Ein Beispiel für eine Zeitstichprobe ist bei der Beobachtung einer Vogelkolonie das Protokollieren des momentanen Verhaltens eines Tieres in 5-Sekunden- Abschnitten.
Im Anschluß an diese Erstellung des Beobachtungsplanes sollte ein ausführliches Training der Beobachter durchgeführt werden. Dies dient einerseits zur Vermeidung von Problemen, die die Beobachter mit der Deutung des Beobachtungsplanes haben könnten, und zum anderen zur Sensibilisierung der Beobachter auf die zu beobachtenden Merkmale und Ereignisse, mit dem Ziel, die subjektiven Einflüsse der individuellen Beobachter in das Beobachtungsprotokoll zu minimieren. Die tatsächliche Beobachterübereinstimmung sollte ebenfalls während des Trainings ermittelt werden, damit der Beobachtungsplan gegebenenfalls präzisiert werden kann. Außerdem sollte bei einer apparativ unterstützten Beobachtung eine Schulung der Beobachter im Umgang mit dem verwendeten Equipment (z.B. Videokameras) erfolgen.
Während der konkreten Beobachtung können verschiedene technische Hilfsmittel eingesetzt werden, wobei generell zwischen Geräten, die die Protokollierung unterstützen bzw. einen Teil dieser erledigen, und solchen, die selbständig eine vollständige Protokollierung vornehmen, unterschieden werden kann. Erstere erledigen beispielsweise die Protokollierung der Zeit, während der Beobachter nur noch die selektierten Ereignisse protokollieren muß, zu letzteren gehören z.B. Video- und Tonbandgeräte.
3. Auswertung
Nach der Erhebung des Datenmaterials erfolgt dessen Auswertung und Deutung, gegebenenfalls nach vorheriger statistischer Aufbereitung. Hierzu gehört auch die Relativierung der gewonnenen Daten, d.h. das kritische Hinterfragen, in wie weit diese tatsächlich Informationen für die Aufgabenstellung der Studie enthalten (soweit dies noch nicht im Vorfeld geklärt werden konnte). Zwei wichtige Aspekte hierzu sind die Reliabilität und die Validität. Unter Reliabilität versteht man die Zuverlässigkeit der gewonnenen Daten. Waren die Beobachter während des Protokollierens beispielsweise häufig unsicher oder abgelenkt, so werden reale und protokollierte Merkmale und Ereignisse mit großer Wahrscheinlichkeit stärker divergieren als ohne diese Einflüsse, die gewonnenen Daten weisen also eine geringere Reliabilität auf. Unter Validität versteht man die Gültigkeit der beobachteten Daten in Bezug auf ihre Deutung, d.h. ob wirklich das beobachtet wurde, was beobachtet werden sollte, oder ob nicht vielleicht ganz andere Einflußfaktoren die Daten verfälschen.
4. Diskussion
Bei jeder wissenschaftlichen Beobachtung gibt es mehrere Punkte zu berücksichtigen, die sich nicht durch reine Formalismen beschreiben lassen.
Die Frage, in wie weit die Form der Durchführung einer Beobachtung die Ergebnisse verfälscht, ist immer zu beachten. So ist zwar bei einer teilnehmenden Beobachtung meist ein tieferer Einblick in die Geschehnisse möglich (wenn z.B. der Beobachter in das zu beobachtende Milieu eingebracht werden muß), auf der anderen Seite besteht die Gefahr, daß er dann (unbewußt) die Geschehnisse nach seinen vorhandenen Vorstellungen lenkt, so daß im Zweifelsfall eher ein hypothesenkonformes Verhalten der beobachteten Personen zu beobachten ist als ohne den teilnehmenden Beobachter, also ein gewisses Maß an beobachtungsverfälschender Manipulation stattfindet. Auch schränkt eine teilnehmende Beobachtung den maximalen Standardisierungsgrad der Beobachtung ein, da der Beobachter sonst überfordert wäre.
Auch bei einer offenen Beobachtung, insbesondere bei apparativen Beobachtungen besteht die Gefahr, daß sich die Beobachtungsobjekte aufgrund der Anwesenheit des Beobachters nicht natürlich verhalten, sondern über den Sinn der Beobachtung spekulieren und sich 'sozial erwünscht' verhalten, und auch so wieder ein verfälschtes Bild der Realität entsteht. Eine verdeckte Beobachtung kann sich dafür im Gegenzug als wesentlich schwieriger realisierbar erweisen und liefert auch meist einen weniger tiefen Einblick in die Geschehnisse. Auch bleibt es meist ungewiß, ob die Beobachtung tatsächlich unentdeckt blieb.
Genau die gleichen Punkte müssen natürlich auch bei Laborstudien (auch mit seminaturalistischem Setting) berücksichtigt werden, da diese nie wirklich verdeckt sein können, selbst wenn es die eigentliche Beobachtung ist.
Ein weiterer Einflußfaktor, der immer vorhanden ist, ist der Beobachter selbst. Da dieser sich auf seine Wahrnehmung verlassen muß, und diese zwangsweise Fluktuationen (beispielsweise der Aufmerksamkeit) unterworfen ist, und sich manchmal auch persönliche Deutungen bei der Protokollierung nicht vermeiden lassen, entsteht hierdurch immer ein verzerrtes Bild der Realität. Deshalb bietet sich der Einsatz mehrerer Beobachter bzw.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text behandelt verschiedene Aspekte und Formen der wissenschaftlichen, systematischen Beobachtung. Er geht auf die Erstellung eines Beobachtungsplanes ein und thematisiert die Probleme verschiedener Beobachtungsformen und -methoden.
Was versteht man unter wissenschaftlicher, systematischer Beobachtung?
Im Gegensatz zur Alltagsbeobachtung ist die wissenschaftliche, systematische Beobachtung durch planvolles, selektives und zielgerichtetes Vorgehen des Beobachters gekennzeichnet. Dies soll die intersubjektive Überprüfbarkeit der Beobachtung gewährleisten.
Was ist eine Erkundungsbeobachtung?
Eine Erkundungsbeobachtung ist eine allgemeine Beobachtung des gesamten Untersuchungsfeldes, die vor der eigentlichen systematischen Beobachtung durchgeführt wird, um einen Überblick über die Situation zu gewinnen und zu entscheiden, welche Aspekte den Schwerpunkt der eigentlichen Beobachtung bilden sollen.
Welche Formen der Beobachtung werden unterschieden?
Man unterscheidet zwischen teilnehmenden und nicht-teilnehmenden Beobachtungen sowie zwischen offenen und verdeckten Beobachtungen. Teilnehmende Beobachtung bedeutet, dass der Beobachter selbst Teil des Geschehens ist, während nicht-teilnehmende Beobachtung aus einer unabhängigen Position erfolgt. Bei der offenen Beobachtung ist die Rolle des Beobachters erkennbar, bei der verdeckten Beobachtung wird sie verborgen.
Wo kann eine Beobachtung durchgeführt werden?
Beobachtungen können im natürlichen Setting (Feldstudie), im Labor (Laborstudie) oder in einem im Labor natürlich konstruierten (seminaturalistischen) Setting stattfinden.
Was ist ein Beobachtungsplan?
Ein Beobachtungsplan legt fest, welche Objekte berücksichtigt werden, welche Geschehnisse irrelevant sind, welche Deutungsrahmen gelten, wann und wo die Beobachtung stattfindet und wie die Protokollierung erfolgt. Je nach Grad der Einschränkung spricht man von freien, halbstandardisierten oder standardisierten Beobachtungen.
Was bedeutet Selektion, Abstraktion und Klassifikation im Kontext der Beobachtung?
Selektion bezeichnet die Filterung der zu beobachtenden Objekte und irrelevanten Geschehnisse. Abstraktion ist die Einteilung des Verhaltens in übergeordnete Kategorien. Klassifikation ist die Zuordnung von Zeichen und Symbolen zu den einzelnen abstrahierten Merkmals- und Ereignisklassen.
Was ist der Unterschied zwischen Ereignis- und Zeitstichprobe?
Bei einer Ereignisstichprobe wird nur erfasst, ob bzw. wie häufig ein bestimmtes Ereignis eintritt. Eine Zeitstichprobe unterteilt die Beobachtung in feste Zeitabschnitte, in denen entweder kontinuierlich ein Beobachtungsobjekt fokussiert wird oder jeweils ein neues Objekt aus einer Menge gewählt wird.
Warum ist ein Training der Beobachter wichtig?
Ein Training dient zur Vermeidung von Problemen bei der Deutung des Beobachtungsplanes, zur Sensibilisierung der Beobachter auf die zu beobachtenden Merkmale und Ereignisse sowie zur Minimierung subjektiver Einflüsse. Es hilft auch, die Beobachterübereinstimmung zu ermitteln und den Umgang mit technischen Hilfsmitteln zu schulen.
Welche technischen Hilfsmittel können bei der Beobachtung eingesetzt werden?
Es gibt Geräte, die die Protokollierung unterstützen (z.B. Zeiterfassung) und solche, die selbständig eine vollständige Protokollierung vornehmen (z.B. Video- und Tonbandgeräte).
Was bedeuten Reliabilität und Validität bei der Auswertung von Beobachtungsdaten?
Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit der gewonnenen Daten. Validität bezeichnet die Gültigkeit der beobachteten Daten in Bezug auf ihre Deutung, d.h. ob wirklich das beobachtet wurde, was beobachtet werden sollte.
Welche Einflüsse können die Ergebnisse einer Beobachtung verfälschen?
Die Form der Durchführung (teilnehmend vs. nicht-teilnehmend, offen vs. verdeckt), das Setting (Labor vs. Feld), das Verhalten der Beobachtungsobjekte aufgrund der Anwesenheit des Beobachters und der Beobachter selbst (Wahrnehmungsfluktuationen, persönliche Deutungen) können die Ergebnisse verfälschen.
Warum ist der Einsatz mehrerer Beobachter sinnvoll?
Der Einsatz mehrerer Beobachter oder technischer Equipments kann dazu beitragen, Verzerrungen durch individuelle Wahrnehmung zu reduzieren und ein objektiveres Bild der Realität zu erhalten.
- Quote paper
- Jan Gretza (Author), 1998, Beobachten in der Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95977