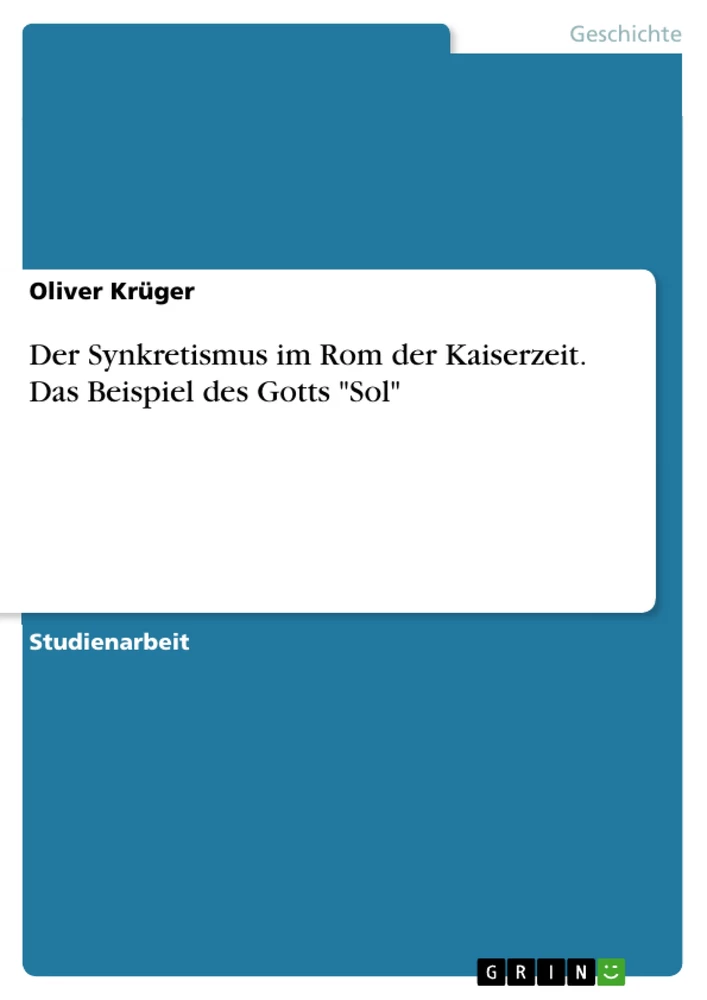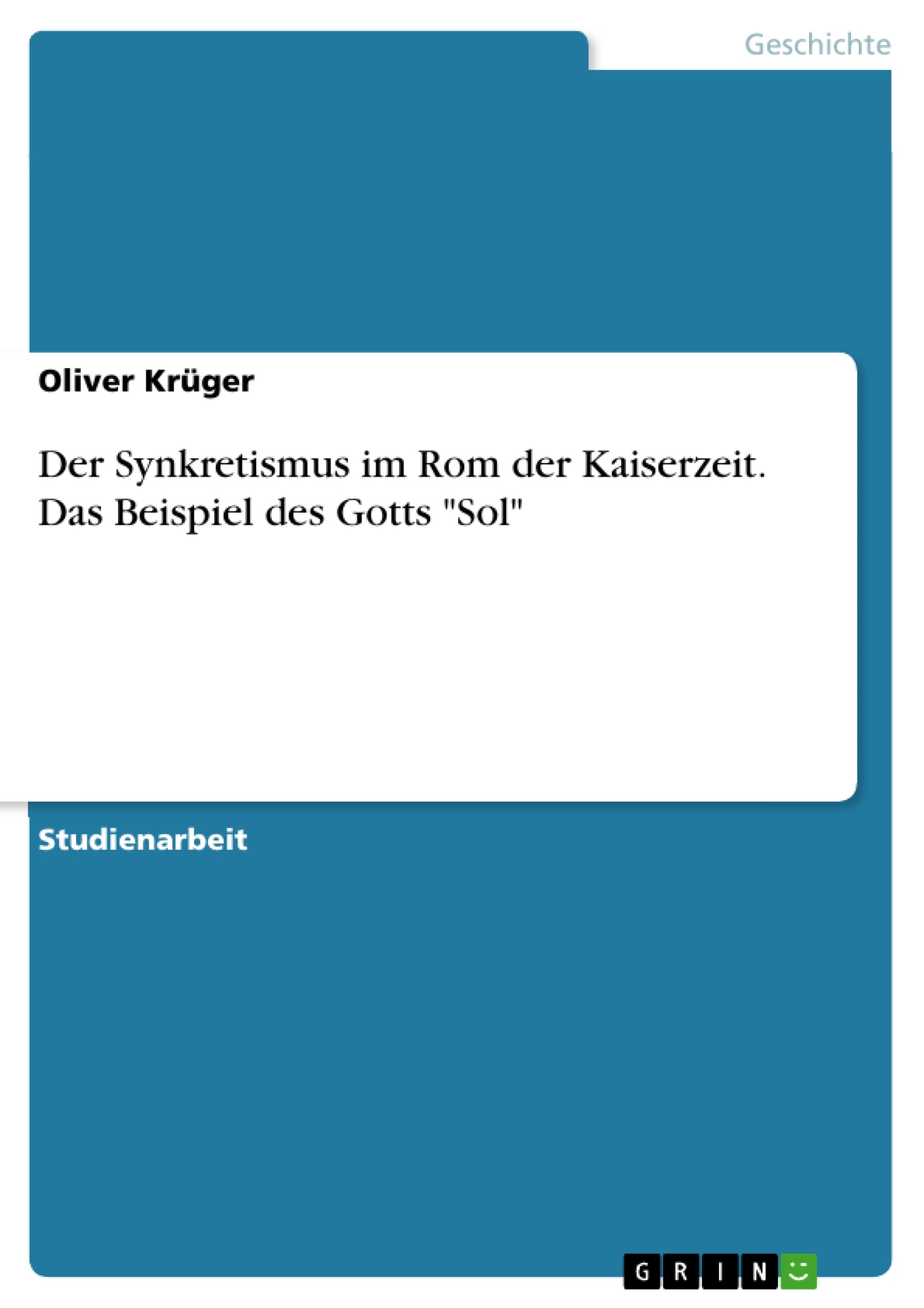Ziel dieser Arbeit soll es sein, am Beispiel dieses Kultes den Synkretismus der Kaiserzeit näher zu beleuchten. Neben einer Darstellung der für dieses Thema relevanten Aspekte der bisweilen kontroversen Mithras-Forschung wird dabei ein besonderes Augenmerk dem eigentümlichen Verhältnis der ebenfalls in einem zeitweilig zur Staatsreligion avancierten Kult verehrten Sonnengottheit Sol und der namensgebenden zentralen Figur des römischen Mithras-Kultes gewidmet werden.
Die moderne, globalisierte Welt erscheint uns, weltumspannender Kommunikation in Echtzeit zum Trotz, als geprägt von religiösen und ethnischen Konflikten. Das antike Imperium Romanum umfasste einen Großteil der, den Europäern damals bekannten Welt. Es reichte zeitweilig vom Norden Großbritanniens bis weit in den Nahen Osten, vom Balkan bis nach Nordafrika. Wenn wir uns auf das anachronistische Gedankenspiel einlassen, dieses „Weltreich" als eine antike Erscheinungsform der Globalisierung zu betrachten, drängen sich viele Fragen auf: Wie lässt sich die relative Stabilität dieses multiethnischen Staatengebildes erklären? Wie ließen sich sprachliche und kulturelle Barrieren überbrücken? Boten nicht die unterschiedlichen Religionen der zahllosen Ethnien allein schon genug Sprengstoff um das Römische Reich zur Implosion zu bringen?
Die Stabilität lässt sich nicht allein auf eine militärische, technische oder gar kulturelle Dominanz der römischen Gesellschaft zurückführen. Vielmehr war diese Gesellschaft geprägt von einer beeindruckenden Integrationskraft. Ein Bewohner der britannischen Inseln oder der nordafrikanischen Provinzen konnte sich ebenso als römischer Bürger fühlen wie ein in der Einwohner der Hauptstadt Rom. Dass diese Identifikation mit Rom außerhalb der italischen Kernlande überhaupt möglich war, lag zum Teil begründet in einer Politik der Abgrenzung gegenüber den „Barbaren" außerhalb der römischen Grenzen und in der Sicherheit, die die Schutzmacht innerhalb dieser Grenzen bot.
Eine effektive Wirtschaftsordnung, die relativen Wohlstand ermöglichte, machte den römischen Lebensstil darüber hinaus für viele attraktiv. Mindestens ebenso wichtig war jedoch die Fähigkeit der römischen Gesellschaft fremde Ethnien und Kulturen unter dem Dach der antiken Reichsidee zu vereinen und deren potenzielle Andersartigkeit nicht nur zu tolerieren, sondern sich den fremden Kulturen zuweilen interessiert zuzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interpretatio Romana
- Der Mithras-Kult
- Die Ursprünge des römischen Mithras-Kultes
- Zeitliche und räumliche Verbreitung
- Die Anhänger
- Theologie und mythische Episoden des Mithras-Kultes
- Die Geburt aus dem Fels
- Das Wasserwunder
- Mithras & Sol
- Die Stierjagd
- Das Stieropfer
- Mithras und Sol
- Sol - Die unbesiegte Sonne
- Öffentliche Anerkennung auf Umwegen
- Darstellungen von Sol und Mithras im Mithras-Kult
- Unterwerfung des Sol
- Freundschaftsvertrag und Kultmahl
- Die Fahrt mit dem Sonnenwagen
- Fazit
- Literatur & Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Synkretismus im römischen Reich anhand des Mithras-Kultes. Die Arbeit beleuchtet die Interpretatio Romana und deren Rolle bei der Integration fremder Religionen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Verhältnis zwischen Mithras und Sol Invictus, der römischen Sonnengottheit.
- Interpretatio Romana als Integrationsmechanismus im römischen Reich
- Der Mithras-Kult: Ursprünge, Verbreitung und Anhänger
- Die Theologie und Mythen des Mithras-Kultes
- Die Beziehung zwischen Mithras und Sol Invictus
- Synkretismus als charakteristisches Merkmal der römischen Religionslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung diskutiert die relative Stabilität des multiethnischen Römischen Reiches und die Rolle der religiösen Toleranz und Integration. Sie stellt die Frage, wie die Römer die kulturelle und religiöse Diversität ihres Reiches bewältigten und hebt die Bedeutung der Integrationskraft der römischen Gesellschaft hervor. Der Mithras-Kult wird als Beispiel für die synkretistische Praxis des Reiches vorgestellt.
Interpretatio Romana: Dieses Kapitel erläutert das Konzept der Interpretatio Romana, die römische Praxis, fremde Gottheiten mit den Figuren des römischen Pantheons gleichzusetzen. Es wird anhand von Tacitus' Germania und der Gleichsetzung germanischer Götter mit römischen illustriert. Die Interpretatio Romana wird als Schlüssel zum Verständnis der religiösen Toleranz und des Religionsfriedens im Römischen Reich dargestellt, da sie die "Missionierung" fremder Kulturen überflüssig machte. Der synkretistische Charakter der römischen Religion wird hervorgehoben.
Der Mithras-Kult: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Mithras-Kult, seinen Ursprüngen, seiner zeitlichen und räumlichen Verbreitung sowie seinen Anhängern. Es beschreibt die Theologie und die mythischen Episoden des Kultes, wie die Geburt aus dem Fels, das Wasserwunder, die Stierjagd und das Stieropfer. Die verschiedenen Aspekte des Kultes werden detailliert dargestellt, um ein umfassendes Bild zu liefern.
Mithras und Sol: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Verhältnis zwischen Mithras und Sol Invictus. Es untersucht die öffentliche Anerkennung des Sol-Kultes und analysiert die gemeinsamen Darstellungen von Mithras und Sol in den Mithras-Tempeln. Die Symbiose dieser beiden Gottheiten wird im Kontext des römischen Synkretismus betrachtet. Die Kapitel befasst sich mit der Unterwerfung des Sol, dem Freundschaftsvertrag und dem Kultmahl sowie der Fahrt mit dem Sonnenwagen.
Schlüsselwörter
Mithras, Sol Invictus, Synkretismus, Interpretatio Romana, Römisches Reich, Kaiserzeit, Religiöse Toleranz, Integration, Kult, Mythen, Theologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Mithras und Sol Invictus
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Synkretismus im römischen Reich anhand des Mithras-Kultes und konzentriert sich insbesondere auf das Verhältnis zwischen Mithras und Sol Invictus, der römischen Sonnengottheit. Sie beleuchtet die Interpretatio Romana als Integrationsmechanismus für fremde Religionen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Interpretatio Romana, die Ursprünge, Verbreitung und Anhänger des Mithras-Kultes, die Theologie und Mythen des Kultes (Geburt aus dem Fels, Wasserwunder, Stierjagd, Stieropfer), die Beziehung zwischen Mithras und Sol Invictus, sowie den Synkretismus als charakteristisches Merkmal der römischen Religionslandschaft.
Was ist die Interpretatio Romana und welche Rolle spielt sie in der Arbeit?
Die Interpretatio Romana ist die römische Praxis, fremde Gottheiten mit den Figuren des römischen Pantheons gleichzusetzen. Die Arbeit zeigt, wie dieser Mechanismus zur Integration fremder Religionen und zum religiösen Frieden im römischen Reich beitrug, indem er die "Missionierung" überflüssig machte.
Welche Aspekte des Mithras-Kultes werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Ursprünge des Mithras-Kultes, seine zeitliche und räumliche Verbreitung, seine Anhänger, seine Theologie und seine mythischen Episoden im Detail. Besonderes Augenmerk liegt auf der Beziehung zu Sol Invictus.
Wie wird das Verhältnis zwischen Mithras und Sol Invictus dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen Mithras und Sol Invictus, die öffentliche Anerkennung des Sol-Kultes und die gemeinsamen Darstellungen beider Gottheiten in Mithras-Tempeln. Die Symbiose dieser beiden Gottheiten wird im Kontext des römischen Synkretismus betrachtet, einschließlich der Unterwerfung des Sol, des Freundschaftsvertrages, des Kultmahls und der Fahrt mit dem Sonnenwagen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Interpretatio Romana, zum Mithras-Kult (mit Unterkapiteln zu seinen Ursprüngen, Verbreitung, Anhängern und Mythen), zu Mithras und Sol, sowie ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Mithras, Sol Invictus, Synkretismus, Interpretatio Romana, Römisches Reich, Kaiserzeit, Religiöse Toleranz, Integration, Kult, Mythen, Theologie.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die Arbeit enthält ein Literatur- und Quellenverzeichnis, das weitere Informationen zu den behandelten Themen bietet.
- Arbeit zitieren
- Oliver Krüger (Autor:in), 2015, Der Synkretismus im Rom der Kaiserzeit. Das Beispiel des Gotts "Sol", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/959610