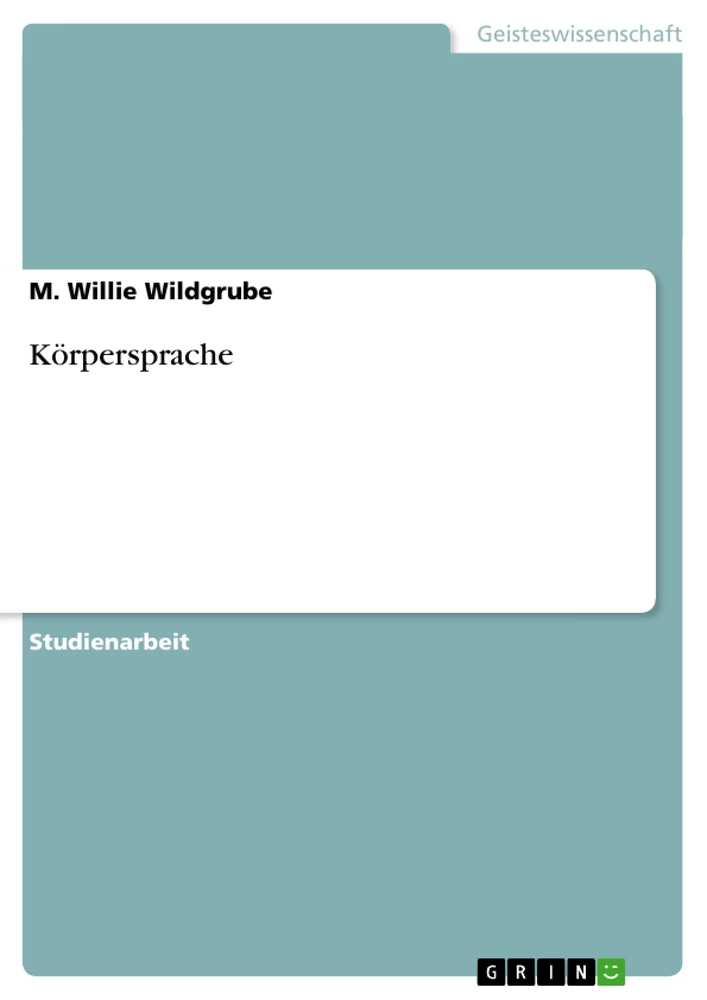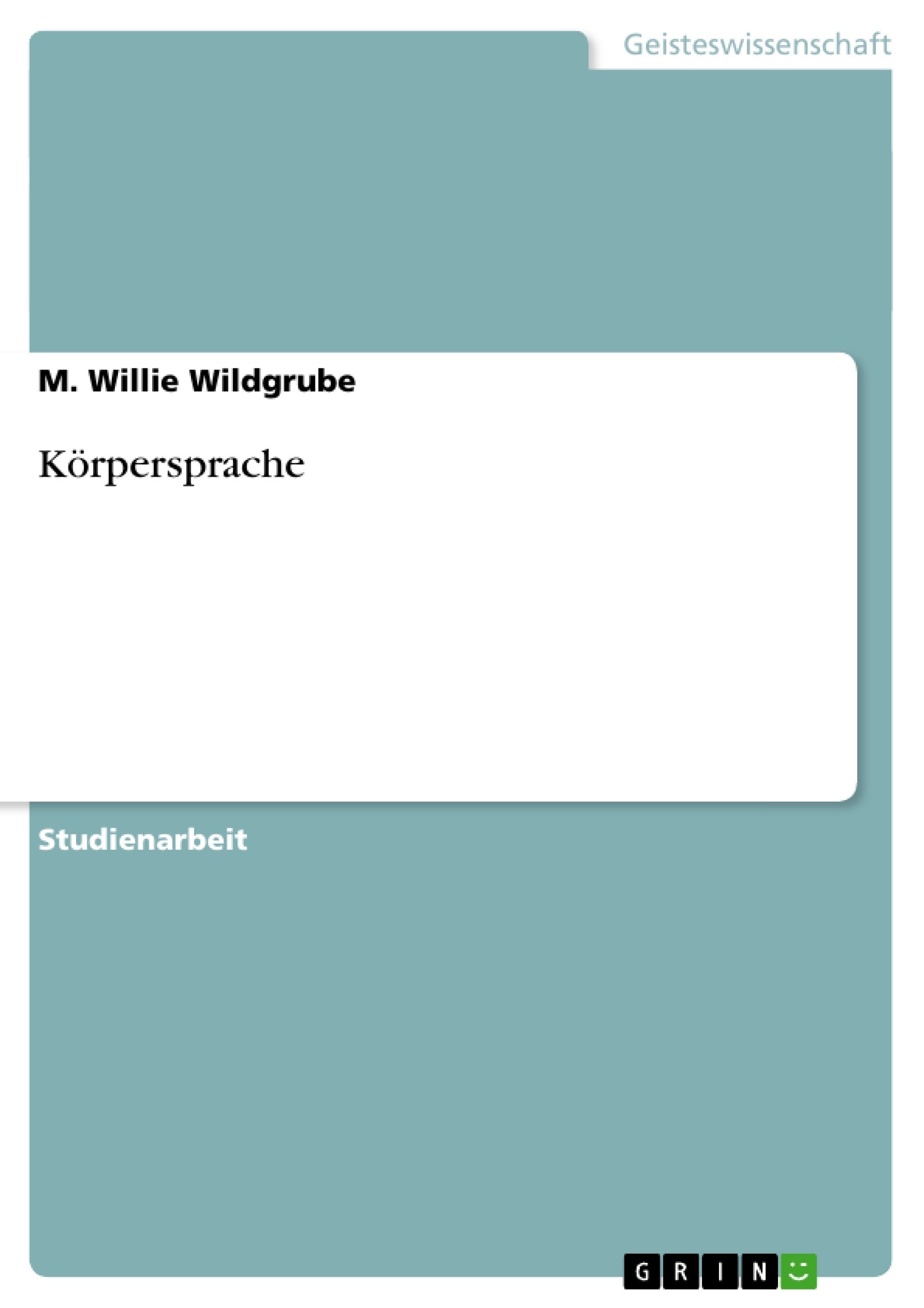INHALTSVERZEICHNIS
1. Was ist nonverbale Kommunikation
1.1 Körperhaltung und Ausnutzung des Raumes
1.2 Blickkontakt
1.3 Gesichtsausdruck und Kopfhaltung
1.4 Tonfall der Stimme
1.5 Gesten und andere Handbewegungen
1.6 Kulturelle Einflüsse
2. Körpersprache der Kinder
3. Nonverbale Kommunikation im Unterricht
3.1 Unterricht als kommunikativer Prozess
3.2 Kommunikation als Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht
3.3 Grundfunktionen unterrichtlicher Kommunikation
3.4 Die Komplexitätsproblematik unterrichtlicher Kommunikation
4. Wie Schüler die Körpersprache des Lehrers lesen
5. Der Lehrer als Erzieher
6. Merkmale des praxisnahen Trainingsverfahrens
6.1 Aufbau und Durchführung des Trainings
6.2 Nichtverbales Lehrerverhalten in oder vor der Klasse
6.3 Lehrersprache
LITERATURVERZEICHNIS
Auszug aus dem Internet
Thema: Körpersprache
HEIDEMANN, R.
Körpersprache vor der Klasse, Quelle und Meyer Verlag, Heidelberg - Wiesbaden, (S 24 - 28, S 58 - 105)
KLIEBISCH, U.
Kommunikation und Selbstsicherheit, Verlag an der Ruhr,
(S 63 - 64)
ROSENBUSCH, H.S. / SCHOBER, O.,
Körpersprache in der schulischen Erziehung, Pädagogischer Verlag,
S 49 - 59, S 73 - 83
ROTBUCHER, H. / WURST, F. / DONNEBERB, R.
Braucht eine neue Generation eine neue Pädagogik Samy MOLCHO, S 72 - 93,
Otto Müller Verlag, Salzburg
SEAN, Neill / CASWELL, Chris,
Körpersprache im Unterricht, Daedalus Verlag, 1993 S 25 - 31
1. WAS IST NONVERBALE KOMMUNIKATION ?
Körpersprache ist eine Komponente zwischenmenschlichen Verhaltens, die menschliche Beziehungen - ohne Sprache, bewusst und unbewusst
- aufrechterhält und steuert.
Es geht beim Verständnis der Körpersprache nicht nur um wenige Grundregeln, sondern um das Zusammenwirken vieler Einzelheiten. Der Begriff nonverbale Kommunikation lässt sich auf vielfältige Weise definieren.
1.1 KÖRPERHALTUNG UND AUSNUTZUNG DES RAUMES
Die Einteilung und die Nutzung des Raumes im Klassenzimmer wird vom Lehrer bereits festgelegt, bevor der eigentliche Unterricht beginnt.
Der Abstand zwischen den an einer kommunikativen Situation beteiligten Personen hat wesentlichen Einfluss auf die Intensität des Verhältnisses. Die Nähe oder Distanz spielen hier eine Rolle.
(Vgl. Neill / Caswell, S 25 -26)
Der Anthropologe Edward Hall hat diese Zonen folgendermaßen unterschieden:
Die enge Intimzone von 15cm oder weniger ist der Liebe und Umarmungen zu Schutz- oder Trostzwecken vorbehalten. Nur die uns am nächsten Stehenden dürfen uns so nahe stehen. Die wichtigsten Sinneseindrücke sammeln wir dabei mit dem Geruchs- und dem Tastsinn.
In die weite Intimzone von 15cm bis zu einem halben Meter dürfen zudem Verwandte, Eltern, enge Freunde eindringen. Die Berührung ist sehr wichtig, die Bedeutung optischer Eindrücke nimmt zu. Da das Auge aber in solcher Entfernung nur verzerrt wahrnehmen kann und nur einen Teilbereich erfasst, wird ein Eindringen in diese Zone durch Fremde als unangenehm wahrgenommen - „Geh´mir aus den Augen!“ Die enge persönliche Zone in einem Abstand von einem halben bis zu einem Meter ist ebenfalls nur engen Freunden vorbehalten, ohne beim Partner Unbehagen zu verursachen. In öffentlichen Verkehrsmitteln oder Wartesälen, wo dieser Bereich notgedrungen beschnitten wird, werden
Abwehrsignale wie übereinandergeschlagene Beine oder Handtaschen, Bücher, Mäntel genutzt, um Distanz zu schaffen.
Die weite persönliche Zone (70 cm bis 120 cm) entspricht etwa der Länge eines ausgestreckten Armes. In unserem Kulturbereich ist diese Zone den Gesprächen zwischen oberflächlichen Bekannten, Geschäftsfreunden, Nachbarn oder netten Kollegen vorbehalten. Ein Eindringen in diesen Raum wird meist mit einem seitlichen Ausfallschritt beantworten.
Die enge gesellschaftliche Zone beträgt zwischen 150 und 250 cm. Hier begegnen wir Fremden; Eine Berührung ist nicht mehr möglich. Die weite gesellschaftliche Zone eignet sich für Treffen, Diskussionen und andere unpersönliche, eher von Arbeit bestimmte Begegnungen. Der enge öffentliche Raum kann bis zu 5,50 Meter betragen. In solchem Abstand begegnen wir gerne Fremden, da er uns noch ein Ausweichen ermöglicht, sollte sich der Kontakt als unliebsam herausstellen.
Der weite öffentliche Raum beträgt jede Entfernung über 5,50 Meter. Er wird am häufigsten von Rednern und Lehrern genützt - wohl auch, weil man, sofern man darin trainiert ist, in dieser Entfernung die größte Autorität ausstrahlen kann.
Diese Zonen sind allerdings von den verschiedensten Faktoren abhängig: Nationalität, Überlieferung, Stadt- oder Landbevölkerung, persönliche Veranlagung, Stimmung, ...
(Vgl. Kliebisch, S 63 - 64)
Wenn der Lehrer einem Schüler näher kommt, wird der Schüler positiver auf ein Lob und empfindlicher auf Kritik reagieren. Ein sanfter Verweis aus unmittelbarer Nähe wird oft als ebenso bedrohlich empfunden, wie wenn man von der anderen Seite des Raumes her angebrüllt wird. Räumliche Nähe ist keine eindeutige Botschaft und sagt über die Beziehung zwischen den eng beieinanderstehenden Menschen wenig aus, aber wenn man jemandem nahe kommt, wird dieser unruhig, solange er nicht weiß, was der andere vorhat.
Eine Berührung bedeutet unmittelbare Nähe und ist ein besonders starkes und potentiell auch bedrohliches Signal.
Durch Berührung zwingt man einen Menschen Beachtung zu schenken. Der Lehrer muss mit Berührungen vorsichtig umgehen. Die meisten Schüler empfinden ganz bestimmte Berührungen während ihrer gesamten Schullaufbahn als freundschaftlich und angenehm, so dass der gelegentliche zu hörende Ratschlag, ein Lehrer sollte seine Schüler am besten überhaupt nicht berühren, sicherlich übertrieben ist. Eine Berührung wird als starker Reiz empfunden und ist für die oben erwähnte Unruhe verantwortlich, die wir empfinden, wenn sich der Abstand zwischen uns und anderen verringert.
Die Körperhaltung eines Menschen ist häufig ein Indiz für seine Absichten, vor allem in Verbindung mit der Distanz zwischen ihm und seinen Kommunikationspartnern.
Wenn man sich im Sitzen oder Stehen zu jemanden herüberlehnt, so ist das eine intentionale Bewegung und zeigt die Intention, sich auf die Person zuzubewegen. Eine Berührung ist ein Hinweis auf gesteigerte Intensität der Kommunikation.
Lehnt man sich von jemandem weg, so lässt man die gegenteilige Intention erkennen. Als Dominanzanspruch und auch potentielle Bedrohung wird empfunden, wenn man sich über einen anderen beugt oder sich in anderer Weise aus einer erhöhten Position an ihn wendet. Denn wer einen körperlichen Angriff plant, hat dafür von oben die günstigen Voraussetzungen. Wenn man dagegen von unten auf jemandem aufschaut, dann ist das geradezu das Gegenteil einer Bedrohung.
Sich erheben, Aufrechtstehen ist ein Dominanzsignal, nicht nur, weil der Mensch dadurch größer wird, sondern auch, weil es ihm die Möglichkeit gibt, umherzugehen und den Abstand zu anderen - z.B. den Schülern - nach Belieben zu vergrößern oder zu verringern.
Wer sich dagegen zum Sitzen niederlässt, signalisiert das Gegenteil, also den Verzicht auf Größe und Bewegungsfreiheit, insbesondere wenn man als Lehrer im Gegenzug seinen Schülern erlaubt, aufzustehen und sich umherzubewegen.
Die Art und Weise, wie ein Klassenzimmer eingerichtet und gestaltet wird, ist gewissermaßen ein eingefrorenes Abbild der Ausnutzung des Raumes sowohl durch den Lehrer oder die Lehrerin als auch durch die Schüler.
Wie der zur Verfügung stehende Raum aufgeteilt ist, wie die einzelnen Schüler sitzen und wer in welchem Maße Bewegungsfreiheit genießt, das alles sind Aspekte der Gestaltung eines Klassenzimmers, die Auskunft darüber geben, wie der Unterricht ablaufen soll. Oft steht der Lehrertisch etwas weiter entfernt von den anderen Tischen, eine Annordnung, in der eine gewisse psychologische Distanz zwischen dem Lehrer und Schülern zum Ausdruck kommt. In einem traditionellen Klassenzimmer sind die Schüler in den vorderen Reihen stärker in das
Unterrichtsgeschehen einbezogen als diejenigen, die hinten oder am Rand und damit vergleichsweise weit entfernt vom Lehrerpult sitzen. Freunde sitzen gerne nebeneinander, wenn man es ihnen erlaubt, und wo die aufgelockerte Gestaltung des Unterrichtsraumes es zulässt, dass sie einander ansehen können, sind sie durch den Blickkontakt noch enger miteinander verbunden.
1.2 BLICKKONTAKT
Für die Art und Häufigkeit von Blickkontakten gelten in mancher Hinsicht ganz ähnliche Regeln wie für den Umgang mit Raumausnützung und Abstand.
Ein Schüler, der vom Lehrer zurechtgewiesen wird, wird in den meisten Fällen auf den Boden oder zur Seite blicken, um sich auf diese Weise von der unangenehmen Erfahrung fernzuhalten.
Ein Großteil der Kommunikation im Unterricht macht es erforderlich, dass Lehrer und Schüler sich zumindest gelegentlich ansehen.
Dauert ein Blickkontakt besonders lange, so ist es ein Zeichen für gesteigertes Interesse. Ebenso wie eine Annäherung wird er aber auch als belastend empfunden, da man oft nicht weiß, ob das Interesse freundschaftlicher oder aggressiver Natur ist, zumindestens, solange man keine zusätzlichen Signale empfängt, die bei der Deutung der Blicke weiterhelfen.
1.3 GESICHTSAUSDRUCK UND KOPFHALTUNG
Diese zwei Kategorien betreffen zwar beide den Kopf, doch sind sie weitestgehend voneinander unabhängig und können in vielfältiger Weise kombiniert werden. Dabei ist der GESICHTSAUSDRUCK das wichtigere Signal. Die Haltung des Kopfes hat oft eine ähnliche Wirkung wie die Körperhaltung. Ein emporgerichtetes Kinn (von oben herab) gilt wie eine erhöhte Position als Zeichen eines Dominanzanspruchs. Ein gesenkter Kopf dagegen wirkt wie das Hinknien unbedrohlich. Ein für viele Lehrer charakteristisches Signal ist der zur Seite geneigte Kopf, der einfühlsame Anteilnahme signalisiert.
Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder bereits im Grundschulalter den Gehalt eines nonverbalen Signals vor allem anhand des Gesichtsausdrucks, während andere Aspekte wie Gestik und Körperhaltung nur eine Nebenrolle spielen.
Lächeln und Stirnrunzeln sind im Kontext des Schulunterrichts sicherlich die markantesten Formen des Gesichtsausdruckes. Letzteres kann gelegentlich zur Verwirrung Anlass geben, ist es doch ein Zeichen erhöhter Konzentration als auch Signal des Ärgers und der Bedrohung. Ohne zusätzliche Signale sind sie nicht voneinander zu unterscheiden. Durch entsprechende Bewegungen der Stirn und der Augenbrauen zeigt der Lehrer an, ob das, worüber er spricht, die volle Aufmerksamkeit der Schüler verlangt, ob es schwer zu verstehen ist oder ob es sich um etwas Interessantes und Spannendes handelt.
1.4 TONFALL DER STIMME
Es lassen sich der verkündende und der verweisende Tonfall unterscheiden. Kinder haben für diese Unterschiede in der Intonation der Stimme schon früh ein feines Gespür. Lehrer die ihren Unterricht effektiv gestalten, zeichnen sich durch einen lebhaften Tonfall aus. Eine flache, farblose Intonation gilt hingegen als Zeichen von Unsicherheit. Welchen Tonfall man bei welcher Gelegenheit gebraucht, kann man durchaus steuern.
(Vgl. Neill / Caswell, S 25 - 30)
Ohne den Tonfall wären verschiedene Arten der Kommunikation nicht möglich. Gerade in sprachlich heiklen Situationen, wenn man jemanden professionell kritisieren muss, wird vielfach mehr auf Ton gehört als auf die einzelnen Worte - vor allem aber auf die Übereinstimmung von beiden.
Da es bei jeder Kommunikation eine Sach- und eine Beziehungsebene gibt, wird verbal und nonverbal auf unterschiedlichen Kanälen gesendet und dann überwiegt die Beziehungsebene.
Schließlich können auch von der Lautstärke eines Gesprächs Statusunterschiede abgeleitet werden. Unsichere Menschen sprechen eher leise und erkennbar vorsichtig, und signalisieren damit, dass sie bei einem Irrtum jederzeit zum Rückzug des Gesagten bereit sind. Ranghohe Menschen - nach Position oder sozialer Schicht - sind eher lautstark. Je sicherer jemand ist, desto klarer wird die Aussprache einzelner Worte im allgemeinen sein.
(Vgl. Auszug aus dem Internet über Körpersprache)
1.5 GESTEN UND ANDERE HANDBEWEGUNGEN
Gesten, die immer mit einer gleichzeitigen verbalen Äußerung verbunden sind, haben einen doppelten Zweck. Zum einen begleiten sie das gesprochene Wort, wobei sie es gleichzeitig strukturieren und Interpretationshilfe leisten. Zum anderen zwingen sie die Zuhörer, den Sprecher während seines Vortrages auch anzusehen. Beschränkt sich der Zuhörer nur auf das Gesprochene, wird ihm ein Teil der Botschaft entgehen. Wenn man es nicht übertreibt, so lässt sich auf diese Weise auch die Aufmerksamkeit der Schüler sehr wirkungsvoll steuern. Einige Themen bieten sich auch für Pantomime an. ( Tiere mimen) Gestik wird vor allem zu Untermalung des verbalen Inhaltes benutzt. Hände und Arme werden benutzt um einen Gegenstand die richtige Beschreibung hinzuzufügen.
Verschiedene andere Handbewegungen dienen weniger der Untermalung und Betonung der eigenen Ausführungen als vielmehr dem Ausdruck einer bestimmten Beziehung zwischen Sprecher und Zuhörer. z.B. das Aufzeigen mit der Hand, die erhobene Hand um Ruhe herzustellen Hand und Armzeichen die das Selbstvertrauen eines Menschen zum Ausdruck bringen, sind z.B. verschränkte oder in die Seiten gestemmte Arme als Zeichen eines Dominanzanspruchs oder gar Drohung, während Bewegungen, bei denen man sich an seiner Kleidung herumnestelt oder sich gleichsam putzt und zurechtmacht, Stress, Unsicherheit oder auch Angst ausdrücken.
(Vgl. Neill / Caswell, S 30 - 31)
1.6 KULTURELLE EINFLÜSSE
Je nachdem, wie differenziert, kompliziert oder einfach eine Sprache aufgebaut ist, hat dies konkrete Auswirkungen auf den nonverbalen Anteil. Bei einer stereotypen, wenig differenzierenden Sprache steigt die Bedeutung der Körpersprache. Besonders wird dies bei den - Geheimcodes gleichenden - ausschweifenden Gesten deutlich, die jugendliche Gangs benutzen, um zwischen Stereotypen wie „cool“ und „Alter“ kommunizieren zu können.
Im Gegensatz dazu ist im japanischen Alltag der nonverbale Anteil gering ausgeprägt, da neben der traditionell geforderten Zurückhaltung der stark nuancierte Sprachschatz ein Höchstmaß an Konzentration erfordert.
Es gibt auch nationale Unterschiede. Beispielsweise sitzen amerikanische Männer oft mit übereinandergelegten Beinen, wobei der Unterschenkel eines Beins quer über dem Knie des anderen liegt. Die Sitzhaltung mitteleuropäischer Männer mit geschlossenen Oberschenkeln empfinden Amerikaner eher als ungewohnt.
Hinzu kommen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Erwachsenen und Kindern, Unterschiede, die sich aus Status und Rolle einer Person erklären.
So nehmen z.B. Männer in ihrer Sitzhaltung und ihrer gesamten Gestik mehr Raum ein als Frauen.
Desweiteren hat jeder Kulturkreis eigene Körpersprachregeln entwickelt. Ein deutliches Beispiel dafür ist das (vertauschte) Kopfnicken/-schütteln zur Verneinung / Bejahung in Bulgarien, das Gäste des Landes regelmäßig in Zweifel über den Wahrheitsgehalt verbaler Aussagen der Einwohner geraten lässt.
Verschiedene körpersprachliche Elemente haben sich durch ihre Weiterverbreitung international durchgesetzt. Das beste Beispiel ist das „Victory-Zeichen“ : Dieses Symbol dürfte selbst Angehörigen der Inuit oder Massai bekekannt sein.
(Vgl. Auszug aus dem Internet über Körpersprache)
2. KÖRPERSPRACHE DER KINDER
Wir haben einen Körper und dieser sendet Signale ob wir wollen oder nicht. Und dieses zeigt einen kleinen aber wichtigen Unterschied zwischen Körpersprache und Wortsprache. Es sind beide wichtig - die verbale und die nonverbale Sprache und wir verfügen über beide. Ich kann entscheiden, wann rede ich, wann nicht; gebe ich eine Information oder nicht. Wie aber macht man es in der Körpersprache, keine Informationen zu geben ? (Er macht ein freundliches Gesicht, zieht die Brauen hoch.) Ist das keine Information ? Es gibt keine Sekunde wo unser Körper aufhört Signale zu senden. Das Verwirrende in der Körpersprache ist, dass wir Signale geben, die wir sollen, und Signale, die wir nicht wollen. Und es hängt vom Empfänger ab, wie er diese Informationen aufnimmt und welche er wahrnimmt.
Ebenen der Körpersprache:
Die eine ist die angeborene Körpersprache, eine andere ist die kulturell erworbene.
Von der angeborenen kann man sagen, dass sie eine universelle Sprache ist.
Es gibt eine Grundform der Körpersprache, weil alle Menschen auf diese Signale in der gleichen Form reagieren; auf Signale wie Werbung, Imponiergehabe, Tröstung usw. Ob wir wollen oder nicht, wir werden auf solche Signale reagieren.
Der Körper steht immer in Beziehung zu etwas oder jemandem, daher ist Körpersprache nicht nur das, was ich mache, sondern auch das, was ich nicht mache. Es gibt keine objektive Beziehung zwischen Menschen. Menschen haben subjektive Reaktionen. Objektivität ist ein wichtiger Wert, aber sein Platz ist im Labor, nicht zwischen Menschen.
Objektiv sein in der Klasse, das heißt subjektiv sein zu jedem einzelnen Schüler innerhalb der Klasse. Der Schüler verlangt, genau wie jeder andere Mensch, eine subjektive Stellungnahme. Nicht zu reagieren ist ein Liebesentzug!
Ein Kind möchte Bedürfnisse stillen und Bedrohungen abwenden. Wenn ich ein Bedürfnis haben, ob das nun Hunger oder Durst, Neugier oder sonst eine Art von Bedürfnis ist, ich will es stillen. Etwas, das mein Bedürfnis stillen kann, interessiert mich. Und darauf reagiere ich. Das ist der Grund, warum ich auf meine Umwelt reagiere. Der zweite ist eine Bedrohung. Ich schätze eine Situation ein: Ist es für mich gefährlich oder nicht ? Bedroht etwas oder jemand meine Existenz ? Und worauf reagiere ich.
Das sind zwei Grundformen menschlichen Verhaltens.
Selbstverständlich gibt es Variationen. Wesentlich ist: Wenn man nicht reagiert, so ist es, als würde man jemanden die Nachricht senden: Du bist für mich weder etwas, das meine Bedürfnisse stillen kann, noch bist du für mich bedrohlich.
Im Prinzip bist du ein NICHTS. Es ist das Entwürdigste, das man mitteilen kann. Und wenn wir sagen: „Aber ich habe doch gar nichts gemacht“! so sagt der andere mit Recht: „EBEN“!
In der Schulklasse ist es oft nicht zu vermeiden, dass wir Reaktionen unterlassen. Aber wir reagieren auch oft nicht auf die Bedürfnisse einzelner Schüler. Ein solcher empfindet dann: Man ignoriert mich. Ich existiere für den Lehrer nicht. Nun, dann existiert er für mich auch nicht.
- Das geht sehr schnell.
Es ist also wichtig zu wissen, was ich mit meinem Körper mache und zum Ausdruck bringe und was ich nicht mache oder warum ich nicht reagiere.
5 ARTEN der Reaktion
1.) ATTACKE: Die Bewegungsrichtung nach vorne kann aggressiv sein oder auch nicht. Jedes Vorwärts-Streben nach einem Ziel gehört dazu. Es sind Aktionen, um etwas zu erreichen.
2.) FLUCHTREAKTION: Etwas Unbekanntes taucht auf - Gefahr droht.
Ich bin sehr unsicher, ich renne weg. * Anspannung der Muskulatur Wenn eine Schüler vor dem Lehrer am liebsten davonlaufen würde, verkrampft er sich. „Ich würde gerne wegrennen, tu es jedoch nicht!“
à Körper ist angespannt
3.) SICHVERSTECKEN: Wenn nicht weglaufen, dann verstecke ich mich.
Die Fortsetzung des Sichversteckens auf der geistigen Ebene ist die Verdrängung. Wenn ein Kind sagt: Wo bin ich? Und hält sich dabei die Hände vor das Gesicht, so ist das nicht viel anders, als wenn ein Erwachsener gewisse Sachen verdrängt.
4.) HILFE SUCHEN: Wer kann mir helfen? In der Gruppe bin ich stärker, sie bietet mir Schutz. Vereine Kräfte können mehr leisten.
5.) SICHUNTERORDNEN: Wir ordnen uns jeglicher gesellschaftlicher Spielregeln unter.
Es ist wichtig, dass das Kind erfährt, sein Signal ist angekommen.
Ein neugeborenes Kind zeigt am Anfang keine differenzierte
Unterscheidung zwischen sich und der Außenwelt. Alles ist ein ICH. Irgendwann entdeckt es, dass es ein ICH und ein NICHT-ICH gibt. Es entdeckt seine Abgängigkeit zum NICHT-ICH. Erstmals wirkt auf das Kind etwas ein: Es fühlt Hunger. In dieser Not schickt es erste Signale aus: WÄÄH! Und es entdeckt: Auf dieses Signal kommt eine Reaktion. Es kommt die Mutterbrust - und ist gestillt.
SIGNAL à RAKTION
Später rekonstruieren wir den Zusammenhang genauer: Auf das Signal folgen eine Reihe von Signalen. Schritte sind zu hören, Türen gehen auf und zu, dann kommt die Mutter, es kommt die Brust. Das Kind nimmt in dieser Phase die Zwischensignale auf und erwartet das Ersehnte etwas geduldiger, denn alle diese Zwischensignale werden bemerkt als Reaktion auf sein erstes Signal. So baut sich ein System auf zwischen Kind und seiner Umwelt.
Bekommt das Kind schnell die Reaktion, so baut sich ein gesundes
System zwischen ihm und der Umwelt auf. Dauert es lange, glaubt das Kind, das Signal war falsch. Entweder resigniert es, hört auf, oder es sucht sich ein anderes Signal, als Ersatz, in der Hoffnung, dass dieses vielleicht wirkt.
Ein Kind kommt und hebt seine Arme zum Vater. Der Vater ist beschäftigt. Das Kind hebt nochmals seine Arme - es beginnt schließlich zu schreien. Da hat der Vater plötzlich Zeit und nimmt es hoch. So lernt das Kind sehr schnell - Arme hoch heben nützt nichts, schreien hilft. Der Vater hat es seinem Kind selbst beigebracht.
Wenn ich das Kind lehre, dass ich nur auf sein Weinen reagiere - dann ist rasch der Mensch da, der glaubt, man bemerkt ihn nur, wenn er schreit.
Als Kind hat er schon erfahren: Du musst deine Stimme laut erheben.
Wenn das Weinen nichts mehr nützt suchen sich Kinder einen neuen Weg.
Zum Beispiel, das Kind geht direkt und gefährlich an die chinesische Vase - und plötzlich, wie ein Wunder, steht die ganze Familie da. Das Kind hat bemerkt, dass dieses Signal wirkt. Es ist ihm egal, ob Eltern schreien und schimpfen - entscheidend ist, sie haben auf mich reagiert. Diese Erfahrung nennen wir das „Chinesische Vase-Syndrom“.
Verirrt sich ein Kind in ein falsches Signalverhalten, kann es unter Umständen bis zu einem Schaden oder bis zu Aggressivität führen.
WIE WEISS ICH, DASS ICH LEBE, WIRKLICH LEBE ?
Wenn und solange wir aufeinander wirken, das ist für mich der Beweis, dass ich existiere.
Wie oft sagen wir: Zwick mich. Träume ich oder bin ich wirklich da?
Wenn ich fühle „AUA“, wenn das Zwicken gewirkt hat, weiß ich, dass ich wirklich lebe. Diese Wechselwirkung ist eine von den wichtigsten Erfahrungen, besonders für Kinder.
Kinder wollen wirken. Wenn wir sie nicht wirken lassen, nehmen wir ihnen den Boden unter den Füßen weg.
Dieses Kind ist so aggressiv - es zerstört nur !
Stimmt nicht - es will wirken. Kinder wollen auf ihre Umwelt wirken, egal auf welche Art. Und sie wollen, dass die Umwelt auf sie reagiert.
Diese Wechselbeziehung ist das A und O, das Grundprinzip jeder Körpersprache. Es ist schlimm, wenn das Kind etwas tut und es wirkt nicht. Es ist schlimm, wenn das Kind keine Reaktion der Umwelt erhält.
Kinder haben es gerne, wenn man ihnen direkt, voll das Gesicht zuwendet. Kehrt sich der Lehrer von ihnen weg, so haben die Kinder nicht das Gefühl, er spricht zu ihnen. Dementsprechend zeigt ein Kind, das wegschaut, sich wegwendet: Ich habe genug, ich will nicht mehr, oder: Ich brauche eine Pause.
Kinder, die die Zuwendung des Lehrers wollen, sehen ihn an und ihre Körpersprache weist in seine Richtung. Kinder die keine Zuwendung mehr wollen, beschäftigen sich mit sich selbst. à Körpersprache weg vom Lehrer
DIE KÖRPERSPRACHE WIRD GESTEUERT VON DEN ZWEI HEMISPHÄREN IM GEHIRN.
Linke Gehirnhemisphäre: sachliche Fähigkeiten, Mathematik,... Rechte Gehirnhemisph.: Gefühl, Spontanität,...
Die rechte Gehirnhälfte wirkt auf die linke Körperseite; die linke Gehirnhälfte auf die rechte Körperseite; also eine diagonale Verbindung.
Das Digitalsystem, nach dem sich die westliche Welt richtet, schafft uns die Möglichkeit genauer Information und technischer Präzision. Jedes Signal sagt nur das, was es bedeuten soll. Eins ist immer eins, zwei immer zwei, usw. Ein Sessel ist ein Ding, auf dem man sitzt à digitales Denken.
Das Gefühl ist nicht digital, nicht eindimensional, sondern eine Ganzheit und Gleichzeitigkeit. Es gibt kein halbes Gefühl: Oder kennt jemand einen halben Schmerz?
Ein Gefühl kann verschiedene Intensität haben. Es kann intensiver oder weniger intensiv sein, aber es ist nicht teilbar.
Kinder sind mehr rechtsdominant, das heißt, die rechte Gehirnhälfte ist aktiver und deshalb nehmen sie ihre Umwelt immer als Ganzheit wahr. Das konstruktive Denken entwickelt sich erst später.
Die Körpersprache der Kinder ist weit reduzierter als die der Erwachsenen. Kinder sind motorisch lebhafter, aber Motorik ist keine Körpersprache. Kinder reagieren elementar, sie brauchen keine Kompensationsbewegungen.
Das heißt, wenn eine Kind etwas nicht will, so wir es z.B. von der Suppe einfach weggehen oder sich unter dem Tisch verstecken. Wenn uns etwas nicht gefällt, so ziehen wir den Kopf zurück, beißen uns auf die Lippen und ähnliches. Das alles sind Signale, Bewegungen als Kompensation des Bedürfnisses wegzurennen.
Solche Kompensation braucht das Kind nicht, seine Körpersprache ist auf elementare Formen reduziert.
Am Anfang stehen Kinder nicht mit voller Kraft auf dem Boden. Bis zum Alter von 6 Jahren gehen sie wie auf Luftpolstern. Der Kontakt zum Boden der Realität ist noch nicht ganz da. Sie schweben noch ein bisschen mit ihrer Phantasie in einer anderen Welt. Mit dem Wechsel der Zähne, mit der Herausbildung der festen Zähne, mit denen das Kind beißen kann, zubeissen und zerstückeln, baut sich auch ein fester Stand auf dem Boden auf. Die Kinder können ca. ab dem 6. LJ. konkrete Probleme viel praktischer aufnehmen und angehen.
Der Körper interpretiert das, was wir denken und fühlen, im System der Körpersprache. Jedes Wort, das wir sagen, wird in der Motorik interpretiert.
Die deutsche Sprache hat sehr viel Körperhaftes in der Sprache selbst. Wenn wir hinhören, wie die Sprache formuliert ist, so finden wir im Prinzip die Elemente der Körpersprache. Das Wort „Begriff“ zum Beispiel verweist auf „greifen“, obwohl der Inhalt abstrakt ist.
Geschehen ist Bewegung. Der Gegensatz dazu ist Erstarrtes, erstarrtes Denken, erstarrte Körper. Wo keine Bewegung ist, geschieht nichts. Kinder lieben Bewegung; das regt ihr Interesse an. Sei brauchen viel mehr Bewegung als Erwachsene.
Leute die sich wenig bewegen, z.B. Lehrer, lieben ein starres Konzept. Sie sind unbeweglich in ihrem Denken wie in ihrer körperlichen Haltung. Bringt den Körper in Bewegung, dann bewegt sich auch etwas im Denken.
Das erstarrte Schulsystem ist oft ein Problem für Kinder. Zu lange müssen sie auf einem Platz ausharren. Da wird es plötzlich uninteressant, auch das Lernmaterial. Wenn man es schafft, die Kinder zwischendurch zu entspannen, zu bewegen, und sei es nur für kurze Zeit, so ist das Interesse wieder da, die Kinder kommen mit.
Besonders für Kinder ist es wichtig sie von einem eingefahrenen Geleise herauszuholen. Sie brauchen einen Wechsel, eine neue Aufgabe. Im Moment, in dem Langeweile auftritt, wollen sie weg. Das ist der Grund, warum Kinder sich etwas Neuem zuwenden. Wenn es nichts neues gibt, kommen sie nicht mehr mit, sie wollen woanders hin. Sie haben einen anderen Rhythmus als die Erwachsenen. Dieser verschiedene Rhythmus ist oft ein Problem zwischen Kindern und Erwachsenen.
Ein Beispiel:
Fahren zwei Lastwägen nebeneinander, der eine hat Waren aufgeladen, der andere ist leer. Sie fahren in gleicher Geschwindigkeit und versuchen die Waren von dem einen zum anderen zu bringen. Fahren die zwei Lastwägen in verschiedenen Geschwindigkeiten, ist anzunehmen, dass die Ware den anderen Lastwagen nicht erreichen werden.
Die klugen Lastwagenfahrer versuchen dann, beide Autos in der gleichen Geschwindigkeit nebeneinander fahren zu lassen. Dadurch wird auch ein Maximum von einem zum anderen transportiert. Ähnlich ist es auch im verbal-sprachlichen Verhalten. Wenn der Lehrer sich in einem anderen Rhythmus bewegt als die Kinder, machen sie nicht mit. Wichtig ist die Wechselbeziehung, der gleiche Rhythmus oder, wie man sagt, die gleiche Wellenlänge.
Die Augen sind das stärkste Bewegungsorgan. Ein Kind, das abgewendet vor einem steht, wird sicher auch mit seinen Antworten ausweichen. Wenn die Augen des Kindes sich zur Seite richten, werden auch die Gedanken ausweichen. Im Grunde wird der Körper durch die Augen geführt.
Automatisch richten sich die Augen dorthin, wo es gefährlich sein könnte, oder auch interessant. Normalerweise folgt der Körper den Augen.
Das Kind, das vor dem Lehrer steht, sucht Hilfe von der Seite, aber es wagt nicht, mit den Augen auch den Kopf wegzudrehen, denn die Autoritätsperson erwartet von ihm, dass es ihm, dem Lehrer, voll das Gesicht zuwendet. Es ist also besser, man lässt zu, dass das Kind den Kopf bewegt, sonst verstärkt sich automatisch die Spannung im Nacken derart, dass jede Bereitschaft zur Aufnahme einer Information oder eines Appells ausgeschlossen ist.
Wenn Kinder Probleme haben, so zeigt sich das oft daran, was sie mit ihren Händen machen. Wenn Arm und Hand schlaff am Körper hängen, wie gelähmt: keine Handlungsbereitschaft. So ist das oft bei Kinder, die ein Problem haben: sie sind traurig, sie fühlen sich nicht verstanden, nicht akzeptiert. Bedeutet auch Liebesentzug. - Ein ähnliches Körperverhalten zeigt sich bei einem Schmerzgefühl. Das Seelische wie das Physische erscheinen in ähnlicher Form am Körper.
Berührung ist ein wichtiges Kommunikationselement. Wir berühren Leute, die uns angenehm sind. Schon die körperliche Distanz, die wir zueinander halten, ist kulturbedingt. Die passende Distanz ist in den Kulturen verschieden. Im deutschsprachigen Kulturraum erwartet man, dass man einander direkt gegenüber steht; es besteht die Tendenz, die Konfrontation zu suchen, nicht auszuweichen, die Vorstellung: ein Mann, ein Wort. z.B. Im angelsächsischen Raum stehen die Leute eher Schulter an Schulter nebeneinander, solidarisch zueinander, aber distanziert.
Menschen im Mittelmeerraum kommen sich viel näher.
In unserem Kulturkreis ist die Armlänge die passende Distanz. Bei bestimmten, vertraulichen Infos rücke ich näher. Je nach dem ob diese Distanz gewünscht wird oder nicht drückt es sich im Verhalten aus.
Kinder möchten gerne im vertrauten Kreis sein. Deswegen kommen sie oft nah an den Lehrer heran. Wenn der Lehrer, ohne es bewusst wahrzunehmen, irritiert ist, die Distanz deutlich korrigiert oder sich wegwendet, so meint das Kind: Aha, er akzeptiert mich nicht, liebt mich nicht. Man muss also aufpassen, wenn man Missverständnisse vermeiden will. Dem Kind immer eine Begründung geben, wenn man in Distanz gehen muss. Schlecht ist es, wenn das Kind es nur an der Bewegung spürt, ohne Erklärung.
Berührungen bedeuten selbstverständlich Vertrautheit. Natürlich gibt es Tabuzonen. Und es ist eine Frage der Dauer der Berührungen. Kinder brauchen von Zeit zu Zeit diese flüchtige, leichte Berührung, die zeigt: Du bist mit angenehm, ich akzeptiere dich, du gehörst zu meinem vertrauten Kreis. Nur eine leichte, kurze Berührung ist angenehm für ein Kind. Eine schwere Hand könnte dominant werden für den kleinen Körper.
Es ist auch wichtig bei Kindern auf die gleiche Ebene zu kommen. Jeder Mensch hat es gerne, dass man ihm in die Augen schaut - direkt. Deswegen wollen kleine Kinder auf dem Arm, um den Eltern in die Augen schauen zu können. Wenn man in die Knie geht und so mit dem Kind spricht, begibt man sich auf die gleiche Ebene und vermittelt Vertrautheit.
Es gibt verschiedene und sehr sprechende Kopf-Positionen und sie wirken stark auf den Partner. Die gerade Kopfhaltung konfrontiert die andere Person. Anders die Botschaft der schrägen Kopfhaltung. Ich mache meine Halsseite frei, du könntest zubeißen, meine Hauptschlagader liegt frei, und liegt ungeschützt hier. Dieses Signal bedeutet aber gleichzeitig: Ich vertraue dir. Ich vertraue darauf, dass du mich nicht beisst.
Wenn Kinder Vertrauen zeigen, und mit geneigtem Kopf kommen, dann wollen sie auch Vertrauen und Zuwendung. Eine kleine Korrektur der Kopfhaltung kann die Beziehung wesentlich verbessern, das Leben verändern.
Die Hand, die sich von oben nach unten bewegt, ist immer ein drückende Hand. Halte ich jemanden eine offene Hand hin, so ist es seine Entscheidung, ob er das Angebot nimmt oder nicht. Die Hand, die von oben etwas gibt, ist eine zwingende Hand. Jede Hand, die von oben kommt ist eine dominante Hand, denn der andere reagiert automatisch und nimmt, was in der Hand liegt. Eine offene Hand bedeutet, ich gebe dir was in meiner offenen Hand liegt, aber ich zwinge dich nicht es anzunehmen.
Kinder spüren das genau. Wir müssen genau überlegen, wann wir Dominanz zeigen und wann wir dem Kind die Möglichkeit geben, selbst Stellung zu nehmen. Dominanz macht aggressiv. Man erwartet von uns keine Stellungnahme sondern Unterwerfung. Man lässt uns nicht die Wahl zwischen JA und NEIN, überhaupt keine Wahl. Wir sind mit dem zwingenden Anspruch konfrontiert.
Jede von außen verursachte Unterbrechung einer zielgerichteten Aktion macht uns aggressiv. Sind wir mitten in einer zielgerichteten Handlung und werden von außen unterbrochen, gehindert, so macht uns das aggressiv.
Ein Beispiel: Eine Mutter möchte die Pampers beim Kind zumachen. Das Kind entdeckt ein Spielzeug in seiner Nähe und möchte es greifen. Die Mutter wird aggressiv und schiebt die Hand des Kindes weg. Das Kind wird in seiner zielgerichteten Bewegung unterbrochen und reagiert mit Schreien.
Die inneren Empfindungen werden stimuliert oder blockiert mit der körperlichen Bewegung. (z.B. Mann kann nicht die Augenbrauen hochziehen und aggressiv werden.)
3. NONVERBALE KOMMUNIKATION IM UNTERRICHT
Ein aufmerksamer Beobachter, der nicht einmal pädagogischer oder psychologischer Fachmann sein müsste, könnte schon anhand einer Filmaufzeichnung ohne Ton grob beurteilen, von welcher Art der gezeigte Unterricht ist. Er könnte z.B. Anhaltspunkte dafür finden, ob sich die Kinder streiten, ob sie konzentriert und angestrengt arbeiten - oder ob sie gelangweilt das Ende der Stunde herbeisehnen. Vermutlich wäre auch einzuschätzen, inwieweit der Lehrer die Schüler akzeptiert und ernstnimmt, ob es sich um einen strengen oder milden, fröhlichen oder verbitterten Menschen handelt; wie der Unterricht gesteuert wird, ob interessante oder langweilige Dinge gesagt werden.
Alle Eindrücke könnten ohne Berücksichtigung der verbalen Sprache gewonnen werden. Registriert worden wären ausschließlich körpersprachliche Indizien, wie mimische oder gestische Ausdrucksformen, Körperhaltung und Körperbewegung, Verhalten im Raum oder Arrangements im Klassenzimmer, wie Sitzordnung etc. Die Eindrücke des Beobachters wären lediglich über den visuellen Wahrnehmungskanal erfolgt. Nicht verfügbar wären akustische Merkmale, wie z.B. Geräuschpegel im Klassenzimmer, die Stimmfärbung der Sprechenden, die zusätzliche nonverbale Hinweise erhalten hätten.
Nonverbale Kommunikation spielt im Unterricht eine bedeutende Rolle. In der Tat dürfte es außer Schauspielern, Seelsorgern, Ärzten und Politiker kaum Angehörige eines Berufes geben, für die nonverbale Signale eine derartige Rolle spielen wie für Lehrer aller Schularten.
3.1 UNTERRICHT ALS KOMMUNKIKATIVER PROZESS
Unterricht ist ein spezifischer pädagogischer Handlungszusammenhang, bei dem innerhalb eines vorgegebenen institutionellen und historisch- gesellschaftlichen Rahmens Individuen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, impliziten Theorien und Zielvorstellungen, sozialen, physischen, emotionalen und kognitiven Ausgangslagen zusammenkommen (müssen), um vorgeschriebene oder selbst- entwickelte Ziele zu erreichen. Dies geschieht mittels methodisch strukturierter Kommunikation.
Der Kommunikationsprozess ist dabei nicht nur eine Möglichkeit der Vermittlung von vorgegebenen oder selbst entworfenen Inhalten, sondern bringt selbst soziales und allgemeines Wissen hervor. Er ist also kreativ.
Im Mittelpunkt dieser Sichtweise unterliegt der Unterricht einer Wechselbeziehung zischen verbalen und nonverbalen Prozessen.
Allgemeine Ziele von Unterricht sind Beiträge zur Demokratisierung und Humanisierung von Gesellschaft und Schule sowie schülerbezogen a.) individuelle Selbstverwirklichung, die Entwicklung einer persönlichen und sozialen Identität
b.) Kompetenz zur Partizipation am sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben.
Dabei wird unterstellt, dass Identität auch in unterrichtlicher Kommunikation entsteht und sich verändert, wobei die Beteiligten als aktive Partizipanten die Bedingungen ihrer Sozialisation mitbeeinflussen. Schüler sind nicht nur Objekte erzieherischer Einwirkung, sondern das unterrichtliche Geschehen mitgestaltende Subjekt.
Schulerziehung und Lernen ereignen sich in und durch Kommunikation, und deren Beschaffenheit determiniert weitgehend den Erfolg oder Misserfolg.
3.2 KOMMUNIKATION ALS VORAUSSETZUNG FÜR ERFOLGREICHEN UNTERRICHT
Kommunikationsprozesse stellen ein hochkomplexes Geschehen auf vielen Ebenen, Wegen und Kanälen dar. Wir gewinnen über andere nicht nur durch eine Geste oder ein Wort Auskunft, sondern aus einer Kombination dieser beiden in Verbindung z.B. mit der mimischen und proxemischen (das Verhalten im Raum betreffende) Aussage sowie der Körperhaltung etc.
Darüber, sie diese einzelnen Ausdruckselemente untereinander zusammenhängen, wie sie im Zusammenspiel sich ergänzen, relativieren oder widersprechen, und warum dies so ist, gibt es noch keine klaren Erkenntnisse im einzelnen.
Da die körperliche, geistige und emotionale Entwicklung des menschen abgängig von Kommunikation ist, muss Kommunikationshygiene besonders dann beachtet werden, wenn Kommunikationspartner im Stadium der Entwicklung, also der Unsicherheit und Identitätssuche sind. Das Wissen um die Problematik von Kommunikationsprozessen ist deshalb gerade in schulischer Erziehung wichtig. Entscheidend für den Erfolg des Unterrichts scheinen vor allem Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern - und Schülern untereinander - zu sein.
Gefühle zwischen den Interagierenden sind für Lernzuwachs,
Haltungsbildung und Motivation im Unterricht außerordentlich bedeutsam. Andererseits ist uns besonders aus der pragmatischen Kommunikationstheorie bekannt, dass Beziehungen vor allem analog (d.h. grob gesagt: nonverbal) übermittelt werden (vgl. Watzlawick, Beavin, Jackson 1974,ähnlich bereits Darwin 1872)
KOMMUNIKATIONSHYGIENE hat störungs- und widerspruchsfreie, ökonomische und verständliche Kommunikation zum Ziel. Folgende Aspekte sind zu beachten:
Zunächst ist die Ebene instrumenteller Voraussetzungen zu nennen, die drei Bereiche umfasst
a.) technische Bedingungen (nonverbale Aspekte im weiteren Sinne) wie äußere Situation, Abschirmung vor störenden Außenwirkungen, Wahrnehmbarkeit, Sitzordnung etc,;
b.) verbalsprachliche Voraussetzungen (Beherrschen der Sprache, Artikulation, Verständlichkeit - auch in der schriftlichen Darstellung etc.)
c.) nonverbale Voraussetzung (im engeren Sinne) wie Konvergenz zur Verbalsprache, Deutlichkeit, Lautstärke etc.)
Wenn Lehrer Schüler nicht wahrnehmen, Schüler den Lehrer nicht verstehen, seine Ironie nicht begreifen oder die Handschrift an der Tafel nicht entziffern können, seine Sätze missverstehen liegen Verletzungen der Kommunikationshygiene vor. Wie aus vielen Untersuchungen hervorgeht, verstoßen Lehrer häufig schriftlich und mündlich gegen Grundsätze der Kommunikationshygiene.
KOMMUNIKATIONSHYGIENE bedeutet aber nicht nur das Bemühen
um Verständlichkeit und Klarheit, sondern auch um die Berücksichtigung bestimmter Kommunikationsspezifika.
a.) Unterricht muss adressatenspezifisch sein: Entwicklungsstand, Reife, persönliche Eigenarten und Befindlichkeiten der Adressaten müssen hinreichend Beachtung finden.
b.)Situationsspezifisch: Die augenblickliche Situation, in der
kommuniziert wird, ist zu beachten. (Der Lehrer lacht nicht mit, wenn ein komisches Ereignis in der Klasse eintritt; er lächelt aber schadenfroh, wenn er eine schlecht ausgefallene Schulaufgabe zurückgibt;)
c.) Institutionenspezifisch: Wenn zwischen der ablaufenden Kommunikation und den vorgegebenen institutionellen
Bedingungen kein Gegensatz besteht.(So würde institutionenunspezifische Kommunkikation stattfinden, wenn in einer Kirche wie im Kabarett geredet würde, usw.)
d.) Inhalts- bzw. sachspezifisch: Wenn vermittelte Inhalte und die Modalität der Vermittlung im Einklang sind. (Wenn ein L. in einer Primarklasse wie eine Gebrauchsanweisung für Staubsauger vorliest, stimmen z.B. Paralinguistik und Inhalt nicht überein).
Kommunikation zielt auf eindeutige, widerspruchs- und störungsfreie Kommunikation. Die Kommunikationspartner müssen stets bereit sein, über ihre Kommunikation zu kommunizieren und dabei zu versuchen, Unverstandenes, Missverstandenes, Störendes zu thematisieren, um Klarheit herbeizuführen.
Interaktionspartner müssen nicht nur in der Lage sein, sich selbst möglichst eindeutig, klar und verständlich darzustellen, sondern auch kommunikative Signale der mit ihnen Ingeragierenden zu beachten und richtig zu deuten. Auch Galloway (1984) stellt fest, dass Lehrer und Schüler unter den schmerzlichen Folgen einer verfehlten Kommunikation zu leiden haben, wenn Mitteilungsintentionen durch An- oder Abwesenheit bestimmter anderer Botschaften sabotiert werden.
Freilich kann die Beachtung der Kommunikationshygiene alleine keine guten Lehrer oder Schüler garantieren, aber sie kann helfen und ist sogar eine Voraussetzung dafür, dass gutwillige Lehrer und Schüler Fehler, Missverständnisse und Falscheinschätzungen vermeiden, um so in klarer, ökonomischer und deshalb angenehmer und fruchtbarer Art zu kommunizieren.
Sicher ist allerdings, dass durch Nichtbeachtung von kommunikationshygienischen Überlegungen Störungen, Konflikte, ja pathalogische Erscheinungen im Unterricht zu erwarten sind.
3.3 GRUNDFUNKTIONEN UNTERRICHTLICHER KOMMUNKIKATION
Es können grob drei Bereiche unterschieden werden:
1. Die Übermittlung vorwiegend inhaltlicher Aspekte
2. die Übermittlung vorwiegend prozessualer Aspekte
3. die Übermittlung von Beziehungsbotschaften.
Durch Beispiele sollen die drei Kategorien verdeutlicht werden.
Sprechhandlungen wie „Washington ist die Hauptstadt der USA“, oder „Man kann nicht nicht kommunizieren“ sind Bsp. für die erste Kategorie (Übermittlung von Inhalten). In diesem Bereich geht es vor allen Dingen darum, Lehr- oder Lerninhalte mitzuteilen oder direkt auf derartige Inhalte hinzuweisen.
Sprechhandlungen wie „Bitte, sprechen Sie“, „Seid bitte ruhig“, „Können Sie bitte einmal her zu mir kommen“ sind kommunikative Handlungen, in denen es vor allen Dingen um die Regulierung von Interaktionsprozessen bzw. organisatorische Maßnahmen geht, d.h. es sind nicht Unterrichtsinhalte das Ziel der aktuellen Äußerung, sondern modale Hinweise, die unabhängig von bestimmten Unterrichtsstoffen erfolgen können.
Aussagen wie „Heute fühle ich mich wohl“, „Ich habe Angst vor Ihnen“, „Ich bin wütend auf Euch“ würden dem dritten Bereich zugehören. Hier geht es weder um Lehrstoffe noch um Aspekte der Regulierung der Interaktion, sondern um Einschätzung von Personen, Äußerungen zu Stimmungen, Gefühlen - insbesondere im Hinblick auf die Interaktionspartner - sowie um Selbstdarstellung.
Abb. 1 Übermittlung inhaltlicher Aspekte
Abb. 2 Übermittlung von Beziehungsbotschaften (Ärger)
Abb. 3
Zu verweisen ist auf den Zusammenhang der einzelnen Grundfunktionen: Inhalts-, Regulierungs-, und Beziehungsübermittlungen hängen häufig eng zusammen. So kann durch bestimmte Auswahl von Inhalten die Beziehungsebene positiv beeinflusst werden, wie auch durch gekonnte Regulierungsmaßnahmen der Unterricht flüssiger wird, wobei dann Inhalte leichter rezipiert werden. Durch ungeschickte Regulierungsmaßnahmen können wiederum die Beziehungen beeinträchtigt werden. Es ist festzuhalten, dass zwischen den drei Grundfunktionen enge Zusammenhänge und permanente Wechselwirkungen bestehen.
Inhalte werden vorwiegend verbal übermittelt, und zwar um so mehr, je abstrakter sie sind. Regulierungsaspekte des Unterrichts können weitgehend nonverbal erfolgen und zwar um so mehr, je stärker sie formalisiert sind. Die Beziehungsbotschaften im Unterricht werden vorwiegend nonverbal ausgetauscht. Je bewusster ein Interaktionspartner seine Beziehung dokumentiert, desto häufiger wird er sich neben nonverbaler auch verbaler Signale bedienen. Je unbewusster sich Beziehungsübermittlungen abspielen, desto ausschließlicher handelt es sich um nonverbale Signale.
3.4 DIE KOMPLEXITÄTSPROBLEMATIK UNTERRICHTLICHER KOMMUNIKATION
Lehranfänger haben vor allen Dingen das Problem, im Unterricht gleichzeitig auf allen drei Funktionsebenen unterrichtlicher Kommunikation stimmig und bruchlos zu kommunizieren. Diese Kommunikationsleistung besteht aber nicht nur im Planen und Senden auf drei unterschiedlichen Ebenen, sondern zusätzlich in der permanenten Orientierung an den Interaktionspartner. So muss der Lehrer flüssig und logisch zusammenhängende Inhalte vermitteln, dazu die notwendigen Regulierungsaspekte berücksichtigen, um das Geschehen geordnet unter Einbeziehung möglichst aller Schüler zu gestalten, und gleichzeitig auf den Ausdruck seiner - vor allem nonverbalen - Beziehungsmanifestationen achten. Um jedoch den Unterrichtsprozess interessant und unter Einbeziehung der Reaktionen, Bedürfnisse, des Kenntnisstandes, der augenblicklichen psychischen Leistungsfähigkeit der Interaktionspartner durchführen zu können, ist die gleichzeitige permanente Orientierung an den Schüler notwendig. Der Lehrer muss sich vergewissern, ob die Schüler sich am Unterricht beteiligen, ob sie müde werden, ob sie bestimmte Inhalte verstanden haben, ob sie sich langweilen usw. Dies ist fast nur möglich durch die permanente Interpretation ihrer nonverbalen Verhaltensweisen.
Die Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbreite kommunikativer Signale spielt im Unterricht eine große Rolle, weil Lehrer abhängig sind von der richtigen Interpretation des Schülerverhaltens, um flexibel, ökonomisch und verständnisvoll zu reagieren. Auch Schüler sind auf die treffsichere Identifizierung kommunikativer Signale des Lehrers angewiesen. Der Erfolg von Unterricht wird sicherlich auch davon bestimmt, wie groß die kommunikative Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbreite bei Lehrern und Schülern ist. Dies gilt für die Inhaltsvermittlung, besonders aber für die Gestaltung des Beziehungsverhältnisses, von dem der erzieherische Erfolg des Lehrers vor allen Dingen abhängt.
(Vgl. Rosenbusch, S 49 - 59)
4. WIE SCHÜLER DIE KÖRPERSPRACHE DES LEHRERS LESEN
Im deutschen Sprachraum existieren kaum allgemeine Untersuchungen, die sich mit nonverbaler Kommunikation im Unterricht befassen. Ziel der Untersuchung ist, herauszufinden, ob bereits Grundschüler die Fähigkeit zur Entschlüsselung nonverbaler Lehrerverhalten aufweisen. Es soll festgestellt werden, inwieweit es Grundschülern gelingt, aus Gestik und Mimik von Lehrern zu erschließen, wie diese Schüleräußerungen inhaltlich einschätzen und bewerten. Darüber hinaus soll ein Blick auf die Haltbarkeit folgender Hypothesen geworfen werden:
1.) Die Interpretationsfähigkeit ist vom Alter der Schüler abhängig. In Anlehnung an vorliegenden Forschungsergebnisse wird angenommen, dass sich Kinder die Fähigkeit zur Dekodierung von Körpersprache im Laufe ihrer Sozialisation erwerben, dass somit ältere Schüler nonverbales Lehrerverhalten besser entschlüsseln können als jüngere.
2.) Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede in der Dekodierungsfähigkeit. Anzunehmen ist, dass Mädchen durchschnittlich die Körpersprache von Lehrern besser als die Jungen verstehen. Ergebnisse aus allgemeinen Untersuchungen von Hall, Rosenthal u.a. ergeben, dass Versuchspersonen weiblichen Geschlechts nonverbale Signale besser dekodieren können als gleichaltrige männlichen Geschlechts.
3.) Die Schulleistung wird als weitere Determinante der Dekodierungsfähigkeit von nonverbalem Lehrerverhalten angenommen. Zu vermuten ist, dass leistungsstarke Schüler eher in der Lage sind die nonverbalen Signale der Lehrer zu identifizieren als die mittleren und schwächeren Schüler. Mit dem Ansteigen der Schulleistung erhöht sich auch eine Fähigkeit der richtigen Erkennung nonverbaler Signale des Lehrers.
4.) Es wird angenommen, dass Grundschüler das nonverbale Verhalten ihnen bekannter Lehrer zutreffender und sicherer entschlüsseln können als das ihnen unbekannter Lehrpersonen. Manches Lehrerverhalten dürfte individualspezifisch sein. Unter Umständen spielen sich in den Klassengemeinschaften eigene nonverbale Interaktionsrituale ein, die den Eingeweihten besser als Außenstehenden verständlich sein dürften.
Videoaufzeichnungen von Lehrern während des normalen Unterrichtes bildeten die Grundlage für die Gewinnung der Ergebnisse.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass bereits neunjährige Grundschüler in der Lage sind nonverbale gestische und mimische Mitteilungen von Lehrern richtig zu interpretieren. Mit steigendem Alter nimmt die Fähigkeit zu und bei weiblichen Schülern entwickelt sie sich besser als bei männlichen Schülern.
Leistungsstärkere Schüler identifizieren nonverbale Lehrerbewertungshandlungen besser als leistungsschwache oder mittlere Schüler.
Die Notwendigkeit der Beachtung nonverbaler Kommunikation im Unterricht kann nicht bestritten werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist nonverbale Kommunikation laut diesem Text?
Nonverbale Kommunikation, oder Körpersprache, ist eine Komponente zwischenmenschlichen Verhaltens, die menschliche Beziehungen ohne Sprache, bewusst und unbewusst, aufrechterhält und steuert. Es geht um das Zusammenwirken vieler Einzelheiten, nicht nur um wenige Grundregeln.
Welche Zonen der Raumnutzung unterscheidet Edward Hall?
Edward Hall unterscheidet folgende Zonen: enge Intimzone (15cm oder weniger), weite Intimzone (15cm bis 0.5m), enge persönliche Zone (0.5m bis 1m), weite persönliche Zone (70cm bis 120cm), enge gesellschaftliche Zone (150cm bis 250cm), weite gesellschaftliche Zone, enge öffentliche Zone (bis zu 5.50m) und weite öffentliche Zone (über 5.50m).
Wie beeinflusst der Blickkontakt die Kommunikation im Unterricht?
Die Art und Häufigkeit von Blickkontakten ähneln in mancher Hinsicht dem Umgang mit Raumausnutzung und Abstand. Langer Blickkontakt signalisiert gesteigertes Interesse, kann aber auch als belastend empfunden werden. Lehrer und Schüler sollten zumindest gelegentlich Blickkontakt halten.
Welche Rolle spielt der Gesichtsausdruck im Unterricht?
Der Gesichtsausdruck ist ein wichtiges nonverbales Signal. Lächeln und Stirnrunzeln sind markante Formen, wobei Stirnrunzeln sowohl Konzentration als auch Ärger signalisieren können. Kinder interpretieren nonverbale Signale vor allem anhand des Gesichtsausdrucks.
Wie beeinflusst der Tonfall der Stimme die Kommunikation?
Es lassen sich der verkündende und der verweisende Tonfall unterscheiden. Ein lebhafter Tonfall kennzeichnet effektiven Unterricht, während eine flache Intonation Unsicherheit signalisiert. Der Tonfall beeinflusst die Beziehungsebene der Kommunikation stark.
Welche Bedeutung haben Gesten im Unterricht?
Gesten begleiten und strukturieren das gesprochene Wort, zwingen die Zuhörer, den Sprecher anzusehen, und helfen bei der Interpretation des Gesagten. Sie können auch Beziehungen zwischen Sprecher und Zuhörer ausdrücken.
Wie beeinflussen kulturelle Einflüsse die Körpersprache?
Je nach Komplexität einer Sprache hat dies Auswirkungen auf den nonverbalen Anteil. Es gibt nationale Unterschiede in der Körpersprache. Jeder Kulturkreis hat eigene Regeln, und einige körpersprachliche Elemente haben sich international durchgesetzt.
Was sind die Ebenen der Körpersprache bei Kindern?
Es gibt eine angeborene und eine kulturell erworbene Ebene der Körpersprache. Die angeborene ist eine universelle Sprache. Der Körper steht immer in Beziehung zu etwas oder jemandem, daher ist Körpersprache nicht nur das, was ich mache, sondern auch das, was ich nicht mache.
Welche Reaktionsformen zeigt ein Kind?
Ein Kind zeigt 5 Arten der Reaktion: Attacke, Fluchtreaktion, Sichverstecken, Hilfe suchen, Sichunterordnen.
Was sind die allgemeinen Ziele von Unterricht?
Allgemeine Ziele von Unterricht sind Beiträge zur Demokratisierung und Humanisierung von Gesellschaft und Schule sowie schülerbezogen a.) individuelle Selbstverwirklichung, die Entwicklung einer persönlichen und sozialen Identität b.) Kompetenz zur Partizipation am sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben.
Was bedeutet Kommunikationshygiene?
KOMMUNIKATIONSHYGIENE hat störungs- und widerspruchsfreie, ökonomische und verständliche Kommunikation zum Ziel.
Welche Grundfunktionen hat unterrichtliche Kommunikation?
Es können grob drei Bereiche unterschieden werden: 1. Die Übermittlung vorwiegend inhaltlicher Aspekte 2. die Übermittlung vorwiegend prozessualer Aspekte 3. die Übermittlung von Beziehungsbotschaften.
Welche Hypothesen gibt es darüber, wie Schüler die Körpersprache des Lehrers lesen?
1.) Die Interpretationsfähigkeit ist vom Alter der Schüler abhängig. 2.) Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede in der Dekodierungsfähigkeit. 3.) Die Schulleistung wird als weitere Determinante der Dekodierungsfähigkeit von nonverbalem Lehrerverhalten angenommen. 4.) Es wird angenommen, dass Grundschüler das nonverbale Verhalten ihnen bekannter Lehrer zutreffender und sicherer entschlüsseln können als das ihnen unbekannter Lehrpersonen.
- Quote paper
- M. Willie Wildgrube (Author), 1997, Körpersprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95945