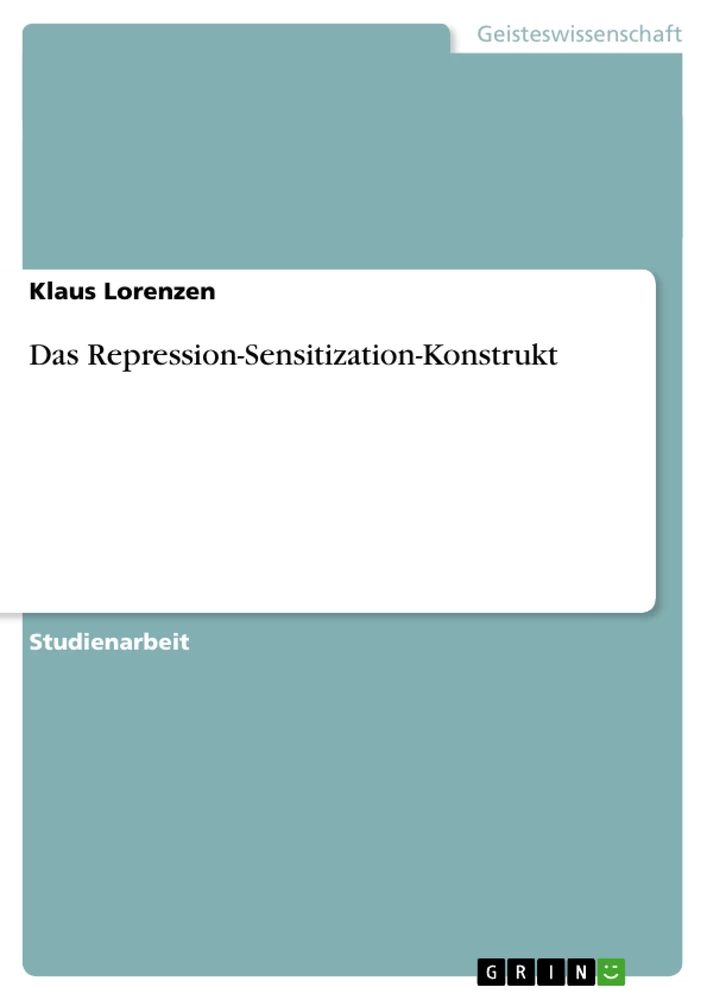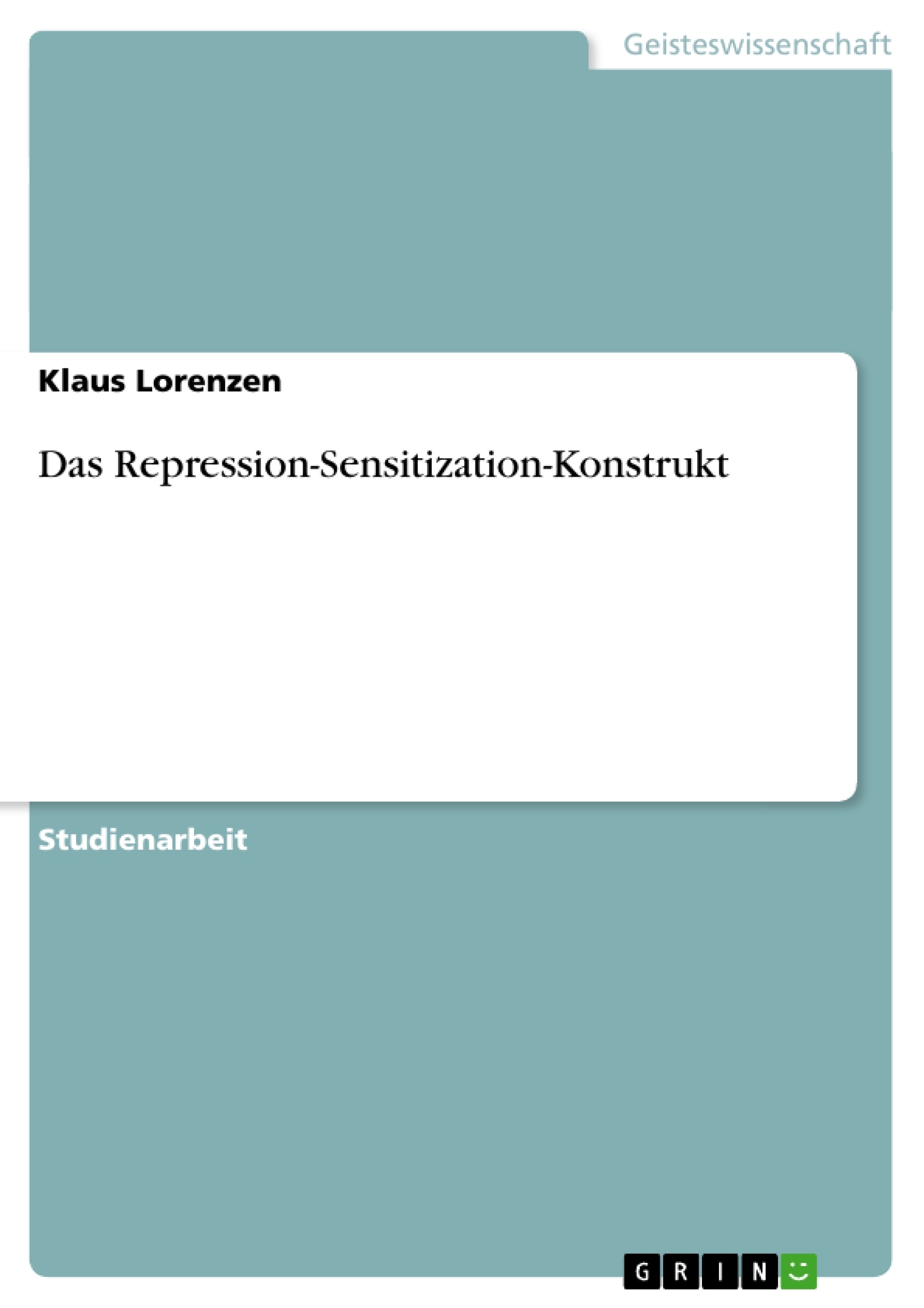Was verbirgt sich hinter unseren Reaktionen auf Angst? Dieses Buch taucht tief in das vielschichtige Repression-Sensitization-Konstrukt ein, einem psychologischen Modell, das versucht, unterschiedliche Bewältigungsstrategien im Umgang mit Angst zu erklären. Seit den 1960er Jahren hat dieses Konzept zahlreiche Forschungsarbeiten in verschiedenen Bereichen der Psychologie inspiriert, doch eine umfassende Validierung steht noch aus. Die vorliegende Analyse bietet einen umfassenden Überblick über die Ursprünge, Anwendungen und Herausforderungen des Repression-Sensitization-Konstrukts, wobei exemplarisch Studien aus verschiedenen psychologischen Disziplinen beleuchtet werden. Von den frühen Experimenten zur Wahrnehmungsabwehr bis hin zu modernen Ansätzen der Angstbewältigung werden die theoretischen Grundlagen und die vielfältigen Messmethoden dieses Konstrukts untersucht. Dabei werden sowohl traditionelle Angstskalen als auch spezifische Repression-Sensitization-Skalen berücksichtigt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den beobachteten Unterschieden zwischen Repressern und Sensitizern in Bezug auf physiologische Reagibilität, Reaktionen auf sexuelle Reize, Aufmerksamkeit gegenüber eigenen Krankheiten, Lern- und Gedächtnisprozesse sowie Attributionsstile. Das Buch geht auch auf die Rolle von Erziehungsstilen bei der Entwicklung von Angstbewältigungsstrategien ein und präsentiert ein Zweiprozeß-Modell elterlicher Erziehungswirkung. Kritische Auseinandersetzung findet mit den methodologischen Problemen der Validierung statt, wie z.B. die Verwendung unterschiedlicher Messverfahren, die Zusammensetzung der Stichproben und die experimentelle Auslösung von Angst. Trotz der bestehenden Kritik leistet das Repression-Sensitization-Konstrukt einen wertvollen Beitrag zum Verständnis unterschiedlicher Coping-Strategien und dient als Ausgangspunkt für weitere Forschungsansätze im Bereich der Angstbewältigung. Dieses Buch richtet sich an Studierende, Forschende und Praktiker der Psychologie, die ein fundiertes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Angst, Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien erlangen möchten. Es bietet eine kritische Analyse des Repression-Sensitization-Konstrukts und regt zur Weiterentwicklung dieses wichtigen Forschungsfeldes an. Tauchen Sie ein in die Welt der Angstbewältigung und entdecken Sie die vielfältigen Facetten menschlichen Verhaltens in bedrohlichen Situationen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Entstehung des Repression-Sensitization-Konstrukts
3. Die Messung des Repression-Sensitization-Konstrukts
4. Befunde
5. Probleme der Validierung des Repression-Sensitization-Konstrukts
6. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Mit dem Repression-Sensitization-Konstrukts wird der Versuch unternommen, unterschiedliche Coping-Strategien in Abhängigkeit von Ausprägungsgraden der Angst zu erklären und mögliche Prädiktoren für Verhalten in angstrelevanten Situationen zu diskriminieren.
Zu diesem Konstrukt hat es seit den sechziger Jahren bis heute eine Fülle von Untersuchungen in nahezu allen Teildisziplinen der Psychologie gegeben. Der Versuch einer Validierung ist bisher nicht zufriedenstellend gelungen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über die Entstehung, Verwendung und Problematik des Repression-Sensitization-Konstrukts zu liefern. Aus der Vielzahl der Untersuchungen werden einige, aus verschiedenen Bereichen der Psychologie exemplarisch vorgestellt.
2. Entstehung des Repression-Sensitization-Konstrukts
Aus den frühen Experimenten zur Wahrnehmung (Bruner und Postman, 1947) stammen die ersten Ansätze zur empirischen Klassifikation von Angstabwehrmechanismen zu einem zentralen Konzept. Bruner und Postman stellten als Ergebnis eines Experiments, in dem bedrohliche Reize im Tachistoskop dargeboten wurden, fest, daß sich zwei Gruppen von Personen in ihrer Reaktionsweise unterscheiden lassen. Die einen benötigten eine besonders kurze Darbietungszeit, um einen bedrohlichen Reiz zu identifizieren, die anderen eine besonders lange Zeit der Darbietung.
Die Hypothese von Bruner und Postman, die das Konzept des "preceptul defence" stützen sollte, konnte hier nicht bestätigt werden. Danach sollten alle Versuchspersonen mit einer Wahrnehmungsabwehr auf bedrohliche Reize (Tabuwörter, angstassoziierte Wörter) reagieren. Es zeigte sich aber, daß sich eine Gruppe der Versuchspersonen im Sinne einer "perceptual vigilance" verhielt, ein Phänomen, das bis dahin nur im Zusammenhang mit bedürfnisrelevanten Reizen beobachtet werden konnte.
Es wird daher angenommen, daß Menschen sich danach unterscheiden, ob sie eine kritische Situation dadurch meistern, daß sie diese möglichst wenig zur Kenntnis nehmen, oder dadurch, daß sie ihr gerade besonders viel Aufmerksamkeit schenken (vgl. Krohne, 1975).
Infolge dieser und ähnlicher Befunde entstand ein bipolares, eindimensionales Persönlichkeitskonzept der Angstabwehr.
An jedem Pol dieses Kontinuums sollen Personen lokalisiert sein, die eine extreme Form der Angstabwehr praktizieren, im mittleren Bereich dieser Dimension Personen, deren Angstverarbeitung angemessen erscheint (zur Problematik der Aufteilung der Extremgruppen s.u.).
Aufgrund der Annahmen, die über die intervenierenden Mechanismen, die zu solchen gegenläufigen Verarbeitungsstrategien führen, gemacht wurden, lag der Vergleich zu den Abwehrmechanismen der Psychoanalyse nahe. Diese Abwehrmechanismen lassen sich nach Anna Freud (1946) in Gruppen von einander ähnlichen Abwehrstrukturen zusammenfassen. Tucker (1970) und Krohne (1974) subsumierten unter die Bezeichnung sensitive bzw. repressive Abwehrstruktur folgende Freudschen Abwehrmechanismen:
Repression: Sensitization:
- Verdrängung - Isolierung
- Verleugnung - Intellektualisierung
- Reaktionsbildung - Kompensation
- Verschiebung - Depression (Selbstaggression)
- Sublimierung - Projektion
- Identifikation (Reaktionen im - Phantasien, Tagträume
Sinne der sozialen Erwünschtheit - Zwangsneurotische Reaktionen
- Rationalisierung
- Psychosomatische Störung
Ferner wurde versucht, das Repression-Sensitization-Konstrukt als kognitionspsychologisch orientierten Ansatz zu interpretieren (vgl. Krohne 1982). Den theoretischen Rahmen hierzu lieferte das Angstmodell von Lazarus (Lazarus & Averill 1972). Danach handelt es sich bei der Angstabwehr um einen Vorgang bei der Bewertung bestimmter Situationen. Diese Einschätzung soll nach Lazarus (1972) mehrdeutige Elemente enthalten. Es entsteht nur dann Angst, wenn keine entsprechenden Interpretationsschemata für entsprechende Umweltvorgänge vorhanden sind und somit nicht adäquat auf die Situation reagiert werden kann. Von fehlenden Interpretationsschemata wird dann gesprochen, wenn ein Individuum keine Möglichkeit hat eine Bedrohung zu beseitigen. Nur dann werden innerpsychische Prozesse in Gang gesetzt, die eine Veränderung der Aufmerksamkeit zur Folge haben und zur Neubewertung der Situation führen.
Bei der repressiven Angstabwehr werden besonders die wenig bedrohlichen Merkmale einer Neubewertung unterzogen, bei der sensitiven mehr die stark bedrohlichen, wobei beide Strategien als defensiv und inadequat bezeichnet werden können.
3. Die Messung des Repression-Sensitization-Konstrukts
Generell lassen sich zwei Richtungen der Differenzierung von Personen mit sensitiver bzw. repressiver Form der Angstabwehr unterscheiden. Einerseits werden übliche Skalen zur Erfassung von Ängstlichkeit verwendet, etwa die Manifest-Anxiety-Scale von Taylor (1953), im deutschsprachigen Raum deren Übertragung von Spreen (1961), die Saarbrücker Angstliste und das State -Trait Angstinventar (STAI).
Andererseits werden Repression-Sensitization-Skalen verwendet. Ullmann (1958) stellte erstmalig eine solche Skala aus Items des MMPI (Hathaway & Mc Kinley 1951, Spreen, 1963) zusammen, die zwar eine Retestreliabilität von .96 aufweisen konnte, aber vorwiegend klinisch auffällige Personen unterschied. Altrocchi, Parson und Dickoff (1960) entwickelten eine Skala aus Items einiger Unterskalen des MMPI, mit der es möglich sein sollte, auch klinisch unauffällige Personen valide erfassen zu können. Diese Skala wies allerdings einige psychometrische Mängel auf (einige Items kommen in zwei Unterskalen vor, die entgegengesetzte Verhaltensweisen messen). Byrne legte 1961 eine überarbeitete Version der Skala von Altrocchi vor, die er aufgrund einer erneuten Itemanalyse 1963 noch einmal revidierte. 1974 entwickelte Krohne die deutsche Version der Byrne'schen Repression-Sensitization-Skala (Byrne, 1963), wobei er die Itemübersetzungen des MMPI Saarbrücken (Spreen 1963) zugrundelegte. Die Skala von Krohne enthält 106 der 127 Items aus der englischsprachigen Version und behandelt 16 Themengruppen, die in Tabelle 1 wiedergegeben sind. Sie weist eine Retest-Reliabilität von rtt = .83 und eine interne Konsistenz von rtt=.94 auf (vgl. Amelang & Bartussek, 1981).
Tab. 1: Die Themengruppen der 106 Items in der deutschen Fassung (aus Amelang & Bartussek, 1981)
Schüchternheit Zugeben von Fehlern
Mangelndes Selbstvertrauen Abhängigkeit
Körperliche Symptome Depression
Sorgen um den Verstand Negatives Selbstbild Müdigkeit Angst und Sorge
Stimmungslabilität Mißtrauen
Ruhelosigkeit Bizarres zwanghaftes Denken und Soziale Sensibilität Handeln
Krohne (1974) stellte eine Liste von beobachteten Unterschieden zwischen Repressern und Sensitizern auf, die seiner Meinung nach zur Validierung des Repression-Sensitization-Konstrukts geeignet sind. Tabelle 2 gibt diese Differenzen wieder.
Unterschiede zwischen Repressern und Sensitizern in verschiedenen Tests und Variablen (aus Amelang & Bartussek, 1981, S. 319)
Sensitizer zeigen höhere Werte in folgenden Variablen:
Subjektive Ungewißheit bei komplexen Entscheidungen Differenziertheit von Fremdbeurteilungen
Differenziertheit der Selbstbeurteilung Ängstlichkeitswerte
Emotionale Labilität
Leistungsminderung durch Angst Zugeben von Fehlern
Dominanz
Schilderung der eigenen Person als mißmutig, selbstunsicher, reizbar, gehemmt Selbstkritik
Represser zeigen höhere Werte in folgenden Variablen:
Positive Valenz der Selbstbeurteilung
Beurteilungskonformität mit einer Bezugsgruppe
Tendenz zum Reagieren im Sinne der sozialen Erwünschtheit Ableugnen eigener Schwächen
Schilderung der eigenen Person als kontaktfreudig, gut gelaunt, ruhig, selbstbewußt, aktiv und frei von körperlichen Beschwerden
Leistungsförderung durch Angst
In neueren Untersuchungen werden häufig verkürzte Fassungen der Skalen von Byrne und Krohne wie die von Handal (1973) und Epstein & Fenz (1967) verwendet (vgl. Cook, 1985; Thorton, 1992). Debono & Snyder (1992) klassifizierten Represser und Sensitizer in einer Studie zur Erfassung von Unterschieden bezüglich Persuasion mit Hilfe von 43 zufällig ausgewählten Items aus der Skala von Byrne (1963).
Untersuchungen zu physiologischen Erregungsprozessen ergaben, daß Represser gegen den Erwartungen mehr physiologische Reagibilität zeigen als Sensitizer (Hare, 1966), obwohl ihre subjektiv empfundene Angst geringer ist (Scarpetti, 1973).
Aufgrund dieser Befundlage und infolge der Kritik, daß Repression-Sensitization-Konstrukt könne erschöpfend mit den Konstrukten zur Ängstlichkeit und zum Neurotizismus erklärt werden (vgl. Amelang & Bartussek, 1981), haben Weinberger et. al. (1979) und Krohne & Rogner (1985) für den deutschsprachigen Raum versucht, Repression-Sensitization als zweidimensionales Konstrukt zu differenzieren.
In der einfachsten Fassung wird die eine Dimension durch die Trait-Angst und die andere durch die Defensivität im Sinne der Sozialen Erwünschtheit konstituiert (Krohne & Rogner 1985). Die Messung der Dimensionen erfolgt über der State-Trait-Angstinventar STAI (Laux et.al., 1981) und dem SDS- Fragebogen nach Crowne & Marlowe (dt. Lück & Timaeus, 1968). Personen mit niedriger Trait-Angst und niedrigen Werten in der Defensivität werden als Nicht-Defensive bezeichnet. Represser dagegen weisen niedrige Ängstlichkeitswerte bei hohen Verleugnungswerten auf. Die Konfiguration von hoher Ängstlichkeit und niedriger Defensivität bezeichnen Krohne & Rogner (1985) als Sensitizer. Die vierte Gruppe, mit hohen Ängstlichkeits- und hohen Defensivitätswerten, charakterisieren sie als hochängstliche Personen mit einem dysfunktionalen bzw. inkonsistenten Angsbewältigungsmuster (vgl. Abb.: 1)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Das zweidimensionale Konzept von Repression-Sensitization nach Krohne (1986)
Diese Einteilung erlaubt nach Krohne die Ableitung konkreter Bewältigungsverhaltensweisen, wenn Personen (mit entsprechend deutlicher Merkmalsausprägung) mit bedrohlichen Situationen konfrontiert sind. Von Sensitizern wird erwartet, daß sie, verglichen mit den anderen Gruppen, Informations- und Verhaltenskontrolle auszuüben versuchen. Represser müßten sich gedanklich und instrumentell weniger mit dem Stressor beschäftigen und sollten Informationen darüber aus dem Weg gehen (Krohne 1986).
Mit den Angstbewältigungstypen werden verschiedene globale Annahmen verbunden. Nicht- Defensive sollten in unterschiedlichen Situationen entsprechende Verhaltensvariation zeigen und deshalb höchste Bewältigungseffektivität erreichen. Sensitizer und Represser als die beiden rigiden Gruppen sollten nur dann erfolgreich sein, wenn ihr inflexibler Bewältigungsmodus zufällig zu den Situationsmerkmalen paßt (z.B. Represser vor einer Operation). Personen mit instabilem Modus, die Hochängstlichen, sollten bevorzugt emotionsregulierend handeln und am wenigsten effektiv sein.
Seit 1985 liegt eine Skala zur Erfassung von repressiven und sensitven Coping-Strategien bei Kindern vor. Bei der Repression-Sensitization-Traitskala für Kinder (RST-K, Krohne et al. 1985) handelt es sich um eine Skala, die anders als herkömmliche R-S-Skalen nicht globale Einstellungen und Reaktionstendenzen erfaßt, sondern auf konkrete bedrohliche Situationen Bezug nimmt. Sie beschreibt acht unterschiedliche, angstauslösende Situationen (vier selbstwertbedrohliche; vier physische Bedrohungen) und jeweils zwei Klassen von Bewältigungsreaktionen (sensitive und repressive).
In ähnlicher Weise ging Miller bei der Erstellung der ¯ Miller Behavioral Style Scale® (MBSS, Miller, 1980) vor. Er beschreibt mit den Begriffen "Monitoring" und "Blunting" zwei diametrale Dimensionen der Informationsverarbeitung in Belastungssituationen.
Monitoring ist die Tendenz, sich Informationen über die Belastungssituation zu verschaffen und zu nutzen. Blunting bezeichnet die Fähigkeit, sich von gefahrenrelevaten Reizen kognitiv abzulenken. Monitoring ist also ähnlich definiert wie Sensitization, Blunting ähnlich wie Repression.
Die MBS-Skala gibt vier belastende Situationen vor, von denen drei als physisch bedrohlich und eine als selbstwertbedrohlich anzusehen sind. Die Probanden sollen anhand von acht Aussagen über mögliche Verhaltensweisen, die informationssuchender respektive ablenkender Natur sind, angeben, ob dieses Verhalten auf sie zutrifft oder nicht.
Monitoring und Blunting sind unabhängig von demograhischen Merkmalen wie Geschlecht, Rasse, Alter und Bildungsniveau. Ebenso gibt es keine Zusammenhänge mit Depression, Ängstlichkeit und der Repression-Sensitization-Skala von Byrne (Miller, 1987). Der Versuch einer Übertragung in eine deutsche Fassung wurde von Schuhmacher (1990) unternommen.
4. Befunde
Es hat in der Vergangenheit eine Reihe von Untersuchungen zu verschiedenen Verhaltensbereichen im Zusammenhang mit Coping-Strategien gegeben. Einige Befunde sollen hier beschrieben werden.
Wie schon unter Punkt 3 (s.o. S.4) erwähnt, unterscheiden sich Represser und Sensitizer in ihrer physiologischen Reagibilität auf bedrohliche Reize. Da Represser höhere physiologische Reaktionen auf Streßreize aufweisen, läßt sich die Frage stellen, ob nicht die Wahrnehmung der eigenen Erregung das perceptual-defence-Phänomen determiniert. White & Wilkins (1973) konnten zeigen, daß Represser bei neutralen Wörtern höhere Erkennungszeiten hatten, wenn diese Wörter mit fingierten erhöhten physiologischen Erregungsrückmeldungen gekoppelt waren. Sensitizer wiesen für diese Wörter eine Reduktion der Erkennungszeit auf.
4.1. Reaktionen auf sexuelle Reize
Unterschiede in der Reaktionsweise auf sexuelle Reize zwischen Repressern und Sensitizern konnten Galbraith & Liebermann (1972) feststellen. In ihrer Untersuchung assoziierten Sensitizer überzufällig häufiger sexuelle Inhalte im Vergleich zu Repressern, wenn ihnen Wörter dargeboten wurden, die eine mehrdeutige Interpretation (neutral oder sexuell) zuließen.
Obwohl in einem Experiment von Byrne & Sheffield (1965) Represser und Sensitizer nach dem Lesen von erotischen Textpassagen gleichermaßen erregt waren, brachten Represser ihre Erregung mit Abscheu, Sensitizer dagegen mit positiven Gefühlen in Verbindung.
Byrne & Lamberth (1971) fanden heraus, daß der Zusammenhang zwischen dem Repression- Sensitization-Konstrukt und den Reaktionen auf sexuelle Reize bei Frauen stärker ausgeprägt ist als bei Männern (vgl. Amelang & Bartussek, 1981)
Bei der visuellen Darbietung sexueller Reize konnte ebenfalls ein Unterschied in den Verhaltensweisen von Repressern und Sensitizern festgestellt werden (Halperin, 1986). Sensitizer richten ihren Blick länger auf Dias mit sexuellem Inhalt als Represser.
4.2. Aufmerksamkeit gegenüber eigenen Krankheiten
Sensitizer verbalisieren häufiger Unwohlsein und Krankheit, suchen häufiger einen Arzt auf und nehmen mehr Medikamente ein im Vergleich zu Repressern (Byrne, Steinberg, Schwartz, 1968). Generell scheinen Sensitizer eher für psychosomatische Krankheiten anfällig zu sein, während Represser eher an organischen Krankheiten wie Krebs und Herzerkrankungen leiden (Schwartz, Krupp & Byrne, 1971). Liegt bereits eine Erkrankung vor, so weisen Represser bei einigen Krankheiten (z.B. Asthma) eine höhere Sterblichkeitsrate auf als gleichermaßen erkrankte Sensitizer.
Die vermittelnden Mechanismen für die Unterschiede zwischen Sensitizern und Repressern bestehen vermutlich darin, daß Represser die ersten Anzeichen einer Krankheit stärker verleugnen und sich daher auch weniger schnell in ärztliche Behandlung begeben. Wenn deutliche Symptome eine Verleugnung unmöglich machen, reagieren Represser stärker als Sensitizer. Zudem mag die Unterdrückung von Gefühlen in chronifizierter Form auch zur Entstehung von Krankheiten beitragen.
4.3. Beziehungen zwischen Erziehungsstilen und dem R-S-Konstrukt
In der Forschung zur Angstbewältigung gibt es nur wenig Arbeiten, die sich mit den Entwicklungsbedingungen vergleichsweise stabiler interindividueller Unterschiede im CopingVerhalten befassen.
Neben den Untersuchungen von Byrne (1964b) und Weinstock (1967), die nahelegen, daß Represser in einem freundlichen, entspannten und ausgeglichenen Familienklima aufgewachsen sind, Sensitizer dagegen ihre Familien eher als unterdrückend, belastend und distanziert erfuhren, sind insbesondere die Arbeiten von Krohne (1985b) und Mitarbeitern (Krohne, Wiegand, Kiehl, 1985) zu nennen.
Krohne et al. (1985) entwickelten ein Zweiprozeß-Modell, daß zu Vorhersagen von Angstbewältigungsdispositionen aufgrund der Erziehungsstildimensionen
- Häufigkeiten positiver und negativer Rückmeldung (Lob und Tadel),
- Konsistenz der Rückmeldung,
- Intensität von Bestrafung, sowie
- elterliche Unterstützung und Einschränkung
in der Lage sein soll. Operationalisiert werden diese Dimensionen durch das Erziehungsstil Inventar (ESI, Krohne et al. 1985). Vier verschiedene Angstbewältigungsstrategien werden über spezifische Konfigurationen der Subtests des Angstfragebogens für Schüler (AFS, Wieczerkowski, Nickel, Janowiski, Fittau & Rauer, 1973), respektive durch die Repression-Sensitization-Traitskala für Kinder (RST-K, s. Kap. 3) bestimmt, (Krohne, 1985). Die postulierten Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen bestimmter Merkmale elterlichen Erziehungsverhalten und spezifischen Angstbewältigungsformen sind in Abbildung 2 wiedergegeben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.:2 Postulierten Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen bestimmter Merkmale elterlichen Erziehungsverhalten und spezifischen Angstbewältigungsformen (aus Rogner, Krohne, Johann to Settel, 1982)
Die Studien erbrachten nur teilweise erwartungsentsprechende Ergebnisse. Es konnte bestätigt werden, daß die Ausbildung vigilanter Informationsverarbeitung eng mit den Erziehungsstilmustern "häufiger und inkonsistender Tadel" und "wenig Unterstützung" verbunden ist. Represser berichteten von einer positiven Familienerziehung, was als ein Indiz für die generelle Tendenz vermeidender Angstbewältiger interpretiert werden kann, unangenehme oder bedrohungsbezogene Sachverhalte zu verleugnen (vgl. Krohne, Kohlmann, Schuhmacher, 1988 und Rogner et al. 1982).
4.4. Lernen und Gedächtnis
Es liegt die Vermutung nahe, daß Represser aufgrund ihrer Tendenz, bedrohliche Reize zu nihilieren, schlechtere Erinnerungsleistungen bezüglich bedrohlicher Informationen zeigen als Sensitizer. Luborsky (1965) konnte diese Annahme mit Hilfe projektiver Testverfahren bestätigen. Er ließ Probanden (voher dargebotene) Bilder mit sexuellem Inhalt erinnern. Sensitizer konnten überzufällig mehr Bilder reproduzieren als Represser. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch Markowitz (1969), der neutrale Wörter, entweder mit negativen oder positiven Wörtern gleichzeitig darbot. Zwei Gruppe von Vpn erhielten eine neutrale respektive bedrohliche Instruktion. Verglichen mit der neutralen Bedingung konnten sich Represser unter der bedrohlichen Bedingung an weniger Wortpaare erinnern.
Unterschiede im Erinnern von länger zurückliegenden Ereignissen untersuchten Davis & Schwartz (1987). In ihrer Untersuchung baten sie 30 männliche Studenten, sich möglichst an alle Situationen in ihrem Leben zu erinnern, die sie mit Freude, Verwunderung, Glück, Ärger, Furcht oder Trauer assoziieren. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Differenz zwischen Sensitizern und Repressern. Allerdings ist anzumerken, daß Represser unabhängig von der emotionalen Gemütslage generell weniger Situationen erinnern als Sensitizer.
4.5. Weitere Befunde
Varca & Levy (1984) gingen der Frage nach, wie sich der Attributionsstil von Repressern und Sensitizern bei negativem feed back nach einer Teamarbeit unterscheidet. Ihre Untersuchung erbrachte folgende Ergebnisse: Personen, die vigilante Angstbewältigungsstrategien präferieren, attribuieren internal, wenn sie eine persönliche negative Rückmeldung erfahren, aber external sobald sich der Tadel auf die Gruppe bezieht. Represser reagieren reziprok auf die genannten Bedingungen. Die Autoren interpretieren die hypothesenkonformen Befunde in der Weise, als sie annehmen, daß ein Gruppen-feed-back mehrdeutige Interpretationen zuläßt, während ein persönlicher Tadel eindeutiger und damit weniger bedrohlich ist.
Was führt zu Einstellungsänderungen? Die Schlagkraft von Argumenten, oder die persönlichen Merkmale des Rezipienten? Das sind Fragen die im Hinblick auf Einstellungsänderung und Persuasion in der Sozialpsychologie von Interesse sind. Geht man davon aus, daß persönlich relevante Diskussionsthemen bedrohliche Elemente besitzen, so müßten Sensitizer per Definition mehr Information suchen als Represser. Mit anderen Worten, Sensitizer werden eher durch die Argumentstärke persuiert, Represser hingegen mehr durch die Persönlichkeit des Rezipienten. Debono & Snyder (1992) konnten in ihrem Experiment diese Hypothesen bestätigen. Sie fanden heraus, daß Represser, unabhängig von der Argumentstärke, durch die Quelle dieser Argumente (Experte vs. Laie) beeinflußt werden. Für Sensitizer ist die Stärke der Argumente eher ausschlaggebend für eine Einstellungsänderung.
5. Probleme der Validierung des Repression-Sensitization-Konstrukts
5.1. Meßverfahren
Bei der Durchsicht der Literatur zur Repression-Sensitization-Forschung wird deutlich, daß die Mehrzahl der Untersuchungen nicht oder schwer vergleichbar sind, da zur Einteilung in die Gruppe der Sensitizer bzw. Represser nicht nur unterschiedliche Meßverfahren verwendet, sondern auch unterschiedliche "cut-off-scores" benutzt werden. Da die Punktwerte der Angstskalen kontinuierlich variieren, ergibt sich aus der Willkürlichkeit der Festsetzung eines Grenzwertes zwischen den verschiedenen Abwehrtendenzen ein methodisches Problem.
Byrne (1963) legte den Schnitt bei 27% der Personen mit hohen Punktwert auf einer Repression- Sensitization-Skala und bei 27% mit niedrigem Punktwert. Andere benutzen "cut-off-scores" von 30%, 33% oder 40%.
Es gibt auch Untersuchungen, in denen der Median als "cut-off-score" verwendet wird und somit keine mittlere Gruppe besteht.
Von Chabot (1973) wird eine Einteilung in Quartile vorgeschlagen und ein einheitliches Meßinstrument, um eine Vergleichbarkeit der Gruppen in verschiedenen Untersuchungen zu gewährleisten.
5.2. Stichprobe
Eine Analyse der Zusammensetzung von Stichproben der amerikanischen Beiträge zur RepressionSensitization-Forschung ergab, daß 84% dieser Untersuchungen auf studentischen Versuchspersonen beruhen, wobei die Hälfte der Probanden durch Psychologiestudenten im ersten Semester gestellt wurden. Zusätzlich berücksichtigten nur die Hälfte der durchgeführten Studien eine ausgewogene Geschlechtsverteilung. 31% der Ergebnisse beruhen allein auf männliche, 11% allein auf weibliche Versuchspersonen (vgl. Chabot, 1973).
Ebenso wurde auch die Frage der freiwilligen oder unfreiwilligen Teilnahme als weitere wichtige Variable (Rosenthal & Rosnow, 11969) weitgehend vernachlässigt. So zeigten Untersuchungen von Becker (1967) sowie Baker & King (1970), daß Studentenkollektive verschiedener Städte sich in ihren Werten auf der Repression-Sensitization-Skala von Byrne (1963) stark von seiner Normstichprobe unterschieden.
In einer breit angelegten Untersuchung wies Schwartz (1972) einen Zusammenhang zwischen der spezifischen Form der Angstabwehr mit dem Lebensalter und dem Geschlecht nach. Geschlechtsunterschiede im Angstabwehrverhalten fanden auch Lomont (1966), Byrne, Steiberg, Schwartz (1968) und Thelen (1969)
5.3. Experimentelle Auslösung von Angst
Die Untersuchung von Emotionen erfolgt experimentalpsychologisch durch die systematische Variation bestimmter Bedingungen, von denen man annimmt, daß sie bestimmte Emotionen auslösen. Die begriffliche Trennung der auslösenden Bedingungen und der erfolgenden Reaktionen ist dabei problematisch, eine qualitative Bestimmung der Emotionen ist meist ebensowenig möglich wie eine exakte Angabe der Intensität dieser Emotionen (vgl. Krohne 1975).
In der Mehrzahl der Untersuchungen, in denen der Versuch unternommen wird, experimentelle Angst auszulösen, handelt es sich allein um Leistungsangst.
Es wird angenommen, daß das Ausmaß an psychologischem Streß mit der Bedeutung steigt, die diese Situation durch die Bewertung der betreffenden Person erfährt. Dabei zeigt sich, daß situative Aspekte und Persönlichkeitsdispositionen die Reaktionen auf die Angstauslösung stark beeinflussen.
5.4. Methodologische Probleme
Eysenck, (1989) kritisiert, daß in den meisten Untersuchungen, insbesondere in "perceptual-defence- Untersuchungen", nicht alle Wahrnehmungprozesse angesprochen werden. Die Darbietungszeit der Stimuli sei zu kurz um kognitive Prozesse zu aktivieren, die unterschiedliches Verabeitungsverhalten erst hervorbringen.
Einen weiteren Schwachpunkt sieht Eysenck darin, daß häufig nur ein bedrohlicher Reiz allein verwendet wird. Er nimmt an, Sensitizer und Represser werden erst dann unterschiedlich reagieren, wenn ein neutraler und ein bedrohlicher Reiz gleichzeitig, konkurrierend dargeboten werden.
6. Zusammenfassung
Obwohl das Repression-Sensitization-Konstrukt seit seiner Entstehung immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt ist, wird bis heute in vielen Bereichen der Psychologie der Versuch unternommen, es als differentialdiagnostisches Instrument zu etablieren. In der Vergangenheit sind ganze Reihen von Validierungsstudien durchgeführt worden, ohne jedoch befriedigende Ergebnisse zu liefern. Gründe hierfür werden zum einen in der Verwendung unterschiedlicher Skalen und cut-off-scores, zum anderen wegen methodologischer Schwächen der Untersuchungen vermutet. Das Repression- Sensitization-Konstrukt hat einiges zur Beschreibung unterschiedlicher Coping-Strategien in bedrohlichen Situationen beigetragen, und den Anstoß zu anderen Ansätzen auf diesem Gebiet geliefert.
Literaturverzeichnis
Amelang, M. & Bartussek, D. (1981) Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. Stuttgart: Kohlhammer.
Asendorpf, J.B., Wallbott, H.G.& Scherer ,K.R. (1983). Der verflixte Represser: Ein begründeter Vorschlag zu einer zweidimensionalen Operationalisierung von Repression- Sensitization. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 4(2), 113-128.
Byrne, D. (1961). The Repression-Sensitization-Scale: Rationale, reliability and validity. Journal of Personality, 29, 334-349.
Byrne, D.; Nelson, D. (1963). Relations of the revised Repression-Sensitization-Scale to measures of self-description. Psychological Reports, 13, 323-334.
Chabot , (1973). Repression-Sensitization: A critique of some neglected variables in the literature. Psychological Bulletin, 80, 122-129.
Cook, J.R. (1985). Repression-Sensitization and Approach-Avoidence as Predictors of Response to a Laboratory Stressor. Journal of Personality and Social Psycholog y, 49(3) 759- 773
Crowne, D.P., Marlowe, D. (1960). The approval motive. Studies in evaluative dependence. Journal of Consulting Psychology, 24, 349-354.
Debono, K.G., & Synder, A. (1992). Repressors, Sensitizers, Source Expertise, and Persuasion. Social Behavior and Personality, 20(4), 263-272.
Eysenck, M.W. (1989). Personality, Stress Arousal, and Cognitive Processes in Stress Transactions. In: Neufeld, R.W.J. (Ed.): Advances in the Investigation of Psychological Stress. New York: Wiley &Sons, Inc.
Halperin, J.M. (1986). Defensive Style and the Direction of Gaze. Journal of Research in Personality, 20, 327-337.
Hare, D. (1966). Denial of treath and emotional response to impending painful stimulations. Journal of Consulting Psychology, 30, 359-361.
Krohne, H.W. (1974). Untersuchungen mit einer deutschen Form der RepressionSensitization-Skala. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 3, 238-260.
Krohne, H.W. (1975). Angst und Angstverarbeitung. Stuttgart: Kohlhammer. Krohne, H.W. (1976). Theorien zur Angst. Stuttgart: Kohlhammer.
Krohne, H.W., (1985b). Entwicklungsbedingungen von Ängstlichkeit und Angstbewältigung: Ein Zweiprozeß-Modell elterlicher Erziehungswirkung. In H.W. Krohne (Hrsg.), Angstbewältigung in Leistungssituationen (S. 135-160). Weinheim: edition psychologie.
Krohne, H.W. (1986). Die Messung von Angstbewältigungsdispositionen I. Theoretische Grundlagen und Konstruktionsprinzipien. (Mainzer Berichte zur Persönlichkeitsforschung Nr.9). Mainz: Johannes-Gutenberg-Universität, Psychologisches Institut.
Krohne, H.W. & Rogner, J. (1982). Repression-Sensitization as a central construct in coping research. In: Krohne, H.W. & Laux, L. (Eds.): Achievement, stress, and anxiety. New York: Mc Graw Hill, 167-193.
Krohne, H.W., Rogner, J. (1985). Mehrvariablen-Diagnostik in der Bewältigungsforschung. In H.W. Krohne (Hrsg.), Angstbewältigung in Leistungssituationen (S. 45-62). Weinheim: edition psychologie.
Krohne, H.W., Wiegand, A., Kiehl, G.E. (1985). Konstruktion eines multidimensionalen Instruments zur Erfassung von Angstbewältigungstendenzen. In H.W. Krohne (Hrsg.), Angstbewältigung in Leistungssituationen (S. 63-77). Weinheim: edition psychologie.
Krohne, H.W. & Rogner, J., Schuhmacher, A. (1988). Beziehungen zwischen elterlichen Erziehungsstilen und Angstbewältiungsdispositionen des Kindes. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 10(2), 167-183.
Miller, S.M. 1987). Monitoring and Blunting: Validation of a questionaire to asses styles of information seeking under threat. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 345-353.
Rogner, J., Krohne, H.W., Johann to Settel, B. (1982). Zusammenhänge zwischen elterlichen Erziehungsstilmustern und Angstbewältigungsformen des Kindes. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 14(1), 32-46.
Scarpetti, W.L. (1973). The repression-sensitization dimension in relation to impending painful stimulation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40, 377-382.
Schumacher, A. (1990). Die Miller Behavioral Style Scale (MBSS)- Erste Überprüfung einer deutschen Fassung. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 11(4), 243- 250.
Slough, N.; Kleinknecht, R.A.; Thorndike, R.M. (1984). Relationship of the Repression- Sensitization Scales to Anxiety. Journal of Personality Assesment, 48(4) 378-379.
Spreen, O. (1963). Konstruktion einer Skala zur Messung der manifesten Angst in experimentellen Situationen. Psychologische Forschung, 26, 205-223.
Thorton, B. (1992). Repression and Its Mediating Influence on the Defensive Attribution of Responsibility. Journal of Research in Personality, 26, 44-57.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Repression-Sensitization-Konstrukt?
Das Repression-Sensitization-Konstrukt ist ein Versuch, unterschiedliche Coping-Strategien in Abhängigkeit vom Grad der Angst zu erklären und mögliche Prädiktoren für Verhalten in angstrelevanten Situationen zu diskriminieren.
Wie ist das Repression-Sensitization-Konstrukt entstanden?
Die ersten Ansätze zur empirischen Klassifikation von Angstabwehrmechanismen zu einem zentralen Konzept stammen aus frühen Experimenten zur Wahrnehmung (Bruner und Postman, 1947). Sie stellten fest, dass sich Personen in ihrer Reaktionsweise auf bedrohliche Reize unterscheiden: Die einen benötigen eine kurze Darbietungszeit, um einen bedrohlichen Reiz zu identifizieren, die anderen eine lange Darbietungszeit.
Wie wird das Repression-Sensitization-Konstrukt gemessen?
Es gibt zwei Richtungen der Differenzierung: Übliche Skalen zur Erfassung von Ängstlichkeit (z.B. Manifest-Anxiety-Scale) und Repression-Sensitization-Skalen (z.B. die Skala von Byrne, angepasst von Krohne). Krohne entwickelte eine deutsche Version der Byrne'schen Repression-Sensitization-Skala.
Welche Themengruppen werden in der deutschen Version der Repression-Sensitization-Skala von Krohne behandelt?
Die Skala behandelt 16 Themengruppen, darunter Schüchternheit, Zugeben von Fehlern, mangelndes Selbstvertrauen, Abhängigkeit, körperliche Symptome, Depression, Sorgen um den Verstand, negatives Selbstbild, Müdigkeit, Angst und Sorge, Stimmungslabilität, Mißtrauen, Ruhelosigkeit, bizarres zwanghaftes Denken und Handeln, soziale Sensibilität.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Repressern und Sensitizern?
Sensitizer zeigen höhere Werte in subjektiver Ungewissheit, Differenziertheit von Fremd- und Selbstbeurteilungen, Ängstlichkeitswerten, emotionaler Labilität, Leistungsminderung durch Angst, Zugeben von Fehlern, Dominanz und Selbstkritik. Represser zeigen höhere Werte in positiver Valenz der Selbstbeurteilung, Beurteilungskonformität, Tendenz zur sozialen Erwünschtheit, Ableugnen eigener Schwächen, Leistungförderung durch Angst.
Wie wird das Repression-Sensitization-Konstrukt als zweidimensionales Konzept differenziert?
Weinberger et. al. (1979) und Krohne & Rogner (1985) schlugen vor, Repression-Sensitization als zweidimensionales Konstrukt zu betrachten, wobei die eine Dimension durch Trait-Angst und die andere durch Defensivität im Sinne der Sozialen Erwünschtheit konstituiert wird. Dies ermöglicht die Einteilung in vier Gruppen: Nicht-Defensive, Represser, Sensitizer und hochängstliche Personen mit einem dysfunktionalen Angsbewältigungsmuster.
Gibt es spezielle Skalen zur Erfassung von Coping-Strategien bei Kindern?
Ja, seit 1985 gibt es die Repression-Sensitization-Traitskala für Kinder (RST-K, Krohne et al. 1985), die sich auf konkrete bedrohliche Situationen bezieht und sensitive und repressive Bewältigungsreaktionen erfasst.
Wie reagieren Represser und Sensitizer auf sexuelle Reize?
Sensitizer assoziieren häufiger sexuelle Inhalte, während Represser ihre Erregung mit Abscheu in Verbindung bringen.
Wie unterscheiden sich Represser und Sensitizer in Bezug auf Aufmerksamkeit gegenüber eigenen Krankheiten?
Sensitizer verbalisieren häufiger Unwohlsein und Krankheit, suchen häufiger einen Arzt auf und nehmen mehr Medikamente ein. Represser verleugnen die ersten Anzeichen einer Krankheit stärker und begeben sich daher weniger schnell in ärztliche Behandlung. Sie leiden eher an organischen Krankheiten, während Sensitizer eher für psychosomatische Krankheiten anfällig sind.
Gibt es Zusammenhänge zwischen Erziehungsstilen und dem Repression-Sensitization-Konstrukt?
Ja, Studien legen nahe, dass Represser in einem freundlichen, entspannten Familienklima aufgewachsen sind, während Sensitizer ihre Familien eher als unterdrückend, belastend und distanziert erfuhren. Die Ausbildung vigilanter Informationsverarbeitung ist eng mit den Erziehungsstilmustern "häufiger und inkonsistenter Tadel" und "wenig Unterstützung" verbunden.
Wie unterscheiden sich Represser und Sensitizer im Lernen und Gedächtnis?
Represser zeigen schlechtere Erinnerungsleistungen bezüglich bedrohlicher Informationen als Sensitizer. Sie erinnern sich generell an weniger Situationen, unabhängig von der emotionalen Gemütslage.
Wie unterscheidet sich der Attributionsstil von Repressern und Sensitizern bei negativem Feed back nach einer Teamarbeit?
Sensitizer attribuieren internal, wenn sie eine persönliche negative Rückmeldung erfahren, aber external, sobald sich der Tadel auf die Gruppe bezieht. Represser reagieren reziprok auf die genannten Bedingungen.
Wie werden Represser und Sensitizer durch Persuasion beeinflusst?
Represser werden, unabhängig von der Argumentstärke, durch die Quelle dieser Argumente (Experte vs. Laie) beeinflusst. Für Sensitizer ist die Stärke der Argumente eher ausschlaggebend für eine Einstellungsänderung.
Welche Probleme gibt es bei der Validierung des Repression-Sensitization-Konstrukts?
Die Verwendung unterschiedlicher Meßverfahren und "cut-off-scores" erschwert den Vergleich von Studien. Die Stichproben sind oft nicht repräsentativ (viele Studenten, unausgewogene Geschlechtsverteilung). Die experimentelle Auslösung von Angst konzentriert sich oft nur auf Leistungsangst. Es gibt methodologische Probleme, wie zu kurze Darbietungszeiten der Stimuli und die Verwendung nur eines bedrohlichen Reizes.
- Quote paper
- Klaus Lorenzen (Author), 1995, Das Repression-Sensitization-Konstrukt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95939