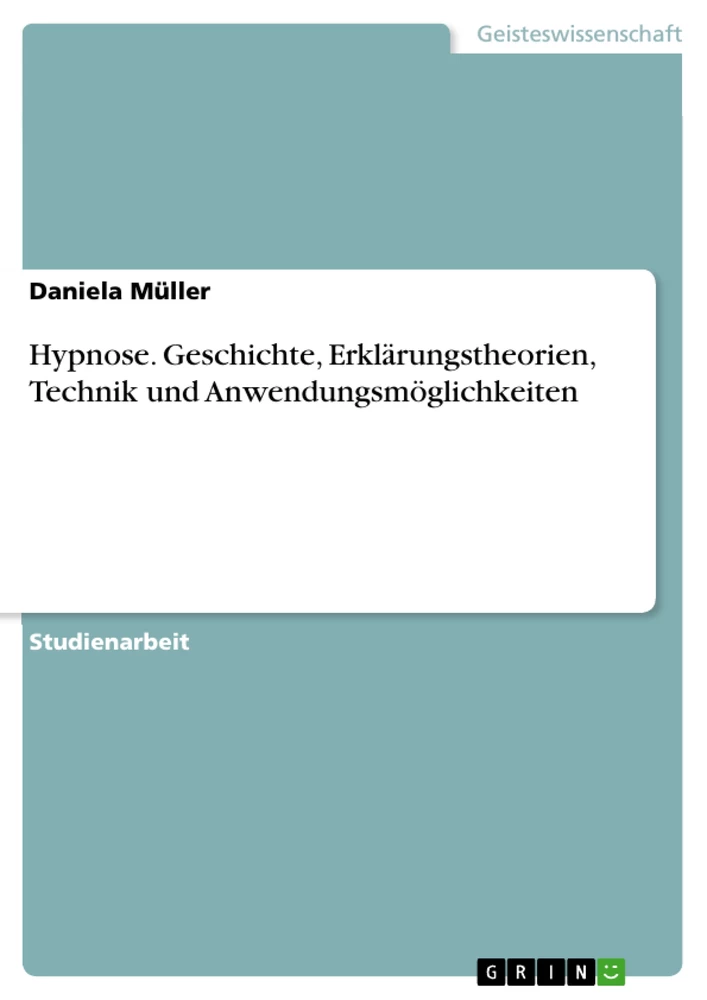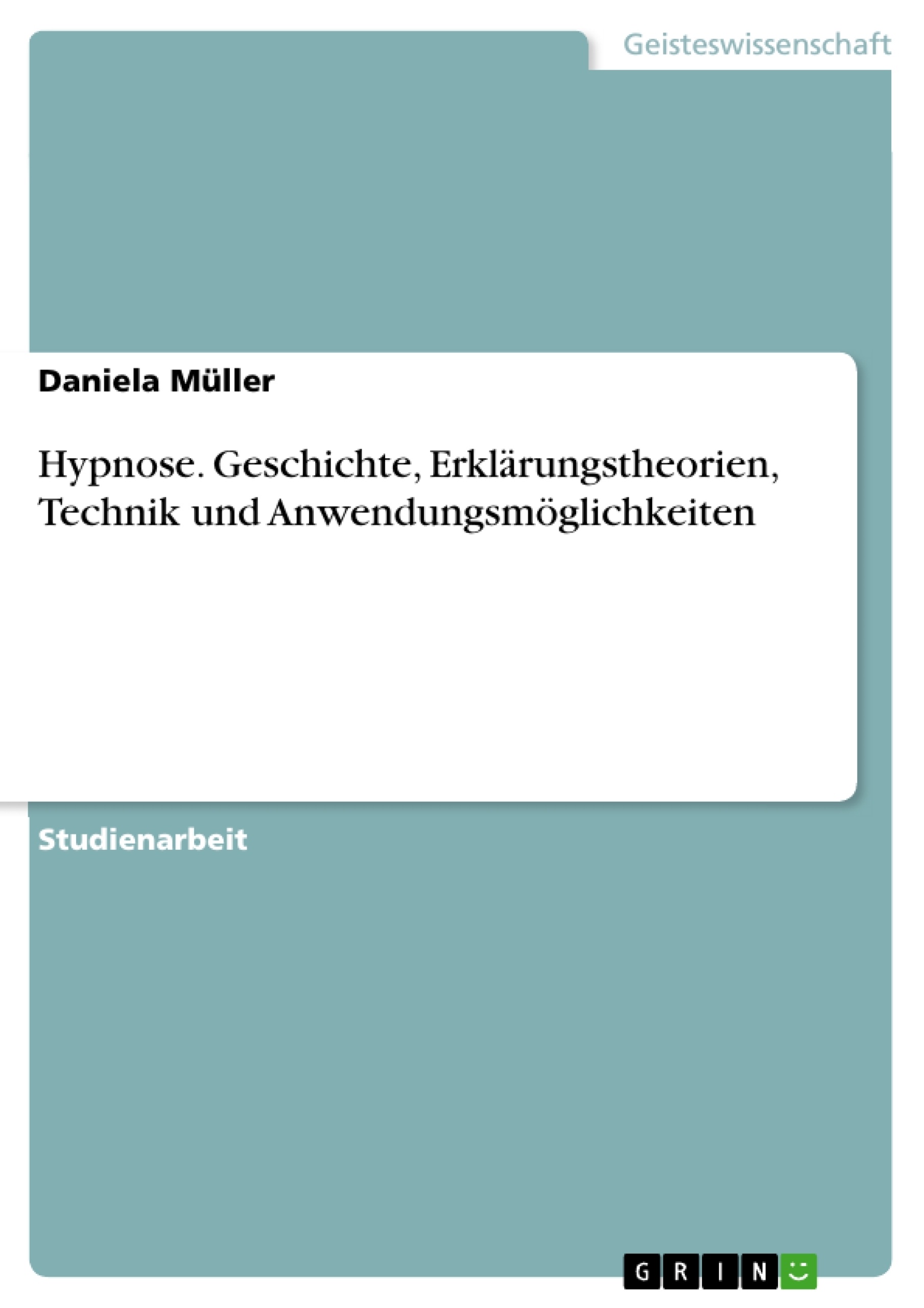Gliederung
1. Historischer Abriß
2. Hypnotische Phänomene
3. Theorien zur Erklärung
4. Technik
5. Anwendungsmöglichkeiten
6. Ausblick
7. Bibliographie
1. Historischer Abriß
1 Die ersten Versuche, durch spezifische Techniken innerhalb physiologischer Grenzen bestimmte psychologischen Grenzen, z.B. im Bereich des Denkens oder auch im Bezug auf somatische Reaktionen, zu überwinden, lassen sich weit zurückdatieren.
Bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. konnte man z.B. bei Fakiren oder Yogis typische hinduistische Meditationstechniken beobachten, deren Ziel ein ungetrübtes Bewußtsein war. Das sich daraus ergebende und auch heute populäre Yoga ist mit der Hypnose in Induktion und Zielsetzung durchaus vergleichbar.
In der Antike war sowohl bei den Griechen als auch bei den Ägyptern die Technik des sog.
Tempelschlafes bekannt, mit deren Hilfe man Heilung erzielen wollte und die auch als eine Form des Orakles eingesetzt wurde.
Auch keltische Druiden sahen im Schlaf eine Möglichkeit der Zukunftsdeutung und versuchten daher bei auserwählte Medien durch sich reimende Gesänge hellseherische Träume hervorzurufen. In der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wird wiederholt von Heilungen durch Handauflegen berichtet, so z.B. bei König David oder Jesus und seinen Jüngern; Petrus und Paulus sollen auch mit der Methode der Augenfixation gearbeitet haben.
Bis ins Mittelalter hatten diese “Vorläufer der Hypnose” einen eher spirituellen Charakter; häufig waren bestimmte Riten und Zeremonien wie z.B. spezielle Posen, man denke an den Lostussitz, von besonderer Bedeutung.
In einer Art Übergangszeit deutete PARACELSUS im 16. Jahrhundert n.Chr. das Handauflegen und ähnliche Techniken als Magnetisierung, die Heilung mit sich bringe; MESMER sprach später im 18. Jahrhundert von einer animalischen statt einer mineralischen Magnetisierung. 1784 scheiterte sein Versuch einer wissenschaftlichen Akkreditierung der Hypnose an der Akademie der Wissenschaften in Paris.
BRAID prägte im 19. Jahrhundert den Begriff der Hypnose, die zu dieser Zeit von englischen und schottischen Ärzten mit Erfolg zur Analgesie in der Chirurgie in Anspruch genommen worden war. Um die Jahrhundertwende wurde die durch den Einsatz chemischer Betäubungsmittel in Vergessenheit geratene Hypnose insbesondere von CHARCOT, aber auch von seinen Schülern JANET und FREUD, als psychiatrisch charakterisiertes Phänomen wieder entdeckt. Gleichzeitig beschäftigten sich LIEBEAULT und BERNHEIM mit der Hypnose als normalpsychologisches Phänomen.
So durchlief die Hypnose einen Wandel von einer religiös-spirituellen zu einer eher wissenschaftlichen Charakterisierung. In der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts verblaßte jedoch wieder einmal das Interesse an der Hypnose, woran FREUD durch seine baldige Mißbilligung der Hypnose aufgrund ihrer mangelnden Zuverlässigkeit einen nicht unerheblichen Beitrag leistete.
In der praktischen Nutzanwendung lebt sie heute hauptsächlich in der eingeschränkten Form des von SCHULTZ 1932 begründeten Autogenen Trainings weiter, das sich als eine Art Selbsthypnose mit formelhaftem Inhalt bezeichnen läßt.
Mit Beginn der dreißiger Jahre versuchte die Forschung, hier ist besonders HULL zu erwähnen, die Hypnose weitgehend mit experimentellen Methoden zu erfassen, etwa mit Hilfe einer Standardisierung der hypnotischen Phänomene oder der psychometrischen Erfassung der Suggestibilität. T.X. BARBER hinterfragte insbesondere die Notwendigkeit formeller Induktion und die charakteristische Qualität des hypnoiden Zustandes.
Ab 1950 und später gewann die Hypnose in der praktischen Nutzanwendung wie z.B. in der klinischen Psychologie immer mehr an Gewicht . Von großer Bedeutung war hier ERICKSON, der die Hypnose insbesondere bei Verhaltensstörungen, Neurosen und psychosomatischen Beschwerden angewandt hat. Die Forschung zur Nutzanwendung der Hypnose ist auch heute noch Bestandteil der aktuellen Forschung / Wissenschaft.2
2. Hypnotische Phänomene
Bei der Frage nach eindeutigen Merkmalen, die die Hypnose beschreiben, stößt man immer wieder auf das Problem, daß Phänomene, die in Hypnose in Erscheinung treten können, nicht ausschließlich und zwangsläufig in Zusammenhang mit Hypnose auftreten, sondern auch im normalpsychologischen und pathologischen Bereich ihren Platz haben. Aus diesem Grund sollte die folgende Zusammenstellung möglicher in Hypnose auftretender Phänomene nicht als hypnosespezifisch betrachtet werden, noch erhebt sie einen Anspruch auf Vollständigkeit.
Werden die gängigen Induktionstechniken angewandt, so kann man zunächst einen herabgesetzten Muskeltonus beobachten, der vom Hypnotisierten als ein Gefühl der Schwere wahrgenommen wird und auch als ein solches vom Hypnotiseur suggeriert wird. Die Atemintensität und auch die Herzfrequenz wird vermindert. Die peripheren Gef äß e weiten sich, was zu einem Gefühl der Wärme führt und häufig tritt auch eine allgemeine Umstellung des Stoffwechsel- und Ernährungszustandes ein, was sich z.B. in einer Veränderung der Magengeräusche äußert. Im EEG läßt sich ein erhöhter a -Wellen-Anteil beobachten.
All diese Ereignisse treten jedoch auch gehäuft bei einem allgemeinen Zustand der Entspannung auf: Hier wird das Problem einer eindeutigen Abgrenzung deutlich. Der sogenannte hypnoide Zustand, der v.a. auch durch die Dissoziation vom Alltag, d.h. durch die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf Realitätsfremdes gekennzeichnet ist, zeigt sich z.B. bei der Lektüre eines packenden Buches (evasorisches Lesen), wenn der Leser sich ganz in der Welt, die der Autor aufbaut, verliert; ein weiteres Beispiel ist das sogenannte Flußerleben bim kindlichen Spiel.
Welche Verhaltens- und Erlebensweisen in Hypnose nun konkret auftreten, hängt sehr stark von den Suggestionen bzw. von den bearbeiteten Inhalten ab. Bei Fortbestand der Trance sind schon bald kataleptische Reaktionen zu beobachten: Es tritt ein besonders unwillkürlicher Muskeltonus ein, der zu “wächsernen Biegsamkeit” führt, was sich beim Hypnotisierten z.B. im Lidschluß äußert und im subjektiven Gefühl der Unfähigkeit, etwa die Augen zu öffnen oder den Mund zu verziehen, die Arme zu heben oder aufzustehen. Im Gegensatz dazu kann der Hypnotisierte durch Suggestionen der Leichtigkeit aber z.B. auch in die Lage versetzt werden, die Arme über größere Zeiträume ohne nennenswerten Kraftaufwand in der Luft “schweben” zu lassen (Levitation).
Ungewöhnlich ist die verzerrte Wahrnehmung der während der Trance vorübergehenden Zeitspanne.
Wenn nichts Gegenteiliges suggeriert wird, unterschätzen die meisten Hypnotisierten die tatsächlich verstrichene Zeit fast um die Hälfte (Zeitverdichtung). Es kann aber auch die gleiche Zeitspanne als ein stundenlanges Ereignis suggeriert und so wahrgenommen werden (Zeitausdehnung). Weitere von der Zeit abhängige hypnotische Phänomene sind die Revivification und die Altersregression. Bei der Revivification erlebt der vergangene Begebenheiten aus seinem Leben noch einmal; alle späteren Erinnerungen, die sich auf die Zeit nach der revivifizierten Altersstufe beziehen, sind für den Zeitraum der Trance “gelöscht”. Bei der Altersregression wird ebenfalls Vergangenes wieder erlebt. Hier schlüpft der Proband aber lediglich in die Rolle dieses Alters, er tut so “als ob”. Spätere Erinnerungen sind nicht gelöscht.
Das Phänomen der Altersprogression sollte nur nach sorgfältiger Abwägung evoziert werden. Es handelt sich hierbei um eine Pseudo-Orientierung in der Zeit, das bedeutet, daß der Klient in “die Zukunft versetzt wird”: Er wird z.B. gebeten, ein Ereignis, das real erst noch bevorsteht, als “Erinnerung” zu schildern. Dies ist z.B. bei der Vorbereitung eines Patienten auf größere medizinische Maßnahmen wie Operationen und Chemotherapien sinnvoll, um latente Ängste zu erkennen und entsprechende therapeutische Maßnahmen zu ergreifen.. Da aber diese Vorwegnahme der Zukunft der üblichen Erlebensweise widerspricht, kann es bei der Rückkehr zum normalen Bewußtsein zu Zweifeln und Verwirrung kommen. Dadurch kann der therapeutische Erfolge zerstört werden, weswegen empfohlen wird, eine posthypnotische Amnesie zu suggerieren. Das Vergessen (Amnesie) bestimmter Ereignisse kann nach einer Sitzung spontan auftreten, wird aber auch oft durch posthypnotische Suggestionen durch den Hypnotiseur bewußt herbeigeführt. Eine vollständige Amnesie für die in der Trance bearbeiteten Inhalte tritt aber nicht immer ein; gute hypnotische Personen können sich in einer anderen Sitzung daran erinnern. Dessenungeachtet ist ein belustigter Widerwille von den bearbeiteten Inhalten außerhalb der Trance zu berichten nicht selten. Es kann unter Hypnose aber auch zu einer abnorm gesteigerten Gedächtnisleistung, zu einer Hypermnesie kommen, wobei der Hypnotisierte sich an längst vergessene Ereignisse genau erinnern kann, was ihm bei einem normalpsychologischen Aufmerksamkeitszustand nicht möglich wäre.
Nicht leicht von einer Hypmermnesie abzugrenzen sind Halluzinationen; sie können auf reaktivierten Erinnerungen oder aber auch auf bloßen Vorstellungen beruhen. Man unterscheidet positive Halluzinationen, bei denen mehr als tatsächlich vorhanden wahrgenommen wird (z.B. zwei Stühle statt einem), von negativen Halluzinationen, bei denen weniger wahrgenommen wird (z.B. ein real vorhandener Stuhl wird nicht wahrgenommen).
Mit Hilfe der Dissoziation und der Halluzination, insbesondere der negativen Halluzination, kann eine hypnotische Analgesie und Anästhesie bewirkt werden. Dissoziierte Körperteile sind schmerzunempfindlich. Der dadurch hervorgerufene Mangel an Schmerzbewußtheit und die Empfindungslosigkeit wird durch den Morphinantagonist Naloxon nicht aufgehoben, was gegen die Verantwortlichkeit endogener Endorphine für dieses Phänomen spricht. Auch im EMG zeigt sich, daß eine schmerzauslösende Gewebereizung fortbesteht, die aber in hypnotischer Analgesie nicht als solche empfunden wird.
Ein weiteres interessantes Phänomen ist das des hypnotischen Traums . Sowohl die Inhalte eines zu träumenden Traumes als auch die Frage, wann dieser Traum geträumt werden soll, lassen sich suggestiv manipulieren. Dabei gibt es, v.a. bei gut hypnotisierbaren Menschen, kaum Unterschiede zwischen normalen und induzierten Träumen.
Der Somnambulismus tritt nur in tiefer Trance auf und ist im allgemeinen mit einer Spontanamnesie verbunden. Das auffälligste Merkmal ist die auch bei geöffneten Augen tiefe Entspannung und Suggestibilität. Beim Somnambulismus handelt es sich um eine Form des Dämmerzustandes, in dem der Betroffene ähnlich handelt wie bei normalem Bewußtsein: Er geht herum, vollführt knifflige Handlungen usw.
Die schon mehrfach erwähnten posthypnotischen Suggestionen führen zu Empfindungen oder Handlungen, die nach der Beendigung der Hypnose vollzogen werden. Sie sind qualitativ einer Zwangshandlung ähnlich.
Eine Vielfalt der hier aufgeführten Phänomene kann man als Hinweise auf die Tiefe einer Trance heranziehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tabelle aus: T. Svoboda, 1984, S. 15-16)
3. Theorien zur Erklärung
3 Die Vielfalt der Theorien zur Erklärung der Hypnose ist beachtlich und zeugt von der Unsicherheit, mit der Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen beim Umgang mit dem Phänomen der Hypnose konfrontiert sind. Lediglich in einem Punkt scheinen sich die meisten Forscher einig zu sein: Deskriptiv hat Hypnose etwas mit veränderter Aufmerksamkeit bzw. verändertem Bewußtsein zu tun. BARBER (1984) definierte die Hypnose als eine Situation, “in der Personen durch geeignete Wahl der Worte (verbale Interaktion) und nonverbale Kommunikation sowie Kontextvariablen dahin geführt werden, daß sie Aufmerksamkeit anders verteilen: die Alltags- und Außenwahrnehmung wird zugunsten der Innenwahrnehmung bezüglich Denkens, Fühlens, Vorstellens und Empfindens reduziert.” (zitiert in Schorr (Hrsg.): Handwörterbuch der angewandten Psychologie, S. 338). Zu der Frage, wie diese Situation entsteht, gibt es nun verschiedene Erklärungen.
PAWLOW griff 1973 die schon seit langem bestehende Assoziation der Hypnose als Schlaf auf und ging davon aus, daß es sich bei der Hypnose um einen partiellen Schlaf handelt. Er stellte die Behauptung auf, im Zentralen Nervensystem gebe es bestimmte kortikale Prozesse, die sowohl in Hypnose als auch im Schlaf vorhanden seien. Bei beiden Phänomenen läßt sich, so PAWLOW, eine neurale Hemmung der Hirnhemisphären beobachten, die immer dann zustande kommt, wenn der Betroffene bewegungslos verharrt und ausreichend lang möglichst schwachen, monotonen Reizen ohne Verstärkung ausgesetzt ist. Im Schlaf ist die neurale Hemmung lückenlos und andauernd während sich in Hypnose indessen sog. “Wachpunkte” auf der Gehirnrinde feststellen lassen. Diese Wachpunkte ermöglichen den Kontakt zwischen Hypnotiseur und Proband.
Die Theorie der Hypnose als Hypersuggestibiltät leitete HULL 1933 aus dem ideomotorischen Gesetz ab, nach dem, das Fehlen andersartiger Ideen vorausgesetzt, allein der Gedanke an eine Bewegung genau diese Bewegung zumindest in Bruchstücken auslöst. Die Hull’sche Theorie besagt, daß sich Hypnose vom normalpsychologischen Zustand lediglich quantitativ im Sinne einer erhöhten Suggestibilität unterscheidet. Die in Hypnose hervorgerufenen Phänomene können auch im Normalzustand erreicht werden, wenn auch nur in abgeschwächter Intensität. 1947 faßte WELCH die Hypnose als konditionierte Reaktion auf. Seiner Ansicht nach spielen konditionierte symbolische Stimuli, d.h. die Worte des Hypnotiseurs, die Hauptrolle. Er betrachtet die Hypnose im Wesentlichen als eine Sequenz von Ereignissen zwischen Hypnotiseur und Hypnotisierten: Der Hypnotiseur stellt eine Behauptung auf und beginnt somt den Konditionierungsprozeß. Sein Gegenüber reagiert auf diese Behauptung in Form von Handlungen oder bestimmten Erlebnissen, die auf die Behauptungen des Hypnotisuers zurückführbar sind. Wenn diese Reaktion unmittelbar erfolgt, entsteht eine Bereitwilligkeit, reflexartig auf andere Behauptungen zu reagieren, die auf der Anfangssituation beruhen. Wesentlich ist die Überzeugung, daß die Suggestionen richtig und angemessen sind.
Die Theorie der Hypnose als Regression betrachtet die Hypnose als eine herbeigeführte Regression zu primitiven mentalen Funktionen unserer stammesgeschichtlichen Vorfahren; hypnotische Phänomene werden also als frühe phylogenetische Reaktion aufgefaßt (MEARES, 1960a). Fremde Gedanken werden ohne Kritik übernommen, logische Denken und kritische Bewertung sind so gut wie nicht vorhanden. GILL und BRENMAN (1959) sehen den Grund hierfür in einer teilweisen Aufhebung der Kontrolle des Ich über den Ich-Apparat und dem damit einhergehenden partiellen Verlust der Realitätsanbindung. Dadurch verliert dieser untergeordnete Teil des Ich seine Autonomie. Aufgrund dieser dadurch ausgelösten psychologischen Desorientierung kommt es zu einer Suche nach einer starken Figur, die Schutz und Betreuung bieten kann (GILL, 1972). Es kommt also zum Aufbau eines Subsystems im Ich, dem Ich bleibt aber auch in Trance ein Realitäts-Ich-Kern zur Verfügung, der im Kontakt zur Hypnotiseur steht und diesem auch nur zeitund versuchsweise die Kontrolle über das Subsystem überläßt.
JANET beobachtet 1925, daß viele Phänomene der Hysterie und der Multiplen Persönlichkeit in Trance forciert werden können; daher interpretierte er die Hypnose als eine pathologische Erscheinung. Seine Theorie der Hypnose als Dissoziation geht zurück auf die Annahme, daß das Bewußtsein sich aus zwei miteinander verkoppelten zusammensetzt, dem Bewußtsein und dem MitBewußtsein. In Hypnose kommt es nun zu einer Dissoziation dieser beiden Teile, so daß diese nicht mehr gemeinsam, sondern getrennt nebeneinander arbeiten.
HILGARD (1977) knüpfte an Janets Hypothese der Dissoziation an und begründete damit die Neodissoziationstheorie, interpretierte die Hypnose allerdings nicht als pathologischen Zustand. Er ging davon aus, daß der mentale Apparat aus vielen teilweise autonomen Teilsystemen (Logik, Kreativität, Emotion... mit ZNS, Immunsystem, Endokrinum... auf somatischer Seite vergleichbar) aufgebaut ist, die durch eine Exekutiv-Institution kontrolliert werden. In Trance wird nun diese Exekutiv-Institution unterlaufen, so daß die einzelnen Teilsysteme sowohl auf kognitivem als auch unter Umständen auf somatischem Niveau direkt kontaktierbar werden und in ihrer Wirkungsbreite nicht mehr durch die Exekutiv-Institution eingeschränkt werden. Auf die Frage, wie dieser Zustand erreicht werden kann, bietet die unmittelbar zuvor abgehandelte Theorie der Hypnose als Regression eine mögliche Antwort.
Im Kontext einer ich-psychologischen Theorie betrachtete FROMM (1977) die Hypnose als eine besondere Bewußtseinsstufe, derer es eine große Vielzahl gibt, z.B. Alltags-Bewußtsein oder Traum-Bewußtsein. Danach liegt die Hypnose zwischen dem normalen Wachzustand und dem psychotischen Zustand, insbesondere nahe dem halluzinatorischen Zustand. Die Ich-psychologische Theorie baut auf drei Einheiten auf: Der Ich-Aktivität, der Ich-Passivität (FROMM, 1972) und der Ich-Rezeptivität (DEIKMANN, 1971). Immer dann, wenn man sich willentlich und aus freien Stücken für etwas entscheidet ist das Ich aktiv. Passiv ist das Ich dann, wenn es diese Entscheidungsfreiheit an das Es, die Umwelt oder das Über-Ich verliert. Sobald das kritische Denken und der Realitätsbezug verloren geht, ist das Ich rezeptiv. In diesem Zustand, vergleichbar einem psychotischen Zustand, kann Material aus dem Unbewußten frei in das Bewußte übertreten. Die Hypnose ist nun ein Zustand, in dem einerseits die gesamte Aufmerksamkeit auf einen Punkt hin ausgerichtet ist, andererseits das Ich aber auch aktiv und v.a. in erhöhtem Maße rezeptiv ist. Daraus erklärt sich einerseits die erhöhte Beeinflußbarkeit in Trance, andererseits das Unvermögen, Dinge gegen den Willen des Hypnotisierten zu tun bzw. tun zu lassen.
SARBIN erörtert in seiner Theorie der Hypnose als Rollenhandeln Hypnose weniger aus dem subjektiven Erleben heraus, sondern eher aus der Situation, in der das Phänomen sich abspielt. Es handelt sich also um einen sozialpsychologischen Ansatz. Danach kann jeder Mensch in unterschiedlichem Maße in verschiedene Rollen involviert werden. Je stärker diese Involvierung wird, desto mehr nimmt die Trennung psychischer und somatischer Prozesse ab bis sie schließlich aufgehoben wird und die Phantasie Realitätscharakter erhält. In dieser “Realität der Phantasie” kommt es dann zu starken somatischen Effekten, die u.U. sogar irreversibel sein können wie beispielsweise beim Voodoo-Tod.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Theorie der Hypnose als Realitätsverkennung konzentriert sich auf das subjektive Erleben des Hypnotisierten. ORNE (1966, 1971) nutzt hierzu den Bericht Hypnotisierter über ihr Erfahrung in Trance als Quelle. Danach kann man dann von Hypnose sprechen, wenn der Betroffene daran glaubt, hypnotisiert zu sein bzw. hypnotisiert gewesen zu sein. Wesentliche Erfahrungen, die die Trance charakterisieren, sind Gedächtnis-, Wahrnehmungs- und Empfindungsstörungen (SHEEHAN & PERRY, 1976). Der Hypnotisierte glaubt daran, daß eine bestimmte Erinnerung oder eine bestimmte Wahrnehmung, die ihm suggeriert wird, gegeben sei und kann dann nicht mehr zwischen Phantasie und Realität unterscheiden. Der Knackpunkt liegt also darin, daß der Mensch seine Rolle als echt empfindet.
In seinem Ansatz aus den 60er Jahren, der Theorie der Hypnose als Alltag, reduziert T.X. BARBER den Effekt der Hypnose auf Prozesse, zu denen der Mensch immer dann in der Lage ist, wenn sowohl eine positive Einstellung und eine positive Erwartungshaltung als auch die Fähigkeit zur plastischen Vorstellung gegeben sind. Dann und nur dann ist ein Mensch fähig und bereit so zu denken, zu fühlen oder zu handeln, wie es den Suggestionen entspricht. Eine positive Erwartungshaltung und die damit einhergehende Kooperationsbereitschaft kann sich aber nur dann entwickeln, wenn dem zu Hypnotisierenden die behandelnde Person ebenso wie die Prozedur an sich glaubwürdig und vertrauenswürdig erscheinen. Das bedeutet, daß auch bei der Hypothese, es handle sich bei der Hypnose nicht um einen besonderen Bewußtseinszustand, sondern um einen willentlichen Entschluß zur Kooperation, die hypnotische Beziehung die wesentliche Rolle spielt.
4. Technik
4 Die der Allgemeinbevölkerung aufgrund verschiedener Shows auf Bühnen, im Fernsehen usw. am meisten bekannte Induktionsmethode ist die Technik der klassischen direkten Hypnose nach SCHULTZ. Hierbei wird Schritt für Schritt über Verbalsuggestionen und den Einstieg über Fixation, Farbenkontrast u.ä. die Trance aufgebaut. Vorrangig kommen direkte Suggestionen zum Einsatz (“Sie sehen ganz unverwandt auf diesen Punkt.”). Durch das autoritäre Auftreten des Hypnotiseurs wird bei dieser Methode insbesondere der kindlich-regressive Anteil im Probanden angesprochen und der Anteil der Fremdbestimmtheit gefördert.
Weniger bekannt ist die Technik der indirekten Hypnose nach M.H. ERICKSON, da diese wesentlich subtilere Züge trägt und aufgrund ihrer eingeschränkten Publikumswirksamkeit nicht so stark propagiert wird. Sie betont stärker die Einzigartigkeit des Probanden und der besonderen, vertrausensvollen Beziehung zwischen Hypnotiseur und Hypnotisiertem, um zu vermeiden, daß man ausnahmslos einer bestimmten Technik nachgeht, die dem, der hypnotisiert werden soll, vielleicht nicht so bekommt. Man möchte dadurch, im Gegensatz zur direkten Hypnose, autonome Prozesse beim Probanden berücksichtigen und zur Geltung kommen lassen. Es werden meist lediglich indirekte Suggestionen benutzt (“Während Sie mir zuhören, dürfen Ihre Gedanken Ihre eigenen Wege gehen.”).
In beiden Fällen versucht man, die Aufmerksamkeit des Probanden von außen zu steuern. Zu Beginn versucht der Hypnotiseur, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Nach Möglichkeit versucht er, auf individuelle Präferenzen des Probanden von Wahrnehmung, sozialer Interaktion, kognitiven Stil usw. Rücksicht zu nehmen (UtilisationsPrinzip). Treten unmittelbare Reaktionen auf, so werden diese vom Hypnotiseur nach Möglichkeit so genutzt, daß sie die erwünschte Reaktion begünstigen (Inkorporation). Wurde mittels direkter oder indirekter Suggestionen ein Trancezustand erreicht, so kann die Aufmerksamkeit vorsichtig von äußeren Inhalten (z.B. Fixation eines Objektes) auf die eigentlichen kognitiven Inhalte bzw. Erinnerungen oder auf physiologische Veränderungen gelenkt werden. Die Trance kann durch Zählen oder Bilder wie Treppensteigen vertieft werden; gleichzeitig wird so dem Organismus die Möglichkeit gegeben, einen eventuell angestrebten physiologischen Zustand in angemessener Zeit zu erreichen. In der Abschlußphase der hypnotischen Sitzung erfolgt die Reorientierung. Hierbei ist das wesentliche Ziel die Übertragung auf Alltagserlebnisse (Posthypnotische Suggestion). In Abhängigkeit von den in der Trance bearbeiteten Inhalte kann u.U auch auf eine teilweise Amnesie hingesteuert werden (z.B. durch Ablenkung); dies bietet sich insbesondere bei schmerzhaften Bearbeitungen im klinischen Bereich an.
5. Anwendungsmöglichkeiten
5 Hypnose kann im Bereich der klinischen Psychologie sowohl mit der Indikation der Symptomkontrolle eingesetzt werden, aber auch im Rahmen von aufdeckenden dynamischanalystischen Verfahren.
Bei der Symptomkontrolle steht v.a. die Therapie von Schmerzzuständen im Vordergrund. Durch Hypnose solle eine gewisse Kontrolle über den Schmerz erreicht werden oder die Qualität der Schmerzwahrnehmung soll verändert werden. Dies kann z.B. erreicht werden, indem der Patient versucht, als Kontrast ein Wohlbefinden aufzubauen, um den Schmerz zu kompensieren. Auch die Nutzung spezifischer Suggestionen, z.B. daß der Schmerz in einen anderen Körperteil verlagert wird oder indem er eine andere Qualität annimmt, z.B. indem Wärme durchfließt, hat sich als hilfreich erwiesen. Durch diese Techniken kann dem Patienten eine gewisse Erleichterung verschafft werden. Hierzu ist eine leichte Trance bereits ausreichend. Diese Methoden werden zunehmend auch in der medizinischen Psychologie angewandt, z.B. in der Zahnheilkunde oder in der Geburtshilfe. Die Hypnose findet auch in der Therapie von neurotischen und psychosomatischen Krankheiten Anwendung. Allerdings wird hier die klassisch-suggestive Methode eher bei aktuen Kriseninterventionen eingesetzt, um Symptome günstig zu beeinflussen, z.B. bei einem akut- psychogenen Asthmaanfall.
Im Rahmen einer stützenden Therapie soll die Hypnose zur inneren Entspannung beitragen, Symptome lindern und die allgemeine Stabilisierung des Gesundheitszustandes unterstützen. In der Verhaltenstherapie wird die hypnotische Suggestion als unterstützendes Verfahren eingesetzt (z.B. bei der Raucherentwöhnung).
Das Autogene Training, das aus der Fremdhypnose entwickelt wurde und als eine Art Selbsthypnose bezeichnet werden kann, wird v.a. als ein Mittel zur Selbsthilfe betrachtet. Es spielt v.a. in der Gesundheitsvorsorge eine große Rolle.
Im Rahmen von aufdeckenden Verfahren wird Hypnose angewandt, um einen Zugang zum Unbewußten und zu verdrängten Erinnerungen zu erhalten. Hypnoanalyse ist die Verbindung von hypnoidem Zustand und analytisch-therapeutischem Vorgehen. Von Vorteil ist hier die Beschleunigung des Prozesses, weil in Trance Widerstände leichter abgebaut werden können.
Indessen ist zu beachten, daß Übertragung und Gegenübertragung bei einer Hypnoanalyse wesentlich schwerer zu handhaben sind.
6. Ausblick
6 Das Image der Hypnose war seit jeher unbeständig, doch in letzter Zeit hat sie wesentlich an Bedeutung gewonnen. Vermutlich geht dies darauf zurück, daß die neueren Ansätze zur Erklärung der Hypnose den subjektiven Anteil der Erfahrung zum Ausgangspunkt nehmen und damit die Hypnose von dem Hauch der Magie befreien und wissenschaftlich zugänglicher machen. Offensichtlich ist die hypnotische Trance einen besonderen Verarbeitungsmodus, der mit dem Alltagsverständnis nicht deckungsgleich ist, denn in Trance ist es einerseits möglich, Imaginationen in somatische Prozesse umzusetzen, andererseits kann die Wirklichkeit beträchtlich umgedeutet werden. Aus diesem Grund ist die Hypnose sowohl als ein Bindeglied zwischen kognitiven und physiologischen Ereignissen ein bemerkenswerter Ansatz zum Verständnis psychosomatischer Prozesse als auch aus allgemeinpsychologischer Sichtweise ein bedeutungsvolles Phänomen.
7. Bibliographie
- Heigl-Evers, Heigl, Ott: Lehrbuch der Psychotherapie. Stuttgart; Jena: G. Fischer, 1993.
- Leuner, H., Schroeter, E.: Indikationen und spezifische Applikationen der Hypnosebehandlung. Bern; Stuttgart; Toronto: Verlag Hans Huber, 1975.
- Peter, B., Kraiker, C., Revenstorf, D. (Hrsg.): Hypnose und Verhaltenstherapie. Bern; Stuttgart; Toronto: Verlag Hans Huber, 1991.
- Revenstorf, D. (Hrsg.): Klinische Hypnose. Heidelberg: Springer, 1990.
- Revenstorf, D.: Hypnose. In: Schorr, A. (Hrsg.): Handwörterbuch der Angewandten Psychologie. Bonn: Dt. Psychologen-Verl., 1993.
- Svoboda, T.: Das Hypnosebuch. München: Kösel, 1984.
[...]
1 vgl. Revenstorf, D. (Hrsg.): Klinische Hypnose. Heidelberg: Springer, 1990. Revenstorf, D.: Hypnose. In: Schorr, A. (Hrsg.): Handwörterbuch der Angewandten Psychologie. Bonn: Dt. Psychologen-Verl., 1993.
2 vgl. Svoboda, T.: Das Hypnosebuch. München: Kösel, 1984, darin: Phänomene.
3 vgl. Svoboda, T.: Das Hypnosebuch. M ünchen: Kösel, 1984, darin: Erklärungsansätze. Revenstorf, D.: Hypnose. In: Schorr, A. (Hrsg.): Handwörterbuch der Angewandten Psychologie. Bonn: Dt. Psychologen-Verl., 1993.
4 vgl. Heigl-Evers, Heigl, Ott: Lehrbuch der Psychotherapie. Stuttgart; Jena: G. Fischer, 1993, darin: Hypnose und Autogenes Training. Revenstorf, D.: Hypnose. In: Schorr, A. (Hrsg.): Handwörterbuch der Angewandten Psychologie. Bonn: Dt. Psychologen-Verl., 1993.
5 vgl. Revenstorf, D. (Hrsg.): Klinische Hypnose. Heidelberg: Springer, 1990. und Heigl-Evers, Heigl, Ott: Lehrbuch der Psychotherapie. Stuttgart; Jena: G. Fischer, 1993, darin: Hypnose und Autogenes Training.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments über Hypnose?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Hypnose, einschließlich ihrer Geschichte, ihrer Phänomene, Erklärungsansätze, Techniken und Anwendungsmöglichkeiten.
Was sind einige der wichtigsten historischen Meilensteine in der Entwicklung der Hypnose?
Das Dokument beleuchtet frühe Praktiken, die der Hypnose ähneln, wie z.B. Meditationstechniken bei Fakiren und Yogis, Tempelschlaf im alten Griechenland und Ägypten, sowie Heilungen durch Handauflegen in biblischen Texten. Es verfolgt die Entwicklung von Paracelsus und Mesmer bis hin zu Braid, Charcot, Janet, Freud, Liebeault und Bernheim, und schließlich zu Schultz und Erickson.
Welche hypnotischen Phänomene werden in dem Dokument beschrieben?
Das Dokument beschreibt eine Vielzahl hypnotischer Phänomene, wie z.B. herabgesetzter Muskeltonus, verminderte Atemintensität und Herzfrequenz, Erweiterung der peripheren Gefäße, veränderter Stoffwechselzustand, erhöhter α-Wellen-Anteil im EEG, katalepsische Reaktionen, Levitation, Zeitverdichtung und -ausdehnung, Revivification, Altersregression und -progression, Amnesie, Hypermnesie, Halluzinationen (positive und negative), Analgesie und Anästhesie, hypnotischer Traum und Somnambulismus.
Welche Theorien zur Erklärung der Hypnose werden diskutiert?
Das Dokument stellt verschiedene Theorien zur Erklärung der Hypnose vor, darunter Pawlows Theorie des partiellen Schlafs, Hulls Theorie der Hypersuggestibilität, Welchs Theorie der konditionierten Reaktion, Theorien der Regression, Janets Dissoziationstheorie, Hilgards Neodissoziationstheorie, Fromms ich-psychologische Theorie, Sarbins Theorie des Rollenhandelns, ORNEs Theorie der Realitätsverkennung und Barbers Theorie der Hypnose als Alltag.
Welche verschiedenen Hypnosetechniken werden erwähnt?
Das Dokument beschreibt die klassische direkte Hypnose nach Schultz und die indirekte Hypnose nach M.H. Erickson. Es werden auch die Prinzipien der Vertrauensbildung, des Utilisation-Prinzips und der Inkorporation erläutert.
In welchen Bereichen kann Hypnose angewendet werden?
Das Dokument beschreibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Hypnose in der klinischen Psychologie, einschließlich Symptomkontrolle (z.B. Schmerztherapie), unterstützende Therapie, Verhaltenstherapie und aufdeckende dynamischanalytische Verfahren (Hypnoanalyse). Es wird auch auf die Anwendung in der medizinischen Psychologie (z.B. Zahnheilkunde, Geburtshilfe) und das Autogene Training als Selbsthilfe-Methode hingewiesen.
Welche Schlussfolgerung wird im Ausblick gezogen?
Das Dokument schließt mit der Feststellung, dass die Hypnose in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen hat, da neuere Ansätze den subjektiven Anteil der Erfahrung betonen. Sie wird als ein besonderer Verarbeitungsmodus betrachtet, der es ermöglicht, Imaginationen in somatische Prozesse umzusetzen und die Realität umzudeuten. Damit ist die Hypnose ein Ansatz zum Verständnis psychosomatischer Prozesse und ein bedeutungsvolles Phänomen aus allgemeinpsychologischer Sicht.
Wo finde ich die erwähnten Quellen?
Das Dokument enthält eine Bibliographie mit den folgenden Quellen: Heigl-Evers, Heigl, Ott: Lehrbuch der Psychotherapie; Leuner, H., Schroeter, E.: Indikationen und spezifische Applikationen der Hypnosebehandlung; Peter, B., Kraiker, C., Revenstorf, D. (Hrsg.): Hypnose und Verhaltenstherapie; Revenstorf, D. (Hrsg.): Klinische Hypnose; Revenstorf, D.: Hypnose. In: Schorr, A. (Hrsg.): Handwörterbuch der Angewandten Psychologie; Svoboda, T.: Das Hypnosebuch.
- Arbeit zitieren
- Daniela Müller (Autor:in), 1997, Hypnose. Geschichte, Erklärungstheorien, Technik und Anwendungsmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95920