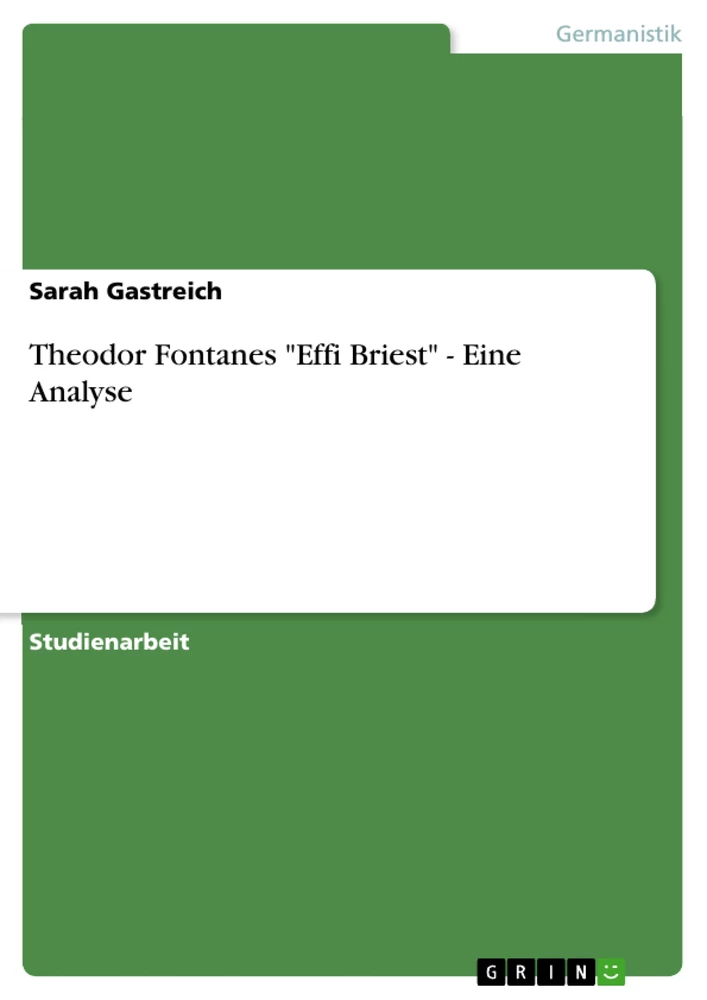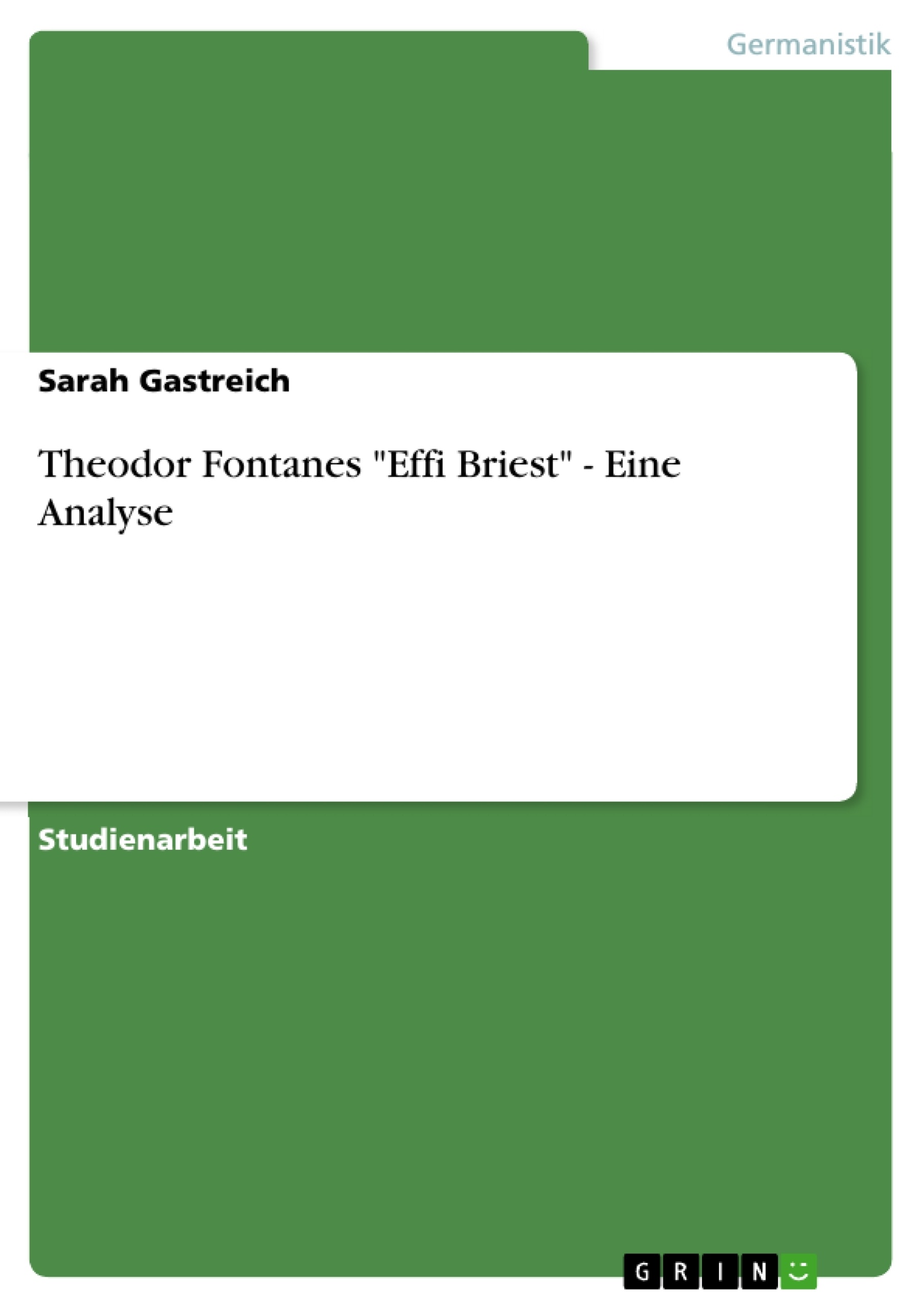Einleitung:
Theodor Fontanes Vorbild für Effi Briest ist die 1853 geborene Elisabeth Freiin von Ploth. Sie verlobt sich im Jahr 1871 als 17-jährige mit dem 22-jährigen Leutnant Armand Lon von Ardennes. 1873 heiraten die beiden und ziehen nach Berlin. Acht Jahre später kehrt Ardenne als Rittermeister zu den Husaren nach Düsseldorf zurück und Elisabeth folgt ihm. Die Familie Ardenne ist seit 1980 mit dem verheirateten Amtsrichter Emil Hartwich (er ist 10 Jahre älter als Elisabeth) freundschaftlich verbunden. Aus dieser Verbundenheit heraus geht Elisabeth mit 31 Jahren eine Beziehung mit ihm ein, da sie keine glückliche Ehe führt. Sie tragen sich beide mit dem Gedanken, sich scheiden zu lassen. Der mißtrauisch gewordene Ardenne entdeckt in einer verschlossenen Kassette die Pläne der beiden; daraufhin reicht er seinerseits die Scheidung ein und fordert Emil Hartwich zum Duell, das am 27. November 1886 mit der schweren Verwundung von Hartwich endet. Dieser stirbt an seinen Verletzungen - die Kinder der Familie Ardenne werden nach der Scheidung dem Vater zugesprochen. Die geschiedene Elisabeth widmet sich dem Dienst an hilfsbedürftigen und kranken Menschen und stirbt 1952 fast 100-jährig am Bodensee.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ehegeschichte
- Erwartungen und die Realität
- Einführung des Chinesenmotivs
- Die Bedeutung des Chinesen in der Bismarck-Zeit
- Effis Reaktionen auf den "Chinesen"
- Wandlung des Chinesenmotivs
- Vieldeutigkeit des Chinesenmotivs
- Politische und gesellschaftliche Ordnung der Bismarck-Ära
- Die Duell-Thematik
- Das Duell - Unabwendbar?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ und beleuchtet verschiedene Aspekte der Handlung. Im Fokus steht die Ehe zwischen Effi und Innstetten, insbesondere die Rolle des „Chinesen“ als Symbol für die Konflikte und Ängste in Effis Leben. Des Weiteren wird die gesellschaftliche Ordnung der Bismarck-Zeit und die Duell-Thematik im Roman untersucht.
- Die Ehe zwischen Effi und Innstetten: Analyse der Beziehung, der Erwartungen und der Realität.
- Das Chinesenmotiv: Bedeutung und Interpretation im Kontext der Bismarck-Zeit und Effis psychischem Zustand.
- Gesellschaftliche Ordnung der Bismarck-Ära: Darstellung von Normen, Konventionen und Konflikten.
- Die Duell-Thematik: Analyse der Notwendigkeit und der Folgen des Duells im Roman.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den historischen Hintergrund des Romans dar und beleuchtet die Figur der Elisabeth Freiin von Ploth, die als Vorbild für Effi Briest diente. Die Arbeit soll die Ehe zwischen Effi und Innstetten, das Chinesenmotiv, die gesellschaftliche Ordnung der Bismarck-Zeit und die Duell-Thematik im Roman näher beleuchten.
Die Ehegeschichte
Effis Beziehung zu Innstetten ist geprägt von Distanz und Fremdheit. Trotz der Verlobung und der Hochzeit kann keine wirkliche Intimität entstehen. Effi sehnt sich nach einem lebendigen und aufregenden Leben, während Innstettens Leben eher von Routine und gesellschaftlichen Pflichten geprägt ist. Die Kommunikation zwischen den beiden ist oberflächlich und Effi fühlt sich zunehmend isoliert.
Einführung des Chinesenmotivs
Das Chinesenmotiv wird schon früh in der Handlung eingeführt und spiegelt die ambivalenten Gefühle, die Effi gegenüber dem Exotischen hegt. Ihre Angst vor dem "Gruseligen" des Chinesen verstärkt sich durch ihre Isolation in Kessin und die unbefriedigende Ehe mit Innstetten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenbereiche des Romans sind: Ehe, Gesellschaft, Bismarck-Ära, Chinesenmotiv, Exotik, Isolation, Duell, Konventionen, Moral, Tradition.
- Citar trabajo
- Sarah Gastreich (Autor), 2001, Theodor Fontanes "Effi Briest" - Eine Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958