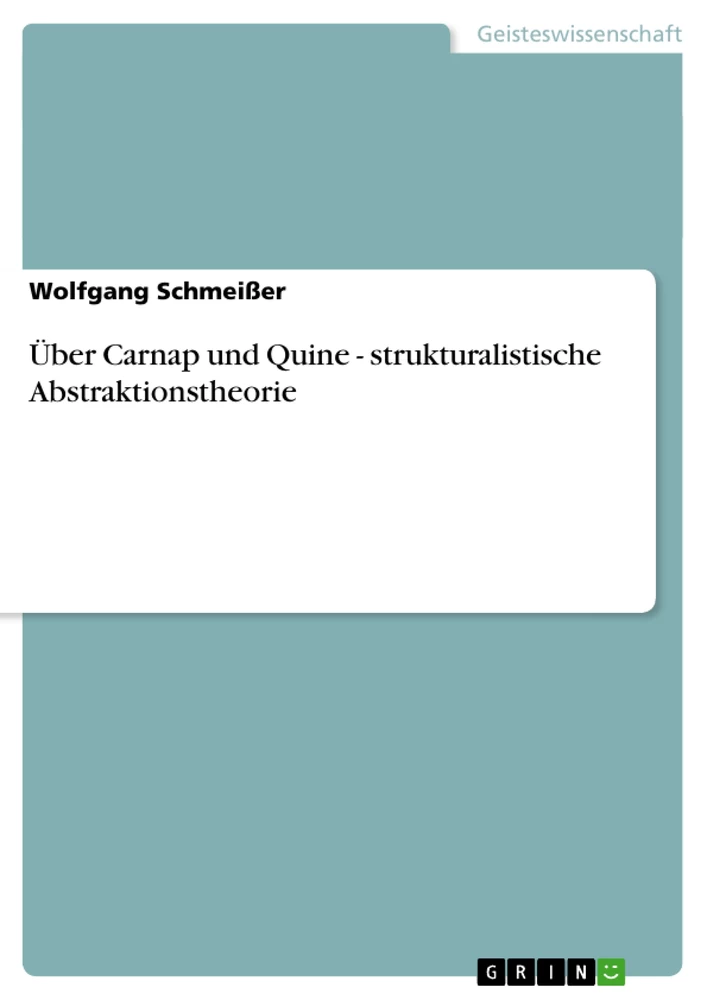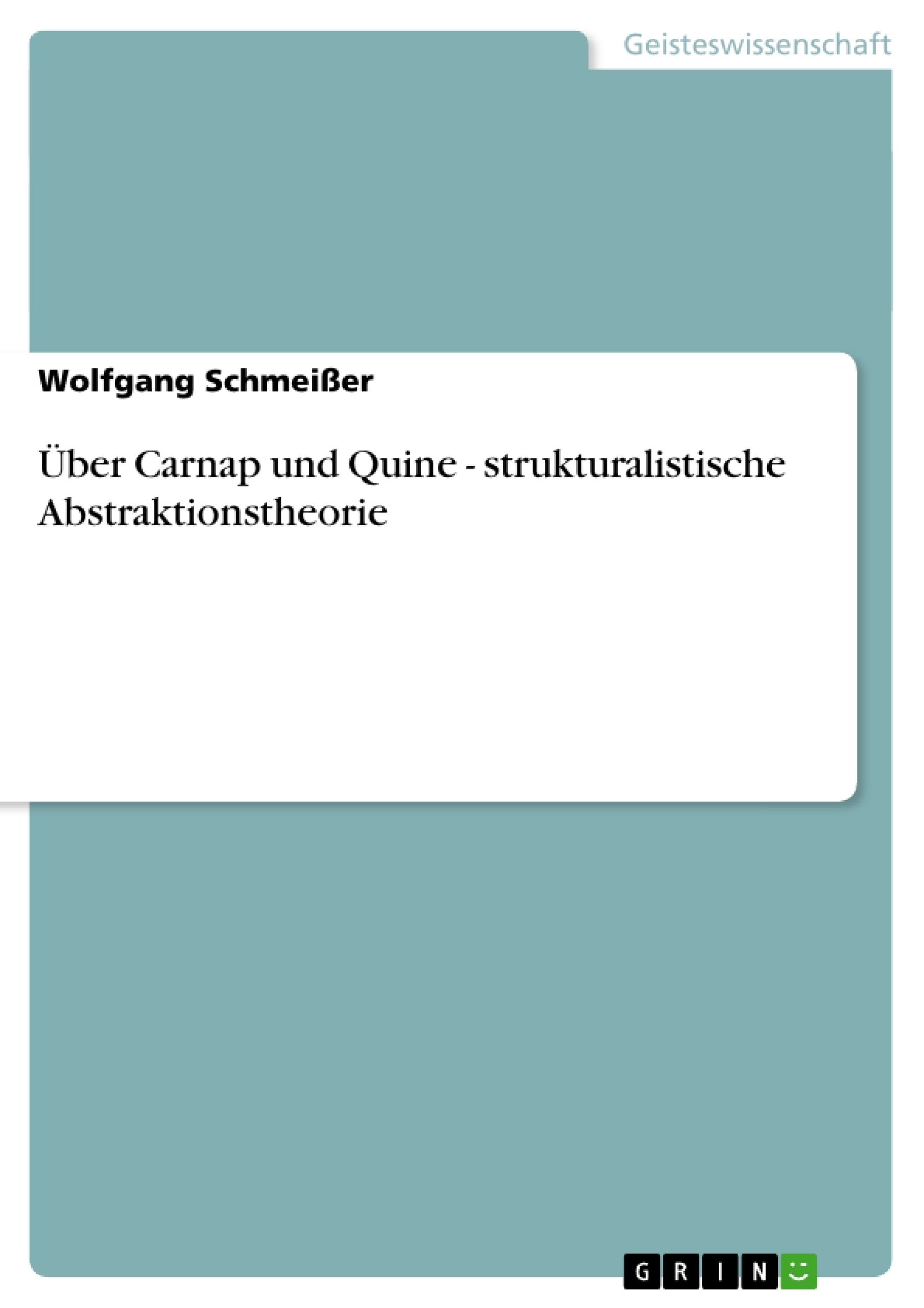Über Carnap und Quine
Netzwerksemantik
Carnap bringt zur Verdeutlichung das Bild eines Eisenbahnnetzes: im Prinzip müßte jeder Bahnhof eindeutig dadurch bestimmt sein, wie er von welchen anderen Bahnhöfen erreicht werden kann. Jede Zielstation ist also beschrieben, wenn festgestellt ist, auf welchen Wegen sie von den anderen Stationen erreicht werden kann.
Ordnen wir also jeder Station einen Schlüssel (eine Bezeichnung) zu, so können wir die Bedeutung jeder dieser Bezeichnungen als Menge von Schrittfolgen auffassen, die ausgeführt werden müssen, um zu jeweils einem anderen Schlüssel zu gelangen, d.h. von Konstruktionsvorschriften für andere Namen. Natürlich gibt es zwischen je zwei gegebenen Stationen stets mehrere Wege, wenn wir Schleifen zulassen sogar unendlich viele. Daher macht es offensichtlich keinen Sinn, die Bedeutung der Bezeichnungen einzeln explizieren zu wollen. Es ist auch nicht notwendig, diese Mengen aufzuzeigen, da wir mit dem Netzwerk selbst, sofern es uns gelingt, es darzustellen, bereits über die vollständige Explikation der Bedeutungen aller darin enthaltenen Bezeichnungen verfügen, und damit über die Möglichkeit, jede gültige Konstruktion durchzuführen. Wir können das so erklärte System von Bezeichnungen und deren Bedeutungen eine Sprache nennen.
Je zwei Bezeichnungen sind bedeutungsgleich, wenn die durch sie bezeichneten Stationen von allen anderen auf die gleiche Weise zu erreichen sind. Es reicht somit aus, nur die benachbarten Stationen zu betrachten, da für diese hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit von wiederum anderen aus das gleiche gilt. So bildet jede Station die Klasse ihrer Nachbarstationen.
Wir können also die Zugehörigkeit einer jeden Station x zur Klasse a der von einer anderen Station y erreichbaren feststellen und „x ist erreichbar von y.“ schreiben als: ist_erreichbar_von_y(x), bzw. kurz Yx, so daß[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], und es soll gelten: [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], wobei x und z Bezeichnungen sind und [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] deren Bedeutungsgleichheit bzw. Synonymität feststellt (nicht unbedingt aber deren Identität).
Nehmen wir an, unsere natürliche Sprache sei genau so beschaffen. Dann scheint sich vor uns ein auf diese Art nicht lösbares Problem zu erheben: das der Referenz. Wir können zwar sagen, was ein bestimmtes Wort, etwa "Wasser", im erklärten Sinne von "Bedeutung", BEDEUTET; was aber IST dann Wasser?
Carnaps Lösungsversuch
Die Bedeutung eines Wortes innerhalb der Sprache, aus der es entstammt, kann durch Exemplifikation gültiger Konstruktionen aus diesem zumindest umrissen werden, d.h. durch Angabe von, mit diesem Wort in dieser Sprache, bildbaren Sätzen der Form[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], z.B. „Wasser ist Hydroxylsäure.“ oder [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], z.B. „Wasser ist flüssig.“. Die Referenz dieses Wortes hingegen offenbar nicht. Das Bezeichnete ist, so sind wir sofort geneigt anzunehmen, kein Konstrukt, sondern vielmehr ein Phänomen, also etwas Greif-, Sicht- oder allgemein irgendwie Erlebbares. Die Bezeichnung des Erlebten ist selbst hingegen nicht erlebbar, bestenfalls konstruierbar.
Dieser intuitiven Einsicht folgt Carnap: Er will zunächst die Sprache des Erlebens (die psychologische) und die des Bezeichnungssystems (die konstitutionale) streng unterschieden wissen. Letztere soll rein formaler Beschaffenheit sein: sie beschreibt ausschließlich logische Beziehungen, also deren Eigenschaften wie Transitivität, Reflexivität, Symmetrie etc. Die psychologische Sprache soll die in Relation zu setzenden Objekte (resp. Erlebnisse) bezeichnen, nicht aber deren logischen Zusammenhang beschreiben. Sie ist somit eine Sprache ohne Begriffe: sie erklärt die Phänomene nicht über deren Eigenschaften, sondern soll gewissermaßen die Dinge so zeigen, "wie sie sind", ein jedes einzigartig, unteilbar ganz und unveränderlich. Einer seinerzeit populären Ansicht der Gestaltpsychologie folgend, erklärt Carnap diese ursprünglichen "Dinge" als ganzheitliche, komplexe Eindrücke, die er Elementarerlebnisse nennt (im Unterschied zu den, von Anderen propagierten, Elementareindrücken wie etwa "rot", "scharf" o.ä.).
Diese Elementarerlebnisse stehen zunächst in einer Relation "Ähnlichkeit" (symmetrisch, reflexiv, intransitiv) zueinander. Elementarerlebnisse, die in dieser Beziehung zueinander stehen, bilden sogenannte "Ähnlichkeitskreise", d.s. Mengen von Elementarerlebnissen, die zueinander paarweise in der "Ähnlichkeit"-Relation stehen. Die Ähnlichkeitskreise können durch Abstraktion mit Merkmalen von Elementarerlebnissen identifiziert werden.
Das gezeigte Verfahren zu deren Gewinnung ähnelt allerdings eher einer Synthese denn einer Analyse, Carnap spricht daher von "Quasianalyse" und nennt die Merkmale, zur Unterscheidung von echt analytisch gewonnenen, entsprechend "Quasimerkmale". Diese Unterscheidung ist notwendig, da die Elementarerlebnisse, damit die psychologische Sprache auf sie anwendbar bleibt, nicht als aus Merkmalen zusammengesetzt (und damit echt analysierbar) erscheinen dürfen, denn dann hätte diese ja nicht mehr den intendierten "Ding-so-wie-es-ist"-Charakter.
Da Erlebnisse sicher verschiedene (Quasi-)Merkmale aufweisen, ist damit zu rechnen, daß die gezeigten Ähnlichkeitskreise einander überschneiden. Carnap nennt unzerschnitten bleibende, zusammenhängende Bereiche einer Menge sich scheidender Ähnlichkeitskreise "Qualitätskugeln". Deren Vorteil ist, daß die Zuordnung eines Erlebnisses zu diesen eindeutig ist: es gehört entweder zu der einen Qualitätskugel oder zu einer anderen, niemals aber zu mehreren davon. "Wasser" BEDEUTET somit z.B. "Nässe", "Flüssigkeit" u.ä. ("Wasser ist naß", "... flüssig" usw.); Wasser hingegen IST ein einer bestimmten Qualitätskugel zuzuordnendes Erlebnis.
Quines Einwand
Ich habe oben die doch eher merkwürdige Formulierung "Sprache ohne Begriffe" verwandt. Damit sollte angedeutet werden, daß diese Sprache nicht mehrere einzelne Phänomene, d.h. Erlebnisse, unter einer gemeinsamen Bezeichnung subsumiert, sie also nicht schon als in irgendeinem Sinne als ähnlich oder verwandt begreift; sie nicht in Merkmale, hinsichtlich derer sie als vergleichbar bzw. unvergleichbar aufgefaßt werden könnten, aufgliedert, sie somit nicht ihrer Bedeutung nach (ihrer Beziehung zueinander) beschreibt, sondern lediglich bezeichnet, ohne daß diesen Bezeichnungen ein System zugrunde läge. Denn dieses soll auf dem Bezeichneten ja erst errichtet werden. Eine solche unstrukturierte Menge von Bezeichnungen kann daher natürlich höchstens in einem übertragenen Sinne Sprache heißen, da man in ihr offenbar keine sinnvollen (wahre oder falsche) Sätze bilden kann.
Bei rechter Betrachtung ist auch die Sprache der Relationen keine Sprache im eigentlichen Sinne: man kann in ihr zwar gültige wie auch ungültige Konstruktionen durchführen, doch da ihre Terme nichts bezeichnen, weiß sie nicht, wofür ihre Sätze gelten. M.a.W., sie haben keinen praktischen Wert. Ein sinnvolles Kommunikat kann nur ein Satz über einen Gegenstand in seiner Beziehung zu anderen sein. Er ist also eine Operation mit der Bezeichnung des Gegenstandes. Der Sinn dieses Satzes liegt in der Ausführbarkeit oder Nichtausführbarkeit einer äquivalenten Operation mit dem Gegenstand selbst (Es handelt sich sowohl bei Substantiven wie auch bei Verben um Bezeichnungen). Eine sprachliche Operation sei hier die Verbindung von Bezeichnungen zu einem sinnvollen Satz. Die Substantivierung ist eine sprachliche Operation, mit welcher wir das Bezeichnete als Gegenstand unserer Rede zu markieren pflegen.
Was aber ist nun der "Gegenstand selbst"?
Nun, offenbar das, was übrigbleibt, wenn man ihn nicht bezeichnet. Da Sprache jedoch ein System von Bezeichnungen darstellt, kann man naturgemäß über das Unbezeichnete nichts sagen. Genau das ist Quines Argument: Man kann nicht mit der Sprache vor der Sprache arbeiten. Wir mögen uns beispielsweise die unterschiedlichsten Erklärungen dafür ausdenken, was Wasser IST: jede, die nicht darauf hinausläuft, daß es sich um genau das handelt, was das Wort "Wasser" BEDEUTET, ist eine falsche Erklärung (bzw. die Erklärung von etwas, das NICHT Wasser IST) - Was daran liegt, daß jede Erklärung eine sprachliche Operation ist und sich daher nicht auf ein außersprachliches Sein beziehen kann, sondern nur auf Bedeutungen im oben dargelegten Sinne.
Anders gesagt: Die Dinge müssen genau das sein, was ihre Bezeichnungen bedeuten; der Zweifel an diesem Sachverhalt würde uns der Möglichkeit berauben, über die Dinge zu sprechen, und damit auch der, etwas über sie zu wissen.
Umgekehrt heißt das natürlich, das nichts existieren kann, wofür es keine Bezeichnung gibt, denn nur Bezeichnungen haben eine Bedeutung und Bedeutung soll, wie eingangs dargelegt, vor allem als Beziehung zu anderen Bezeichnungen verstanden werden. Wenn also etwas keine Bezeichnung hat, so deshalb, weil es zu nichts in Beziehung steht; die Annahme der Existenz eines solchen Gegenstandes ist somit zumindest überflüssig.
Zu Carnaps Konstitutionssystem
Die Konstitution von Begriffssystemen soll sich, nach Carnaps Vorstellung, einzig durch Anwendung von Relationen auf Elementarerlebnisse vollziehen.
Exemplarisch erläutere ich hier nur die Konstitution der Zeitordnung nach §87 im Logischen Aufbau der Welt, da sie recht unkompliziert ist, dabei jedoch alle für den Fortgang der Argumentation wesentlichen Merkmale aufweist.
Zunächst wird eine Relation "Ähnlichkeitserinnerung" (im folgenden, nach Carnap: Er) konstruiert. Im Unterschied zur "Ähnlichkeit"-Relation ist sie asymmetrisch und transitiv. Diese wählt er zur Grundrelation, da sich "Ähnlichkeit" durch sie darstellen läßt: Die Vereinigung von Er mit ihrer Inversen nennt Carnap "Teilähnlichkeit", welche wiederum transitive Hülle von "Ähnlichkeit" ist.
Die Elementarerlebnisse, die sich in Er befinden, bilden geordnete Tupel. Aus der Transitivität von Er wird dann die Zeitordnung konstruiert. Daß sich alle Elementarerlebnisse in einem Tupel befinden, fordert Carnap nicht. "Zeitnahe Elementarerlebnisse", deren Ähnlichkeit, eben aufgrund der Zeitnähe, einleuchtend ist, werden, weiterhin Ansichten der Gestaltpsychologie folgend, als grundlegend für das Zeitempfinden betrachtet und damit wohl auch für Begriffe wie "vorher", "nachher", "dann" usw. Weitere Abstraktion, d.h. Anwendung verschiedener Relationen, soll dann die gesamte Begrifflichkeit des kontinuierlichen Zeitstroms erbringen, was einleuchtend scheint, da Transitivität und Asymmetrie tatsächlich zur Vorstellung eines gerichteten Stroms gehören, wie sie unserem Zeitbegriff entspricht. Die Forderung lautet also: Es möge Elementarerlebnisse geben, die zueinander in der Relation Er stehen.
Die sogenannten Elementarerlebnisse erweisen sich somit als postulierbar. Was Zeit "in Wirklichkeit" ist, mögen die Elemente der Relation auch Erlebnisse heißen, wird durch deren Heranziehung ebensowenig klar wie unter Verzicht auf diese Hypothese. Vielleicht habe ich Carnap in diesem Punkt falsch verstanden1, doch welchen Sinn sollte die Rede von Psychologie und Erlebnissen haben, wenn nicht den, unsere Begriffe ontologisch zu untermauern? Die Aussage lautet offenbar, daß die Welt genau so beschaffen ist, daß sie uns Erlebnisse mit eben den Eigenschaften liefert, deren Erkenntnis nach den Gesetzen der Logik zu unseren Begriffen führen.
Die sogenannten Elementarerlebnisse kann und muß man sich offenbar so denken, daß sie jeweils zur Erklärung genau dessen taugen, was man damit erklären will. Ihnen darüber hinaus eine Art außersprachlicher Existenz zu unterstellen, würde daher bedeuten, einen naturalistischen Fehlschluß zu begehen. Allerdings ist, wie auch schon im letzten Abschnitt deutlich geworden, die Denknotwendigkeit nicht von der Hand zu weisen.
Eternal Truths
Existenz hat für Quine nicht unbedingt mit (unmittelbarer) Erlebbarkeit zu tun. Er erläutert seine Ansicht, wie ich finde, sehr einleuchtend anhand des Wortes "Molekül": Man kann mit einiger Sicherheit sagen, daß niemand je ein Molekül gesehen, also unmittelbar erlebt hat. Nichtsdestotrotz sind wir in der Lage, sinnvolle, d.h. praktisch relevante Sätze mit diesem Wort zu bilden, und sind im allgemeinen der Ansicht, daß entsprechende Objekte existieren. Objekte unseres unmittelbaren Handelns sind, so Quine in "Word and Object", wesentlich mechanische (also makroskopische) Körper. Um "Molekül" bildet sich offenbar ein Beziehungsgeflecht, welches die Ableitung von Aussagen auch über diese erlaubt, und zwar welche, die anders nicht oder nur schwer darzustellen wären. Darin liegt der praktische Wert des Molekül-Begriffs und damit die Rechtfertigung dafür, einen entsprechenden Gegenstand als existent zu betrachten.
Existieren heißt offenbar wesentlich: von Bedeutung sein, in Beziehung zu etwas (Existentem, d.h. als existent Anerkanntem) stehen; damit auch: Erklärbarkeit, also generelle Prädizierbarkeit. Es heißt darüber hinaus auch, von praktischem Wert zu sein. Pegasus existiert nicht, da wir "Pegasus" nicht erklären können: "Fliegendes Pferd" ist nämlich keine gültige Operation; die Einführung dieser hätte für uns, im Gegensatz zum Molekül (soweit zum heutigen Tage absehbar), keinen Nutzen.
Gültige Operationen können nur jene sein, die nicht bereits bestehenden, sich in der Geschichte des Netzwerks verfestigt habenden (Quine nennt sie "eternal truths") widersprechen. Es besteht keine Möglichkeit eine Verbindung zwischen "fliegen" und "Pferd" herzustellen: Aussagen wie "x ist ein Pferd und x fliegt." widersprechen also einfach den Normen der Wortverwendung, welche allein sichern, daß unsere Worte etwas bedeuten. "Ewige Wahrheiten" sind also normativer Natur. Die Metapher ist daher wohl überlegt gewählt: an die ewige Gültigkeit normativer Aussagen müssen wir glauben, genau dies ist ihr Sinn - in Absehung von der Tatsache, daß sie sich gelegentlich doch ändern.
Die Normen der Wortverwendung nennt man auch analytische Sätze. Sie können nicht instruktiv sein, da man ihre Gültigkeit bereits voraussetzen muß, um die darin vorkommenden Worte sinnvoll verwenden zu können. Sie sind i.allg. nicht übersetzbar, da sie Aussagen über Worte einer Sprache sind, nicht über Sachverhalte, auf welche man sich in demonstrierender, d.h. sprachübergreifender Weise beziehen könnte.
Man könnte einwenden, daß Molekülen (Kräften, Elektrizität etc.) außersprachliche Existenz deshalb zukommt, weil sie zumindest anhand ihrer Wirkungen erlebbar sind. Dazu bringe ich das vielzitierte Exempel der zwanzig Sorten Schnee in einer Eskimosprache: Da diese Menschen mit dieser Vielzahl von Worten umzugehen verstehen, erleben sie wohl auch zwanzig Schneesorten, wo wir nur eine sehen. Es ist hingegen zweifelhaft, ob sie im Stande sind, die Wirkungen eines Moleküls zu erleben. Offensichtlich machen Fragen nach der Existenz keinen Sinn, wenn man sie nicht auf ein konkretes semantisches Netz bezieht. Aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht wäre nunmehr interessant, ob es etwas wie eine Grundlage semantischer Netze gibt, welche für alle Menschen eine gewisse Verbindlichkeit aufweist, d.h. einen gemeinsamen oder zumindest vergleichbaren außersprachlichen Bereich.
Letzte philosophische Fragen
So betitelt Quine eines der letzten Kapitel in den Grundzügen der Logik, in welchen er Fragen der Existenz behandelt.
Wir haben bereits versucht, zwischen unmittelbarem und vermitteltem Erleben zu unterscheiden. Eine Unterscheidung zwischen Sicht-, Greif- und Fühlbarem, ich will es vorläufig Demonstrierbares nennen, und Gegenständen, die nur anhand ihrer Wirkungen aufzeigbar sind, erscheint einleuchtend.
Wenn man betrachtet, wie die verschiedenen Sprachen und Kulturen ihre Welt beschreiben, so muß man feststellen, daß in der Art und Weise der Aufteilung der Welt des Demonstrierbaren weitgehende Beliebigkeit herrscht, daß diese jedoch als Ganzes eine gewisse Geschlossenheit aufzuweisen scheint: Wasser, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist, soweit ich weiß, stets demonstrierbar; verschiedene Sprachen haben mehrere Worte für das, was wir einfach als "Wasser" bezeichnen, andere fassen darunter auch noch andere, mehr oder weniger verwandte Erscheinungen wie Eis oder Schlamm, einig sind sich jedoch anscheinend alle, daß man darauf zeigen und etwas in der Art wie "Das ist..." sagen kann. Quines Beispiel des "Gavagai" will ich hier nicht weiter erläutern; was immer "gavagai" im Einzelnen bedeutet, es handelt sich offenbar um etwas, worauf man zeigen kann. Sätze wie "Das ist Elektrizität.", "Das ist ein Molekül." hingegen kann man nur in einem gewissen übertragenen Sinne gebrauchen: Man kann weder auf die Elektrizität noch auf ein Molekül zeigen; das eventuell Gezeigte sind dann Wirkungen oder Modelle des Gemeinten (was durchaus immer wieder Anlaß zu Mißverständnissen bietet).
Das unter Äußerung eines Satzes der Gestalt "Das ist..." aufgezeigte nennt Quine den Stimulus. Der Spracherwerber wird in die Hermeneutik der Sprachbenutzer eingebunden, indem er durch, so Quine, sozialen Druck (d.s. Belohnung und Strafe) zur Äußerung eines bestimmten Satzes bzw. Satzworts2 bei Auftreten einer bestimmten Art Stimulus konditioniert wird. Es besteht also danach eine Disposition zur Äußerung dieses Satzes, die jeweils durch das Auftreten eines entsprechenden Stimulus aktiviert wird. Die Art der Stimuli, die die Disposition zur Äußerung eines gewissen Satzes aktivieren können, nennt Quine die Stimulusbedeutung (stimulus meaning) dieses Satzes. Dabei verhält sich die Stimulusbedeutung zum Stimulus wie ein Prädikat zu seinem Subjekt in wahren Aussagen; der geäußerte Satz selbst ist demnach eine Klassenbezeichnung.
Wir sehen also den Begriff des Elementarerlebnisses durch den des Stimulus ersetzt. Wiederum erweist sich dessen Existenz als Denknotwendigkeit, jedoch begeht Quine nicht den Fehler, aus der ungeklärten und nicht klärbaren Natur der Noumena Schlüsse zu ziehen; er begnügt sich mit deren Feststellung. Den Zwängen der Logik sind erst die konditionierten Sätze unterworfen, damit aber auch die Existenzannahmen: Die letzten philosophischen Fragen führen, seiner Ansicht nach, zu Aussagen der Gestalt [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
Attribute und Prädikate
Ich habe oben die Äquivalenz einer Klassenbezeichnung mit dem Abstraktum über einem Prädikat festgestellt: [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. Quine nennt dies das Abstraktionsprinzip, welches erlaubt, die Ausdrücke x0a und Yx ebenfalls als äquivqalent zu behandeln, so daß „Wasser ist naß.“ das gleiche bedeutet wie „Wasser hat Nässe.“. Mit Quine gehe ich davon aus, daß es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen beiden Formulierungen gibt.
Darüber hinaus kann die Element-Beziehung x0a als geordnetes Paar (x, a) aufgefaßt werden, welches seinerseits wieder als Klasse ausdrückbar ist, indem man zunächst eine Klasse {x, a} bildet und mit dieser wiederum eine Klasse {x, {x, a}}, und somit einen abstrakten Gegenstand erhält. So kann ich „die Nässe des Wassers“ als Bezeichnung des durch den Satz „Wasser ist naß.“ zum Ausdruck gebrachten Sachverhalts als Gegenstand der Rede betrachten. Die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Attributen und Prädikaten, erlaubt daher auch die jener zwischen Gegenstandsbezeichnungen und Sätzen. Beide werden ohnedies nicht in allen Sprachen mit einiger Konsequenz durchgeführt.
Das Abstraktionsprinzip kann gelesen werden als „Die Gegenstände x, auf welche ein Prädikat Y angewandt werden kann, bilden eine Klasse a.“ oder auch als „Ein Gegenstand a ist eine Klasse von Gegenständen x, auf welche ein bestimmtes Prädikat Y angewandt werden kann.“. „Erste Gegenstände“, d.h. Individuen, sind somit aus Sicht der Logik Postulate. Die Existenz von Satzworten mit Stimulusbedeutung ist eine Hypothese der Allgemeinen und Vergleichenden Sprachwissenschaft. Die Frage, warum der durch diese Stimulusbedeutungen abgedeckte Bereich der Wirklichkeit von Sprache zu Sprache eine gewisse Konstanz aufweist, wäre jedoch an die empirische Anthropologie zu richten.
Fabric of Sentences
Zu klären wäre ferner, auf welche Weise diese "Stimuli" Klassen bilden. Eine Idee dazu liegt in den Betrachtungen über den Zusammenhang zwischen Existenz von Gegenständen und dem praktischen Wert der Begriffe von diesen.
Was nämlich außer der Stimulusbedeutung im Prozeß der Konditionierung erworben wird, sind Sätze über den Gegenstand, d.s. nichtdemonstrierbare Gegenstände, über welche der Begriff ins semantische Netz eingewoben wird. Im letzten Abschnitt und auch a.a.O. haben wir festgestellt, daß aus der Beschaffenheit der Stimuli selbst nichts folgen kann, da logisches Folgern nur im Bereich sprachlicher Operationen möglich ist; daher ist die bloße Bezeichnung praktisch bedeutungslos; sie eignet sich lediglich zum Report über das Vor-Sich-Gehende („the fancifully fancyless medium of unvarnished news“), nicht jedoch zu dessen Reflexion - mithin wäre auch, wie gezeigt, durchaus die Existenz des Bezeichneten fraglich.
Die nichtdemonstrierbaren Gegenstände sind die Erklärungen des Begriffs vom Bezeichneten, somit definieren sie die Bedingungen der Verwendung der Bezeichnung3. Die Stimulusbedeutung der Bezeichnung (des "Ein-Wort-Satzes") bildet, wie gesagt, einer Klasse von Stimuli, deren Unterschiedlichkeit die Definition der Bedingungen der Verwendung dieser Bezeichnung Rechnung tragen muß, d.h. sie definieren Typen von Situationen für gültige Verwendungen. Für die Bezeichnungen nichtdemonstrierbarer Gegenstände gilt das nämliche, so daß wir es mit einem sich sukzessive aufbauenden Geflecht von Bezeichnungen (also Sätzen über andere Bezeichnungen - "fabric of sentences") zu tun haben.
Da, wo der sich so entfaltende Bedeutungsbaum einer gegebenen Bezeichnung wiederum auf Demonstrierbares stößt, kann dessen Stimulusbedeutung der der gegebenen Bezeichnung hinsichtlich der bestehenden Beziehung hinzugefügt werden. Nochmals zum Beispiel Wasser: "Wasser ist flüssig." ist eine Ewige Wahrheit (im umgangssprachlichen Sinne des Wortes; in einem eher wissenschaftlichen Kontext könne auch andere Aggregatzustände als „Wasser“ bezeichnet werden), somit für die Bedeutung von "Wasser." konstitutiv; das gleiche gilt z.B. auch für "Milch.", es läßt sich also über die Bezeichnung "Flüssigkeit" ein Weg von "Wasser." zu "Milch." finden, deren Stimulusbedeutung somit zu einem Teil derer von Wasser werden kann, sofern das nicht anderen Ewigen Wahrheiten widerspricht (also wesentlich hinsichtlich "Flüssigkeit", "Nässe" u.ä. nicht jedoch etwa hinsichtlich "Klarheit"). Daraus ergibt sich, daß nur vergleichsweise wenige Stimuli zu je einer Stimulusbedeutung konditioniert werden müssen; ein großer Teil einer Stimulusbedeutung kann anhand der logischen Bedeutung aus anderen Stimulusbedeutungen konstruiert werden4.
Elimination singulärer Termini
Betrachten wir nun den Satz "Sokrates." bzw. "Das ist Sokrates.".
Hinsichtlich seiner Stimulusbedeutungen handelt es sich bei "Sokrates" um eine Klassenbezeichnung. Einige der darunter begriffenen Stimuli sind konditioniert (anhand derer man z.B. "typische" Körperhaltungen des Sokrates ausmachen kann), andere konstruktiv gewonnen (z.B. unter Vermittlung der Ewigen Wahrheit "Sokrates ist ein Mensch."). Da wir auf die Unzahl der Stimuli, die in der Klasse "Sokrates" von Stimulusbedeutungen umfaßt sind, nicht einzeln oder gruppenweise zugreifen können, ohne mit den Mitteln unserer Sprache deren Grenzen zu überschreiten, was uns, wie gesagt, nicht erlaubt ist, scheint uns dieser Terminus als ein singulärer, d.h. er bezeichnet etwas, das wir aufgrund seiner begrifflichen Unauflöslichkeit zunächst auch als "in Wirklichkeit" unauflöslich betrachten müssen.
Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Eigenschaft des Sokrates selbst (über die Eigenschaften des Sokrates selbst wissen wir nichts), sondern um eine grammatische Eigenschaft von Eigennamen; sie folgt also aus den Eigenschaften des konkreten semantischen Netzes (der konkreten Sprache), in welches die Bezeichnung eingebunden ist. Mit Quine halte ich es daher für sinnvoll, den Begriff des singulären Terminus aus der Wissenschaft der Logik zu verbannen, er gehört offenbar in die Grammatikschreibung5. Auf diese Weise können wir zu einer allgemeineren Formulierung der Logik gelangen, die uns auch erlaubt, natürliche Sprachen zu beschreiben, die über keine Eigennamen verfügen.
Darüber hinaus erhalten wir die Möglichkeit, den Wahrheitswert von Sätzen wie "Pegasus fliegt." zu bestimmen. Wir analysieren diesen nunmehr folgendermaßen: Es muß ein Gegenstand x aufweisbar sein, so daß "x 0 Pegasus [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] fliegt(x)" wahr wird. Diese Formulierung wird möglich, wenn wir Stimuli als Gegenstände zulassen und Eigennamen als Bezeichnungen für Stimulusbedeutungen, d.s. Klassen von Stimuli betrachten. Da zur Bedeutung von "Pegasus" eine verbotene Operation gehört, muß seine Stimulusbedeutung nach Definition, d.h. nach geltender Norm der Wortverwendung, leer sein denn das Wort "Pegasus" darf auf keinen Stimulus angewendet werden, da dies gegen mindestens eine Ewige Wahrheit verstoßen würde. Folglich ist der Satz "Pegasus fliegt." stets falsch. (Innerhalb eines geeigneten anderen semantischen Netzes mag das selbstverständlich gänzlich anders aussehen, an dem unserer Sprache jedoch müßten umfangreiche Veränderungen vorgenommen werden, um diese Operation zu ermöglichen.) Als analytischer Satz, d.h. eine Aussage über die Bedeutung von „Pegasus“, bleibt er natürlich wahr.
[...]
1 Aus der "Forderung zur Rechtfertigung und zwingenden Begründung einer jeden These ergibt sich die Ausschaltung des spekulativen, dichterischen Arbeitens in der Philosophie...", legt Carnap in der Einleitung zum Aufbau dar. Offenbar mißversteht er Philosophie als paradigmengeleitete Wissenschaft, was mich in meiner oben geäußerten Ansicht bestärkt. Leider würde eine eingehendere Erörterung des Philosophiebegriffs den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, daher nur diese Fn.
2 Quines Auffassung zufolge ist die kleinste Einheit der natürlichen Sprache der (geäußerte) Satz (an anderer Stelle auch "Kommunikat")
3 Es ist wohl anzunehmen, daß diese Bedingungen nicht alle gleichrangig zueinander sind: einige davon sind Ewige Wahrheiten, aber nicht alle. Die Rangordnung der Bedingungen hängt vom Kontext der Erwähnung ab, d.h. davon, welche Feststellungen über den Gegenstand bereits getroffen wurden.
4 Vorschlag für eine prototypensemantische Interpretation: Die konditionierten Stimuli bilden den Prototypen, die konstruierten, je nach Komplexität der Konstruktion, dessen weiter entfernte Herrschaftsbereiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema von "Über Carnap und Quine"?
Der Text "Über Carnap und Quine" behandelt die Auseinandersetzung zwischen Carnaps Konstitutionssystem und Quines Kritik daran, insbesondere hinsichtlich der Probleme der Referenz, der Bedeutung von Sprache und der Konstitution von Begriffen.
Was versteht Carnap unter "Netzwerksemantik"?
Carnap verwendet das Bild eines Eisenbahnnetzes, um zu verdeutlichen, dass die Bedeutung einer Bezeichnung (Bahnhof) durch die Menge der Schrittfolgen (Wege) zu anderen Bezeichnungen (Bahnhöfen) bestimmt ist. Die Bedeutung liegt also in den Beziehungen innerhalb des Netzwerks, nicht in der einzelnen Explikation jeder Bezeichnung.
Was ist Carnaps Lösungsversuch für das Problem der Referenz?
Carnap unterscheidet strikt zwischen der Sprache des Erlebens (psychologische Sprache) und der des Bezeichnungssystems (konstitutionale Sprache). Die psychologische Sprache soll Elementarerlebnisse bezeichnen, während die konstitutionale Sprache die logischen Beziehungen beschreibt. Er versucht, die Referenz durch Zuordnung von Erlebnissen zu Qualitätskugeln zu erklären.
Was kritisiert Quine an Carnaps Ansatz?
Quine argumentiert, dass man nicht mit der Sprache vor der Sprache arbeiten kann. Man kann nicht versuchen, das Wesen von Dingen (z.B. Wasser) unabhängig von ihrer sprachlichen Bedeutung zu bestimmen. Die Dinge sind das, was ihre Bezeichnungen bedeuten.
Was sind "Eternal Truths" nach Quine?
"Eternal Truths" sind normative Aussagen, die die Normen der Wortverwendung darstellen. Sie sind analytische Sätze, deren Gültigkeit vorausgesetzt werden muss, um die darin vorkommenden Worte sinnvoll verwenden zu können.
Wie erklärt Quine die Existenz von Begriffen wie "Molekül"?
Quine argumentiert, dass die Existenz eines Begriffs (z.B. Molekül) durch seine Bedeutung, seine Beziehungen zu anderen Begriffen und seinen praktischen Wert gerechtfertigt ist. Es geht nicht um die unmittelbare Erlebbarkeit, sondern um die Fähigkeit, sinnvolle und relevante Sätze damit zu bilden.
Was ist die Rolle des "Stimulus" nach Quine?
Der Stimulus ist das, worauf man unter Äußerung eines Satzes wie "Das ist..." zeigt. Die Stimulusbedeutung eines Satzes ist die Art der Stimuli, die die Disposition zur Äußerung dieses Satzes aktivieren. Quine ersetzt den Begriff des Elementarerlebnisses durch den des Stimulus.
Wie behandelt Quine Attribute und Prädikate?
Quine sieht keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Attributen und Prädikaten. Er befürwortet das Abstraktionsprinzip, welches erlaubt, Ausdrücke wie "x ist a" und "x hat a" als äquivalent zu behandeln.
Was ist das "Fabric of Sentences" (Geflecht von Sätzen)?
Das "Fabric of Sentences" beschreibt, wie Begriffe durch Sätze über andere Bezeichnungen miteinander verknüpft werden. Die Bedeutung eines Begriffs ergibt sich aus dem Geflecht von Sätzen, in das er eingebunden ist.
Wie eliminiert Quine singuläre Termini?
Quine schlägt vor, den Begriff des singulären Terminus aus der Logik zu verbannen und ihn der Grammatik zuzuweisen. Er betrachtet Eigennamen als Bezeichnungen für Stimulusbedeutungen, d.h. Klassen von Stimuli.
- Quote paper
- Wolfgang Schmeißer (Author), 1999, Über Carnap und Quine - strukturalistische Abstraktionstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95898