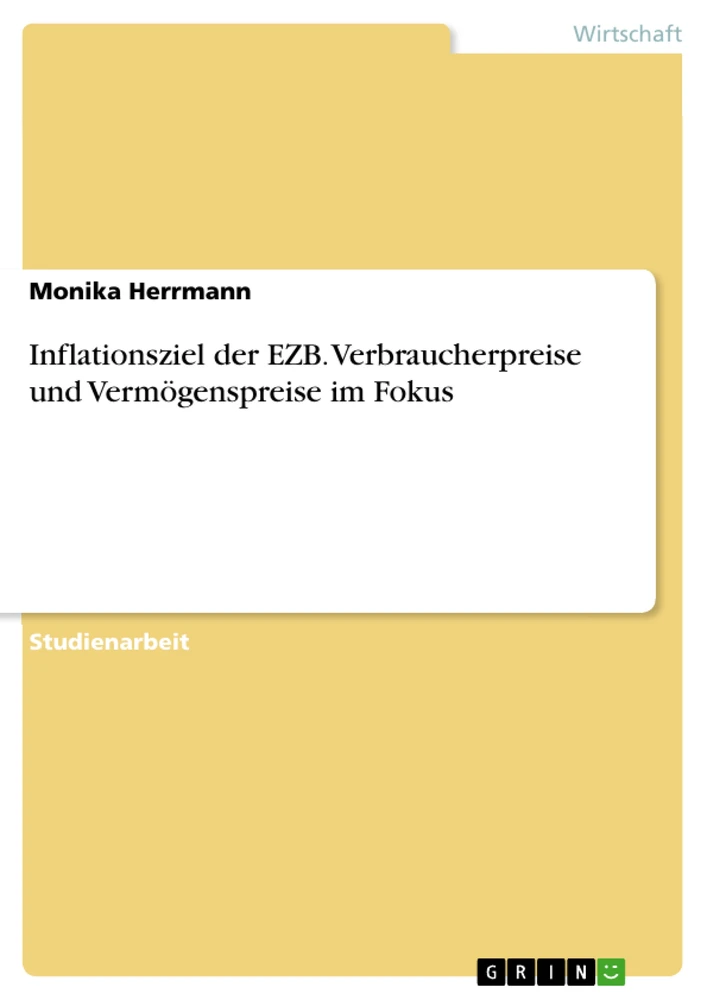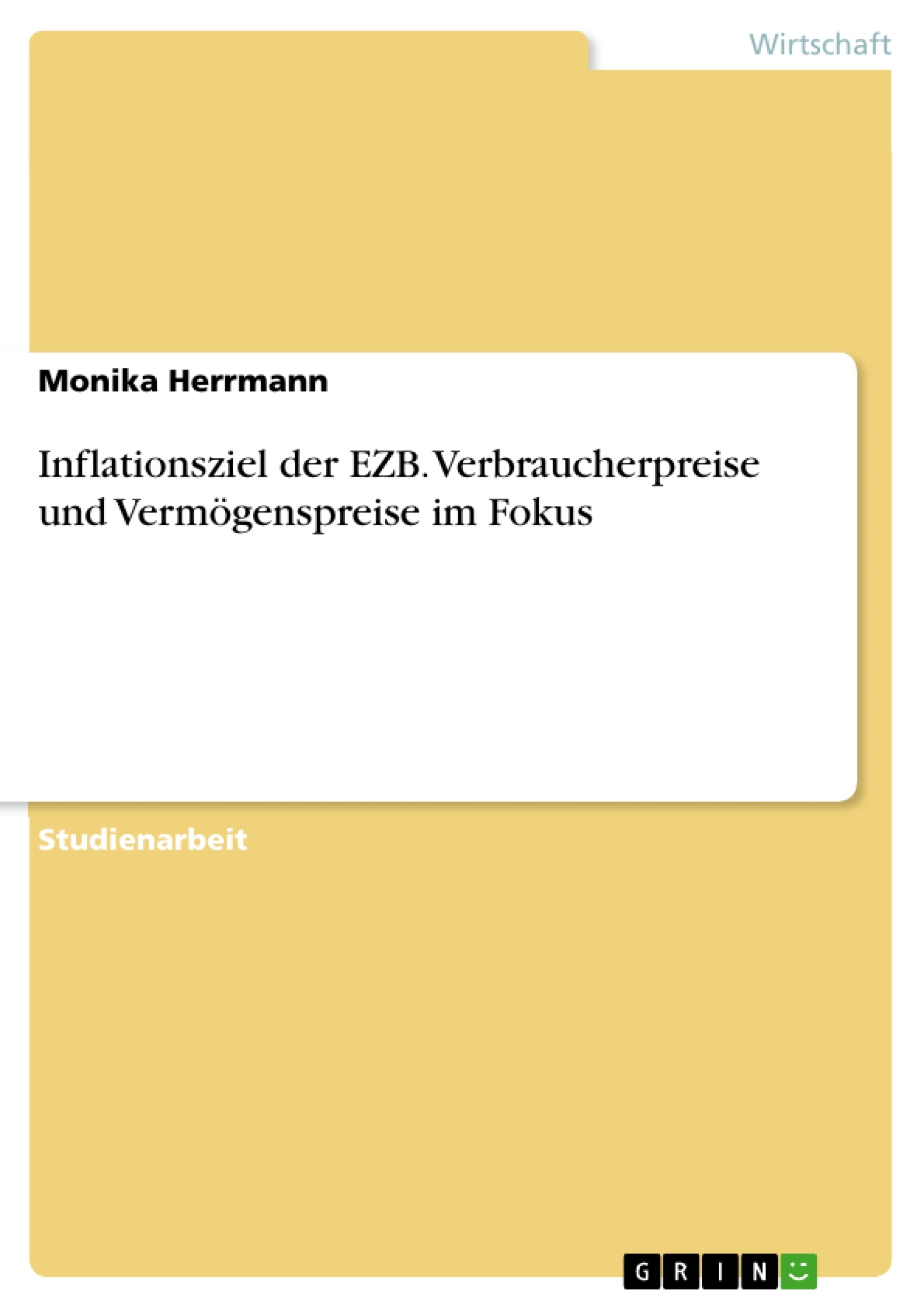In der Seminararbeit wird untersucht, ob die aktuelle Zielvorgabe EZB hinsichtlich der Preisstabilität in der Eurozone noch zeitgemäß ist und Lösungsansätze diskutiert.
Am 1. Januar 1999 übernahm die EZB die Verantwortung für die Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet mit dem vorrangigen Ziel, die Preisstabilität zu gewähren. Konkretisiert wurde im Jahr 2003, dass bei der Verfolgung dieses Ziels die Bestrebung besteht, die Teuerungsrate gemessen am HVPI im Eurogebiet mittelfristig unter, aber nahe zwei Prozent zu halten. Trotz extremer Zinssenkungen, wurde dieses oberste Ziel in den letzten sieben Jahren durch die EZB nicht mehr nachhaltig erreicht. Um die negativen Auswirkungen auf wirtschaftliche Entwicklung einzudämmen, nutzte daher die EZB bereits ab 2015 nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise sowie in der aktuellen Corona-Pandemie auch unkonventionelle geldpolitische Instrumente, wie den massiven Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen. Hierdurch wurde die EZB in der Öffentlichkeit stark kritisiert, da die Skeptiker durch die Staatsanleihekäufe eine indirekte Staatsfinanzierung sehen, was aber gegen den Grundsatz der Unabhängigkeit der EZB sprechen würde. Die Richter des Bundesgerichtshofes urteilten zwar im Mai 2020, dass die EZB die Auswirkungen dieser Maßnahmen nicht auf Ihre Verhältnismäßigkeit geprüft hatte, allerdings stellten Sie die Anleihekäufe nicht grundsätzlich in Frage. Da nur der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln für die EZB verboten ist, nicht aber die durchgeführten Käufe am Sekundärmarkt und sich die EZB jederzeit frei entscheiden konnte, in welcher Höhe die Anleihen gekauft werden, ist auch nach Ansicht von Ökonomen die Kontrolle über die Geldbasis jederzeit gewährleistet.
Doch auch diese Maßnahmen brachten bislang nicht den gewünschten Anstieg der Verbraucherpreise auf die vorgesehene Zielmarke von knapp unter zwei Prozent. Die Vermögenspreise hingegen steigen seit Jahren. Da es für Anleger aufgrund der niedrigen bzw. negativen Zinsen nicht mehr lukrativ ist, in Geldwerte wie Anleihen oder Tagesgeld zu investieren, fließt das Kapital in Aktien, Immobilien und sonstige Sachwerte, was dort aufgrund der gestiegenen Nachfrage zu deutlichen Preissteigerungen führt. Die Teuerungen der Vermögenswerte wiederum werden jedoch nicht im HVPI berücksichtigt, an dessen Entwicklung die EZB gemessen wird. Die andauernde Zielverfehlung nagt in-zwischen an der Glaubwürdigkeit der EZB.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Rolle der Europäischen Zentralbank
- 2.1. Der institutionelle und rechtliche Rahmen
- 2.2. Aufgaben der EZB, des Eurosystems und des ESZB
- 2.3. Geldpolitische Ziele, Strategie und deren Umsetzung
- 3. Die Untersuchung des Inflationsziels der EZB
- 3.1. Gründe für ein Inflationsziel
- 3.2. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex
- 3.3. Gegenüberstellung der Verbraucher- und Vermögenspreisentwicklung
- 3.4. Bewertung
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Aktualität des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) und die adäquate Repräsentation der subjektiv wahrgenommenen Preisentwicklung durch den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), insbesondere im Hinblick auf die Vermögenspreisentwicklung. Die Arbeit analysiert die Rolle der EZB im Kontext ihrer geldpolitischen Ziele und Strategien und bewertet die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung.
- Die Rolle der EZB und ihr institutioneller Rahmen
- Das Inflationsziel der EZB und seine Begründung
- Die Berücksichtigung von Verbraucher- und Vermögenspreisen im HVPI
- Die Wirksamkeit der geldpolitischen Maßnahmen der EZB
- Die Glaubwürdigkeit der EZB angesichts der Zielverfehlung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Inflationsziels der EZB ein. Sie hebt die Herausforderungen der letzten Jahre hervor, in denen die EZB trotz extremer Zinssenkungen ihr Inflationsziel nicht nachhaltig erreicht hat. Die zunehmende Nutzung unkonventioneller geldpolitischer Instrumente wie Anleihekäufe wird angesprochen, ebenso die damit verbundene Kritik und die rechtlichen Aspekte. Die Einleitung skizziert die Fragestellung der Arbeit, die sich mit der Aktualität des Inflationsziels und der Repräsentativität des HVPI befasst. Schließlich werden die Struktur und die methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert.
2. Die Rolle der Europäischen Zentralbank: Dieses Kapitel beschreibt die institutionelle und rechtliche Grundlage der EZB und des Eurosystems. Es beleuchtet die Aufgaben der EZB, des Eurosystems und des ESZB, und analysiert die geldpolitischen Ziele, die Strategie und deren Umsetzung im Detail. Es legt den Fokus auf den institutionellen Rahmen und die rechtlichen Grundlagen, welche die Handlungsfähigkeit der EZB bestimmen. Die Komplexität des Systems und die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Akteuren werden hier detailliert dargestellt.
3. Die Untersuchung des Inflationsziels der EZB: Dieses Kapitel analysiert eingehend das Inflationsziel der EZB und dessen Begründung. Es untersucht den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) als Messinstrument und stellt die Entwicklung der Verbraucher- und Vermögenspreise gegenüber. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bewertung der Diskrepanz zwischen der Entwicklung der Verbraucherpreise und der Vermögenspreise und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Geldpolitik der EZB und ihre Glaubwürdigkeit. Die kritische Auseinandersetzung mit den verwendeten Messmethoden und deren Grenzen bildet einen zentralen Bestandteil dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Inflationsziel, Preisstabilität, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI), Vermögenspreise, Geldpolitik, Eurosystem, unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen, Staatsanleihekäufe, Glaubwürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Die Aktualität des Inflationsziels der EZB
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Aktualität des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Frage, wie gut der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) die subjektiv empfundene Preisentwicklung, insbesondere im Vergleich zur Vermögenspreisentwicklung, widerspiegelt. Analysiert werden die Rolle der EZB, ihre geldpolitischen Ziele und Strategien sowie die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der EZB und ihren institutionellen Rahmen, das Inflationsziel der EZB und seine Begründung, die Berücksichtigung von Verbraucher- und Vermögenspreisen im HVPI, die Wirksamkeit der geldpolitischen Maßnahmen der EZB und die Glaubwürdigkeit der EZB angesichts möglicher Zielverfehlungen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Rolle der Europäischen Zentralbank, ein Kapitel zur Untersuchung des Inflationsziels der EZB und eine Schlussbemerkung. Das Kapitel zur EZB beschreibt den institutionellen und rechtlichen Rahmen, die Aufgaben der EZB, des Eurosystems und des ESZB sowie die geldpolitische Strategie. Das Kapitel zum Inflationsziel analysiert den HVPI, vergleicht Verbraucher- und Vermögenspreise und bewertet die Diskrepanzen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Methodik. Die Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird das Inflationsziel der EZB in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die Begründung des Inflationsziels, untersucht den HVPI als Messinstrument und vergleicht die Entwicklung der Verbraucher- und Vermögenspreise. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bewertung der Diskrepanz zwischen beiden und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Geldpolitik und die Glaubwürdigkeit der EZB. Die verwendeten Messmethoden und deren Grenzen werden kritisch beleuchtet.
Welche Rolle spielt der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)?
Der HVPI dient als zentrales Messinstrument zur Erfassung der Preisentwicklung. Die Arbeit untersucht, inwieweit der HVPI die subjektiv wahrgenommene Preisentwicklung und insbesondere die Entwicklung der Vermögenspreise adäquat widerspiegelt. Die Arbeit analysiert mögliche Diskrepanzen und deren Bedeutung für die Geldpolitik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Zentralbank (EZB), Inflationsziel, Preisstabilität, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI), Vermögenspreise, Geldpolitik, Eurosystem, unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen, Staatsanleihekäufe, Glaubwürdigkeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Text der Seminararbeit selbst nachzulesen und können hier nicht vollständig zusammengefasst werden. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet jedoch einen Einblick in die behandelten Aspekte und die Richtung der Argumentation.)
- Quote paper
- Monika Herrmann (Author), 2020, Inflationsziel der EZB. Verbraucherpreise und Vermögenspreise im Fokus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958887