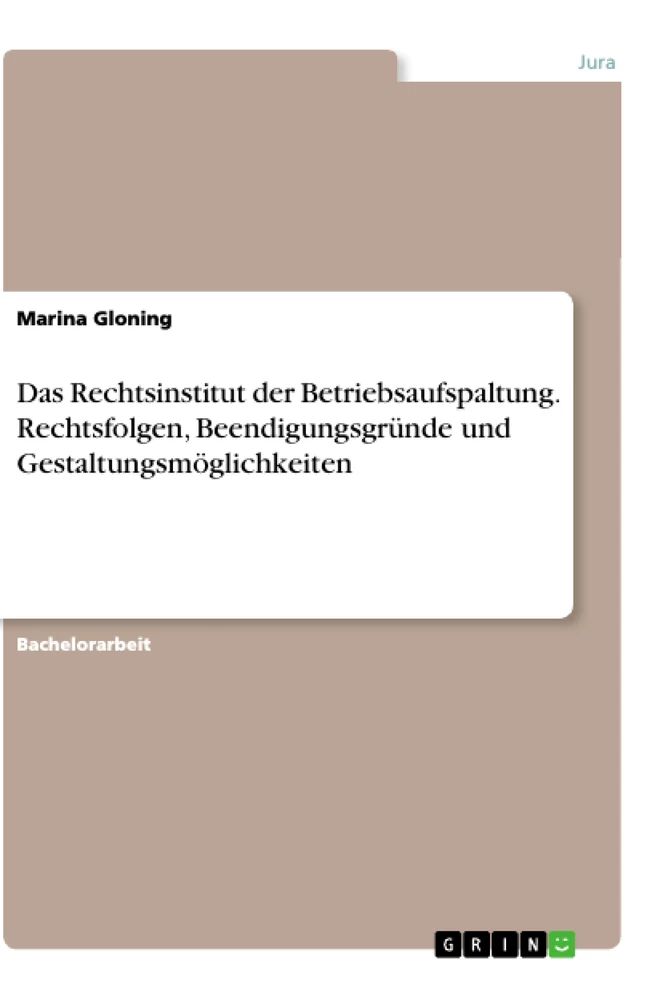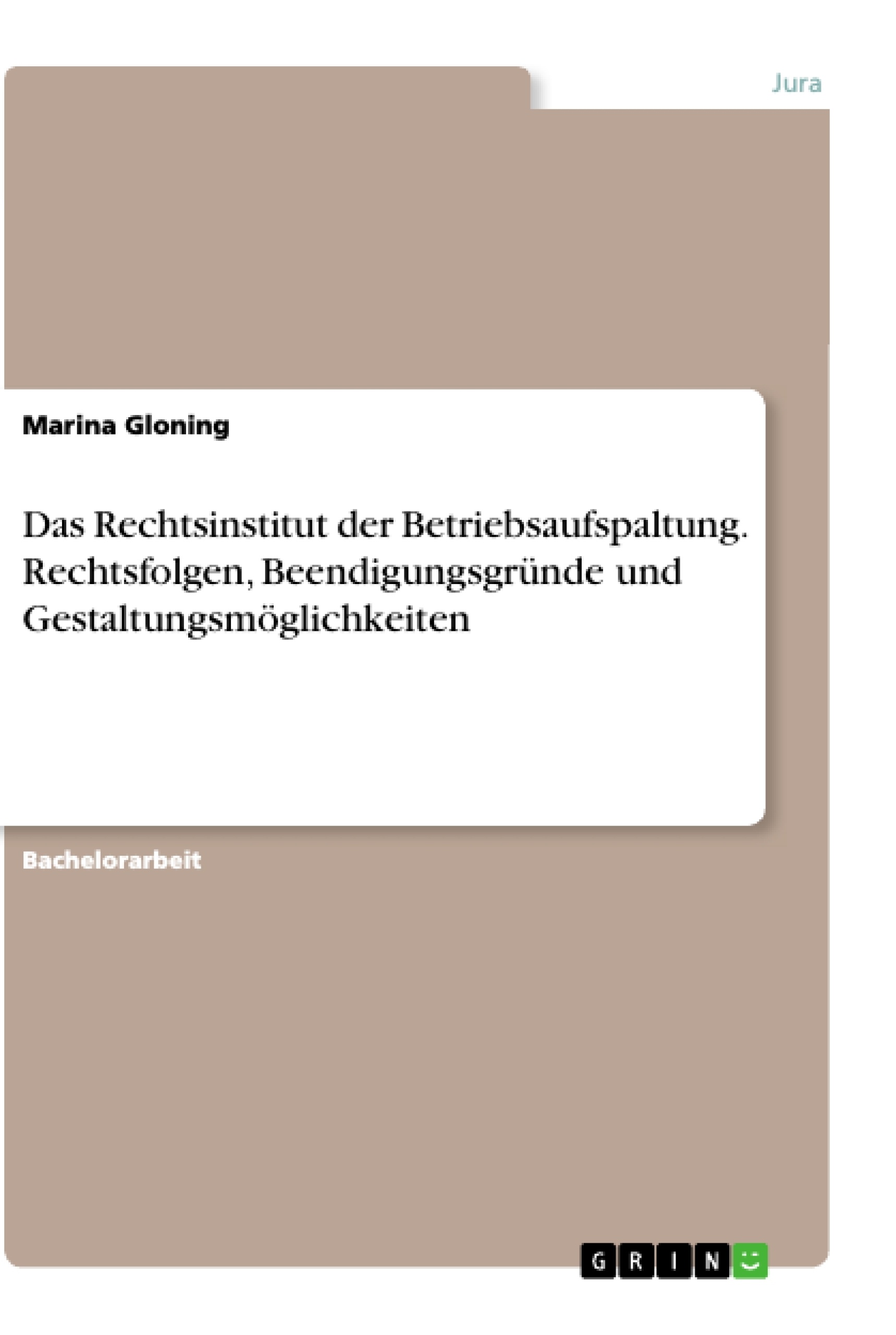Die Arbeit beschreibt das durch Rechtsprechung entstandene Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung in ihren Grundzügen. Hierbei werden die Rechtsfolgen der klassischen Betriebsaufspaltung genau untersucht. Es erfolgt eine besondere Betrachtung der Gründe für eine ungewollte Beendigung der klassischen Betriebsaufspaltung und deren ertragsteuerlichen Folgen. Des Weiteren werden Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung der Beendigung der Betriebsaufspaltung aufgezeigt. Zur Verdeutlichung und Herstellung der Praxisnähe werden die einzelnen Kapitel von einem Fallbeispiel begleitet, das im zweiten Kapitel mit der Entstehung der Betriebsaufspaltung und in Kapitel sechs mit den Vermeidungsstrategien zur Aufdeckung von stillen Reserven endet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Arten der Betriebsaufspaltung
- Einteilung nach Art der Entstehung
- Einteilung nach der Rechtsform
- Die klassische Betriebsaufspaltung
- Die umgekehrte Betriebsaufspaltung
- Die kapitalistische Betriebsaufspaltung
- Die mitunternehmerische Betriebsaufspaltung
- Entstehung Fallbeispiel
- Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung
- Sachliche Verflechtung
- Unbewegliche Wirtschaftsgüter
- Bewegliche Wirtschaftsgüter
- Immaterielle Wirtschaftsgüter
- Personelle Verflechtung
- Beteiligungsidentität
- Beherrschungsidentität
- Gruppentheorie bei Ehegatten und Kindern
- Einstimmigkeits- und Mehrheitsprinzip
- Faktische Beherrschung
- Mittelbare Beherrschung
- Weiterentwicklung Fallbeispiel
- Rechtsfolgen der klassischen Betriebsaufspaltung
- Grundsätzliches
- Rechtsfolgen im Besitzunternehmen
- Buchführungspflicht und Gewinnermittlung
- Betriebsvermögen
- Umqualifizierung der Einkünfte
- Gewerbesteuerpflicht
- Besteuerung der Betriebskapitalgesellschaft
- Vor- und Nachteile der Begründung einer klassischen Betriebsaufspaltung
- Außersteuerliche Motive
- Steuerliche Motive
- Nachteile der klassischen Betriebsaufspaltung
- Fallbeispiel
- Gründe und steuerliche Folgen der Beendigung der Betriebsaufspaltung
- Wegfall der Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung
- Sachliche Entflechtung
- Personelle Entflechtung
- Steuerrechtliche Folgen der Beendigung der Betriebsaufspaltung
- Fallbeispiel
- Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven bei Beendigung der klassischen Betriebsaufspaltung
- Fallbeispiel
- Gestaltungsmöglichkeiten
- Eigengewerbliche Betätigung des Besitzunternehmens
- Überlagerte Betriebsverpachtung im Ganzen
- Betriebsunterbrechung
- Einbringung des Besitzunternehmens in eine Kapitalgesellschaft
- Umwandlung der Betriebskapitalgesellschaft auf das Besitzunternehmen
- Einbringung des Besitzunternehmens in eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG
- Fazit
- Theoretische Schlussfolgerung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung. Ziel ist es, die verschiedenen Arten der Betriebsaufspaltung zu beleuchten, die Voraussetzungen ihrer Entstehung zu definieren und die steuerlichen Rechtsfolgen zu analysieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Beendigung der Betriebsaufspaltung und den Möglichkeiten, stille Reserven zu vermeiden.
- Arten der Betriebsaufspaltung (klassisch, umgekehrt, kapitalistisch, mitunternehmerisch)
- Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung (sachliche und personelle Verflechtung)
- Steuerliche Rechtsfolgen der Betriebsaufspaltung
- Beendigung der Betriebsaufspaltung und deren steuerliche Konsequenzen
- Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von stillen Reserven bei Beendigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Betriebsaufspaltung ein, beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit sowie die gewählte Vorgehensweise.
Arten der Betriebsaufspaltung: Dieses Kapitel differenziert die Betriebsaufspaltung nach Entstehungsart und Rechtsform, beleuchtet die klassischen, umgekehrten, kapitalistischen und mitunternehmerischen Modelle und illustriert diese anhand eines Fallbeispiels. Die verschiedenen Arten werden im Detail hinsichtlich ihrer Strukturen und Charakteristika verglichen, um ein umfassendes Verständnis der Vielfalt dieses Rechtsinstituts zu ermöglichen.
Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung: Hier werden die notwendigen Bedingungen für das Bestehen einer Betriebsaufspaltung eingehend untersucht. Die sachliche Verflechtung, betreffend unbewegliche, bewegliche und immaterielle Wirtschaftsgüter, wird ebenso detailliert analysiert wie die personelle Verflechtung, inklusive Beteiligungs- und Beherrschungsidentität sowie Gruppentheorie, Einstimmigkeitsprinzip und die faktische sowie mittelbare Beherrschung. Ein Fallbeispiel veranschaulicht die Anwendung dieser Kriterien.
Rechtsfolgen der klassischen Betriebsaufspaltung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die steuerlichen Konsequenzen der klassischen Betriebsaufspaltung. Es behandelt die Rechtsfolgen im Besitzunternehmen (Buchführung, Gewinnermittlung, Betriebsvermögen, Einkünfteumqualifizierung, Gewerbesteuerpflicht) und in der Betriebskapitalgesellschaft. Vor- und Nachteile der Betriebsaufspaltung, sowohl steuerlicher als auch außersteuerlicher Natur, werden abgewägt und durch ein Fallbeispiel verdeutlicht.
Gründe und steuerliche Folgen der Beendigung der Betriebsaufspaltung: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für die Beendigung einer Betriebsaufspaltung, insbesondere den Wegfall der sachlichen und personellen Verflechtung. Die steuerlichen Auswirkungen dieser Beendigung werden umfassend beleuchtet und durch ein Fallbeispiel illustriert.
Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven bei Beendigung der klassischen Betriebsaufspaltung: Der Fokus liegt auf Strategien zur Vermeidung der Aufdeckung stiller Reserven im Kontext der Beendigung einer klassischen Betriebsaufspaltung. Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, wie die eigengewerbliche Betätigung des Besitzunternehmens, überlagerte Betriebsverpachtung, Betriebsunterbrechung, Einbringung in Kapitalgesellschaften und Umwandlungen, werden detailliert vorgestellt und anhand von Fallbeispielen erörtert.
Schlüsselwörter
Betriebsaufspaltung, Rechtsfolgen, Steuerrecht, Sachliche Verflechtung, Personelle Verflechtung, stille Reserven, Beendigung, Gestaltungsmöglichkeiten, Besitzunternehmen, Betriebskapitalgesellschaft, klassische Betriebsaufspaltung, umgekehrte Betriebsaufspaltung, kapitalistische Betriebsaufspaltung, mitunternehmerische Betriebsaufspaltung.
FAQ: Betriebsaufspaltung - Eine umfassende Übersicht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit befasst sich umfassend mit dem Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung. Sie untersucht die verschiedenen Arten, die Voraussetzungen für deren Entstehung und die daraus resultierenden steuerlichen Folgen.
Welche Arten der Betriebsaufspaltung werden behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen der klassischen, der umgekehrten, der kapitalistischen und der mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung. Jede Art wird hinsichtlich ihrer Struktur und Charakteristika detailliert beschrieben und verglichen.
Welche Voraussetzungen müssen für eine Betriebsaufspaltung erfüllt sein?
Die Arbeit analysiert die sachliche Verflechtung (unbewegliche, bewegliche und immaterielle Wirtschaftsgüter) und die personelle Verflechtung (Beteiligungs- und Beherrschungsidentität, Gruppentheorie, Einstimmigkeitsprinzip, faktische und mittelbare Beherrschung) als notwendige Bedingungen für das Bestehen einer Betriebsaufspaltung.
Welche steuerlichen Rechtsfolgen ergeben sich aus einer klassischen Betriebsaufspaltung?
Das Kapitel zu den Rechtsfolgen der klassischen Betriebsaufspaltung beleuchtet die Konsequenzen für das Besitzunternehmen (Buchführung, Gewinnermittlung, Betriebsvermögen, Einkünfteumqualifizierung, Gewerbesteuerpflicht) und die Betriebskapitalgesellschaft. Es werden sowohl steuerliche als auch außersteuerliche Vor- und Nachteile diskutiert.
Welche Gründe gibt es für die Beendigung einer Betriebsaufspaltung und welche steuerlichen Folgen sind damit verbunden?
Die Arbeit untersucht den Wegfall der sachlichen und personellen Verflechtung als Hauptgründe für die Beendigung. Die damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen werden detailliert dargestellt.
Wie lassen sich stille Reserven bei der Beendigung einer klassischen Betriebsaufspaltung vermeiden?
Der Fokus liegt auf Strategien zur Vermeidung der Aufdeckung stiller Reserven. Die Arbeit stellt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten vor, darunter die eigengewerbliche Betätigung des Besitzunternehmens, überlagerte Betriebsverpachtung, Betriebsunterbrechung, Einbringung in Kapitalgesellschaften und Umwandlungen. Diese werden anhand von Fallbeispielen erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Arten der Betriebsaufspaltung, Voraussetzungen der Betriebsaufspaltung, Rechtsfolgen der klassischen Betriebsaufspaltung, Gründe und steuerliche Folgen der Beendigung der Betriebsaufspaltung und Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven bei Beendigung der klassischen Betriebsaufspaltung. Jedes Kapitel enthält Fallbeispiele zur Veranschaulichung.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Betriebsaufspaltung, Rechtsfolgen, Steuerrecht, Sachliche Verflechtung, Personelle Verflechtung, stille Reserven, Beendigung, Gestaltungsmöglichkeiten, Besitzunternehmen, Betriebskapitalgesellschaft, klassische Betriebsaufspaltung, umgekehrte Betriebsaufspaltung, kapitalistische Betriebsaufspaltung, mitunternehmerische Betriebsaufspaltung.
- Quote paper
- Marina Gloning (Author), 2019, Das Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung. Rechtsfolgen, Beendigungsgründe und Gestaltungsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958879