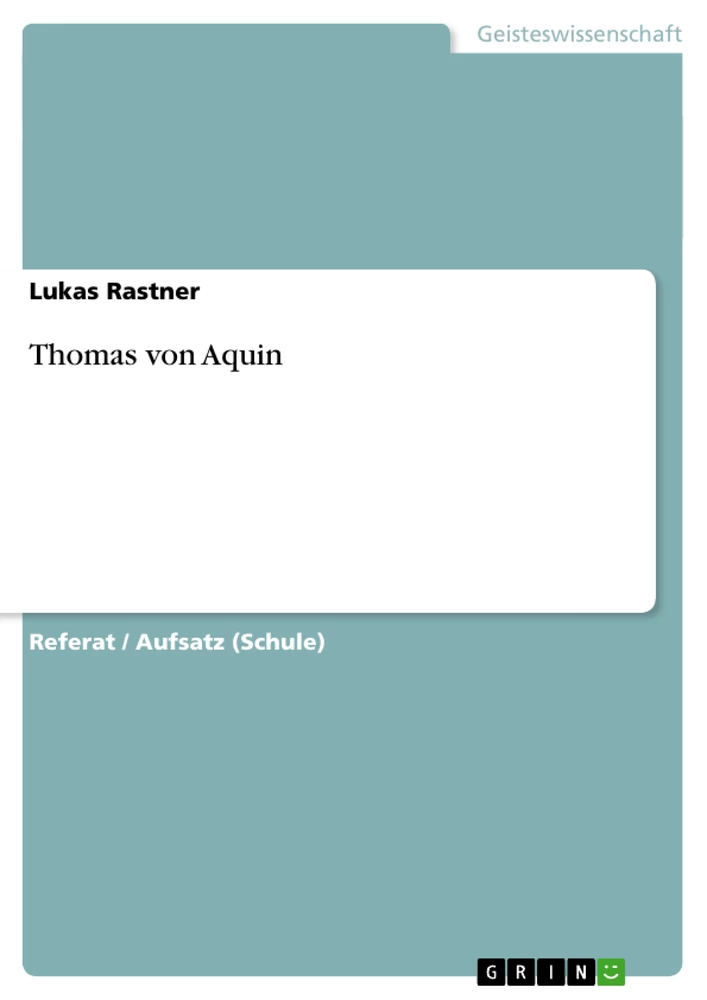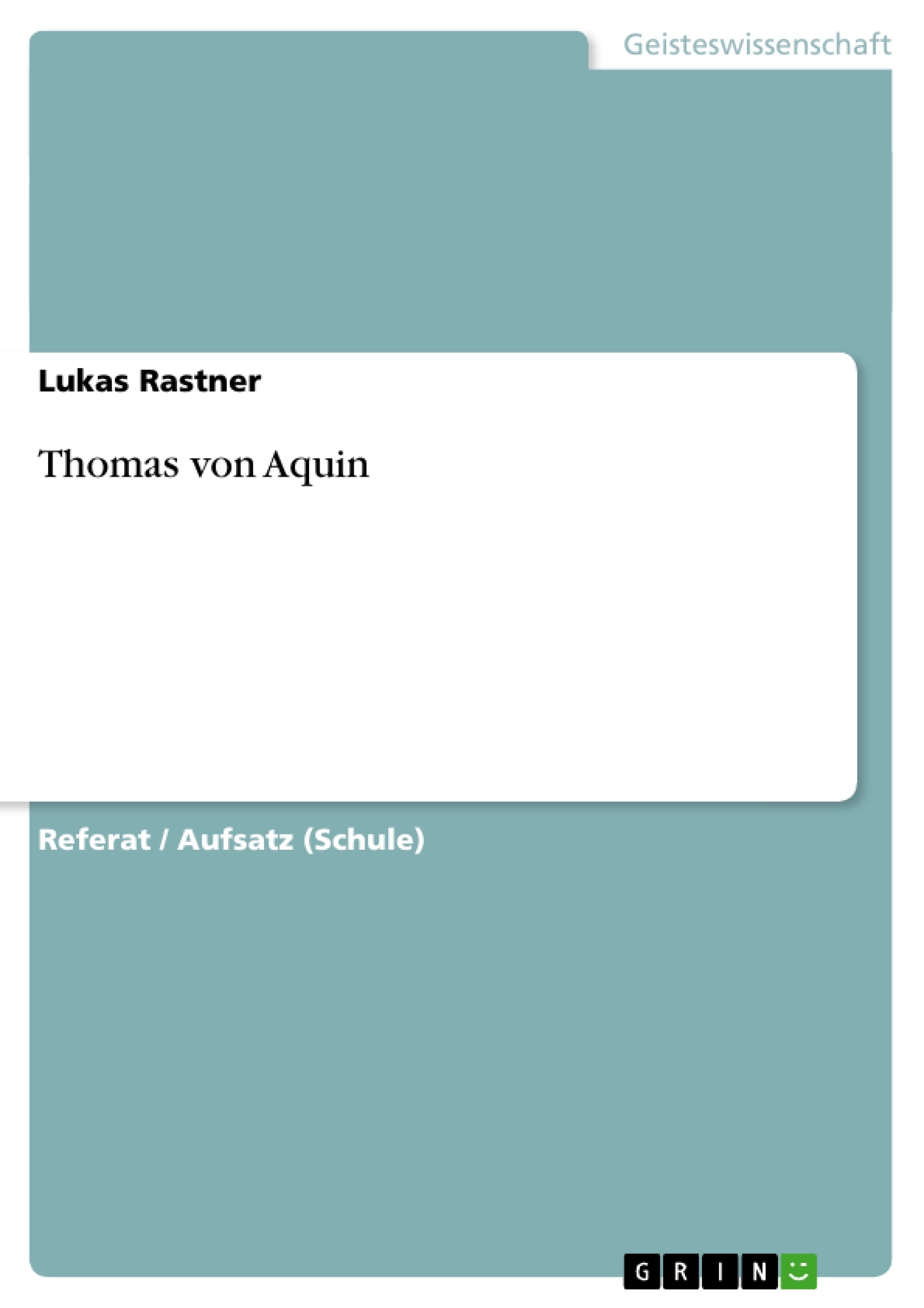In einer Zeit des Umbruchs, als das Wissen der Antike durch Kreuzzüge und orientalische Einflüsse nach Europa strömte, wagte ein Denker das Undenkbare: Thomas von Aquin. Erleben Sie, wie dieser brillante Philosoph und Theologe die scheinbar unvereinbaren Welten des aristotelischen Denkens und des christlichen Glaubens zu einer faszinierenden Synthese vereint. Dieses Buch enthüllt, wie Thomas von Aquin, ein Dominikaner des 13. Jahrhunderts, die Fundamente unseres Verständnisses von Vernunft, Glauben und der Existenz Gottes neu definierte. Entdecken Sie seine bahnbrechenden Gottesbeweise, die bis heute philosophische Debatten anregen, und seine revolutionäre Erkenntnistheorie, die die Welt als Schlüssel zum Verständnis göttlicher Ideen betrachtet. Tauchen Sie ein in die Welt der Scholastik, in der Universitäten zu Zentren des Wissens wurden und Orden das geistige Leben prägten. Verstehen Sie, wie Thomas die "Summe der Theologie" schuf, ein monumentales Werk, das Glaube und Vernunft in Einklang bringt und die Grundlage für das moderne theologische Denken legte. Erfahren Sie, wie er die Bedeutung der sinnlichen Erfahrung für die Welterkenntnis hervorhob und die natürliche Vernunft als Weg zur Erkenntnis Gottes etablierte. Lassen Sie sich von Thomas' Sichtweise inspirieren, die die Welt in ihrer ganzen Fülle betrachtet und die Möglichkeit objektiver Erkenntnis verteidigt. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch das Leben und Werk eines der einflussreichsten Denker des Mittelalters, dessen Ideen die westliche Philosophie und Theologie nachhaltig geprägt haben. Dieses Buch ist eine essentielle Lektüre für alle, die sich für Philosophie, Theologie und die Geschichte des Denkens interessieren. Es bietet einen klaren und verständlichen Zugang zu den komplexen Ideen des Thomas von Aquin und zeigt ihre Relevanz für die heutige Zeit. Schlüsselwörter: Thomas von Aquin, Scholastik, Philosophie, Theologie, Aristoteles, Christentum, Gottesbeweise, Erkenntnistheorie, Mittelalter, Summe der Theologie, Vernunft, Glaube, Ontologie, Gottesgedanken, Weltbild, Geschichte der Philosophie, Dominikaner, Universität Paris, Natürliche Vernunft, Welterkenntnis, Metaphysik, Mittelalterliche Philosophie, Glauben und Wissen, Beweise für die Existenz Gottes, Mittelalterliches Weltbild.
Thomas von Aquin
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Geschichtlicher Leithintergrund:
- durch die Kreuzzüge (1096-1270 n. Chr.) und das Eindringen der Osmanen kamen aristotelische Gedanken, die gr. Philosophie und orientalische Wissenschaften nach Europa.
- Entstehung der Universitäten (Paris, Oxford, Padua, Köln, Bologna). Sie sind die Träger der scholastischen Philosophie.
- Entstehung von Orden (Dominikaner, Franziskaner)
Die Synthese
Thomas von Aquin versucht die beiden widerstreitenden Weltansichten des Aristoteles und des christlichen Glaubens miteinander zu versöhnen, ohne dass eine der Beiden ihres Rechtes beraubt wird. Diese Synthese legt er in vielen umfangreichen Werken nieder, unter anderem in der großen „Summe der Theologie“ oder der „Summe wider die Heiden“. Dabei gelangt Thomas zum Ergebnis, dass der Glaube mit der übernatürlichen Wahrheit zu tun hat, die natürliche Vernunft dagegen richtet sich primär auf die Weltwirklichkeit fiAusgangspunkt der Welterkenntnis ist die sinnliche Erfahrung, und das Kriterium ihrer Wahrheit ist die rationale Einsichtigkeit. In bestimmten Grenzen ist auch die natürliche Vernunft zu einer Erkenntnis Gottes fähig, so lassen dich das Dasein Gottes und gewisse allgemeinste Bestimmungen seines Wesens auf natürliche Weise einsehen.
Thomas glaubt, dass Vernunft und Glaube von Gott stammen. Dieser schafft einerseits den
Glauben, andererseits ist er der Schöpfer der natürlichen Vernunft. Darum können sie nicht in Widerstreit zueinander stehen. In dieser Synthese kommt dem Glauben ein gewisser Vorrang zu („ Die Gnade hebt die Natur nicht auf, sondern vollendet sie“).
Eine große Neuerung in der Geschichte des philosophischen Gedankens ist , dass im Denken des Thomas die welthafte Wirklichkeit in weiterem Umfang für das natürliche Erkennen freigegeben wird. Nach Gott ist für Thomas nicht, wie für Augustinus, die Seele, sondern die Welt , das wichtigste Thema. Thomas sieht die Welt in der ganzen Fülle ihrer Gestalten, wie sie sich den Sinnen darbietetfi „Weltlichkeit“ des Thomas.
Erkenntnistheorie und Ontologie
Thomas unterscheidet an den Dingen Stoff und Form: Den Stoff vernachlässigt er fast ganz. Dagegen erblickt er in den Formen das Wesen der Dinge. Die Formen (Wesenheiten) existieren ursprünglich als Ideen im Geiste Gottes. Wenn nun die Philosophie die Formen aus der Wirklichkeit heraushebt, dann denkt sie damit die Gedanken nach, die Gott mit der Welt hat. Das ist dem Mensch nur möglich, weil er eine „teilhabende Ähnlichkeit mit dem göttlichen Geiste“ besitzt. Thomas glaubt nicht, dass der Mensch sich frei sein Weltbild entwerfen könne. Er hält streng daran fest, dass das Erkennen des Menschen an die von Gott gemäß den Ideen geschaffene Seinsverfassung der Wirklichkeit gebunden ist. Das bedeutet ein entscheidendes Festhalten an der Möglichkeit wahrer und objektiver Erkenntnis. Thomas lehnt die Ansicht, dass die menschlichen Erkenntniskräfte nur ihre eigene Modifikation erkennen mit zwei Gründen ab:
1.) „Wenn unsere Denkkraft ausschließlich subjektive , in der Seele befindliche species erkennen würde, dann könnten die Wissenschaften sich auf keine außerhalb des Denkens stehende Objekte beziehen. „.
2.) Aus der subjektivischen Deutung des menschlichen Erkennens ginge hervor, dass alles , was erkannt wird, wahr ist und somit auch zwei widersprechende Behauptungen zugleich wahr sind . Das bedeutet die Aufhebung jedes Unterschiedes zwischen Wahr und Falsch.
Gottes Gedanken
Jeder Wirklichkeitsbereich im stufenförmigen Aufbau der Welt steht um so höher, je mehr in ihm die Form über dem Stoff erhaben ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieser Stufenbau ist nicht statisch, sondern dynamisch. Alles strebt vom ungeformten Stoff weg zur Form. Der Stoff ist die bloße Möglichkeit geformt zu werden. Je mehr Form etwas erhält, um so wirklicher wird es. So findet im ganzen der Welt ein unablässiges Streben von der Möglichkeit zur Wirklichkeit statt. Wenn das der Fall ist, dann muss das zuhöchst Erstrebte die reine Wirklichkeit , ohne alle Möglichkeit seinfiGott (reiner Geist, reine Form). Damit scheint Gott in gewisser Weise, als das selbst nicht bewegte höchste Prinzip, auf das hin sich alles bewegt, in das Weltgeschehen einbezogen zu werden. Von daher legt sich eine pantheistische Fassung des Gottesbegriffes nahe. Um diesen pantheistische Konsequenzen zu entgehen, greift Thomas auf den Schöpfungsgedanken zurück. Dieser Schöpfungsgedanke im strengeren Sinne setzt voraus, dass es zwischen Schöpfer und Geschöpf einen unendlichen Abstand gibt. Ein solcher lässt sich nicht durch natürliche Vernunft erklären, sondern nur durch den Glauben.
Gottesbeweise
Das Dasein Gottes lässt sich auf dem Wege der natürlichen Vernunft einsehen. Hier setzen die fünf, in der Summe der Theologie enthaltenden Gottesbeweise ein. Der erste Beweis geht aus der Erkenntnis hervor, dass jede Bewegung durch ein Bewegendes hervorgerufen wird. Man kann diese Kette aber nicht ins Unendliche fortsetzen, denn dann gäbe es kein erstes Bewegendes und infolgedessen auch kein anderes Bewegtes. Deshalb ist es notwendig, dass man an ein erstes Bewegendes kommt, das von nichts bewegt wird, und darunter verstehen alle Gott. Der zweite, dritte, vierte und fünfte Beweis sind im eigentlichen nur Abwandlungen des ersten Beweises. Der zweite Beweis handelt vom Erstverursachenden, der dritte von der ersten Notwendigkeit, der vierte Beweis von der Stufenfolge, die wir in allem Sein finden und der fünfte Beweis (theleologischer Beweis) handelt vom Gedanken des Zwecksatzes. In jedem dieser Gottesbeweise ist das erste bzw. das höchste Glied Gott. Thomas beweist aber nicht nur das Dasein Gottes, sondern auch das Wesen Gottes, oder er meint es zumindest zu erkennen. Wie bei den Gottesbeweisen geht er auch hier von der Weltwirklichkeit aus, und zwar benutzt er den Weg der Analogie. Da der Mensch von Gott geschaffen ist, hat er auch etwas vom Wesen Gottes in sich. Das Gutsein Gottes ist zwar analog zum menschlichen Gutsein, doch ist sie zugleich ganz anders und darüber erhaben. So erfasst der Mensch auf dem Wege der Analogie etwas vom Wesen Gottes, aber nur in einem schwachen Umriss. Eine vollständigere Erkenntnis Gottes kann nur der Glaube erlangen. („Das höchste Wissen von Gott, das wir in diesem Leben erlangen können, besteht darin, zu wissen, dass er über allem ist, was wir von ihm denken“).
Textquellen:
1.) Aus “Die philosophische Hintertreppe“: „Thomas oder der getaufte Verstand“.
2.) Lehrbuch: Kleine Weltgeschichte der Philosophie
3.) DTV Atlas zur Weltgeschichte
Bildquelle: Microsoft Encarta 97 Enzyklopädie
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes über Thomas von Aquin?
Der Text behandelt die Philosophie von Thomas von Aquin, insbesondere seine Synthese von aristotelischem Denken und christlichem Glauben. Er erklärt, wie Aquin versuchte, beide Weltanschauungen miteinander zu versöhnen, wobei der Glaube zwar Vorrang hat, aber die natürliche Vernunft dennoch eine wichtige Rolle bei der Welterkenntnis spielt.
Was sind die Hauptelemente der Erkenntnistheorie und Ontologie von Thomas von Aquin?
Aquin unterscheidet zwischen Stoff und Form in den Dingen, wobei er den Formen (Wesenheiten) eine größere Bedeutung beimisst. Er glaubt, dass diese Formen ursprünglich als Ideen im Geiste Gottes existieren und dass die Philosophie diese Gedanken durch das Herausheben der Formen aus der Wirklichkeit nachvollzieht. Aquin betont die Bindung der menschlichen Erkenntnis an die von Gott geschaffene Seinsverfassung der Wirklichkeit.
Wie argumentiert Thomas von Aquin gegen subjektivistische Erkenntnistheorien?
Thomas argumentiert, dass eine subjektivistische Deutung des menschlichen Erkennens dazu führen würde, dass Wissenschaften sich nicht auf Objekte außerhalb des Denkens beziehen könnten und dass widersprüchliche Behauptungen gleichzeitig wahr wären, was die Aufhebung des Unterschieds zwischen Wahr und Falsch bedeuten würde.
Wie erklärt Thomas von Aquin die Beziehung zwischen Gott und der Welt?
Thomas beschreibt einen stufenförmigen Aufbau der Welt, in dem alles vom ungeformten Stoff zur Form strebt. Die reine Wirklichkeit, ohne alle Möglichkeit, ist Gott (reiner Geist, reine Form). Um pantheistische Konsequenzen zu vermeiden, greift er auf den Schöpfungsgedanken zurück, der einen unendlichen Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf voraussetzt.
Was sind die Gottesbeweise von Thomas von Aquin?
Der Text erwähnt fünf Gottesbeweise, die in der Summe der Theologie enthalten sind. Diese Beweise gehen von der Erkenntnis aus, dass jede Bewegung durch ein Bewegendes hervorgerufen wird, von der ersten Ursache, der ersten Notwendigkeit, der Stufenfolge im Sein und dem Zweck in der Welt. In jedem dieser Beweise ist das erste bzw. höchste Glied Gott.
Wie versucht Thomas von Aquin, das Wesen Gottes zu erkennen?
Thomas verwendet den Weg der Analogie, da der Mensch von Gott geschaffen ist und somit etwas vom Wesen Gottes in sich trägt. Das Gutsein Gottes ist analog zum menschlichen Gutsein, aber gleichzeitig anders und erhaben. Auf diese Weise erfasst der Mensch etwas vom Wesen Gottes, aber nur in einem schwachen Umriss.
Welche Quellen wurden für diesen Text verwendet?
Die Textquellen sind: "Die philosophische Hintertreppe“: „Thomas oder der getaufte Verstand“, Lehrbuch: Kleine Weltgeschichte der Philosophie, und DTV Atlas zur Weltgeschichte. Die Bildquelle ist Microsoft Encarta 97 Enzyklopädie.
- Quote paper
- Lukas Rastner (Author), 1999, Thomas von Aquin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95868