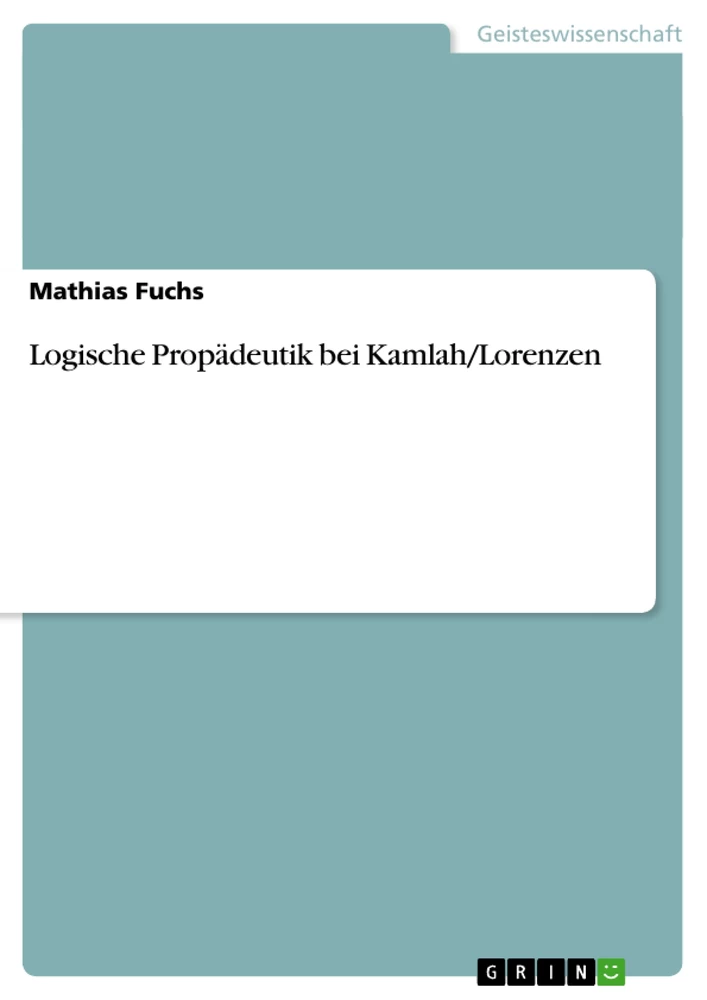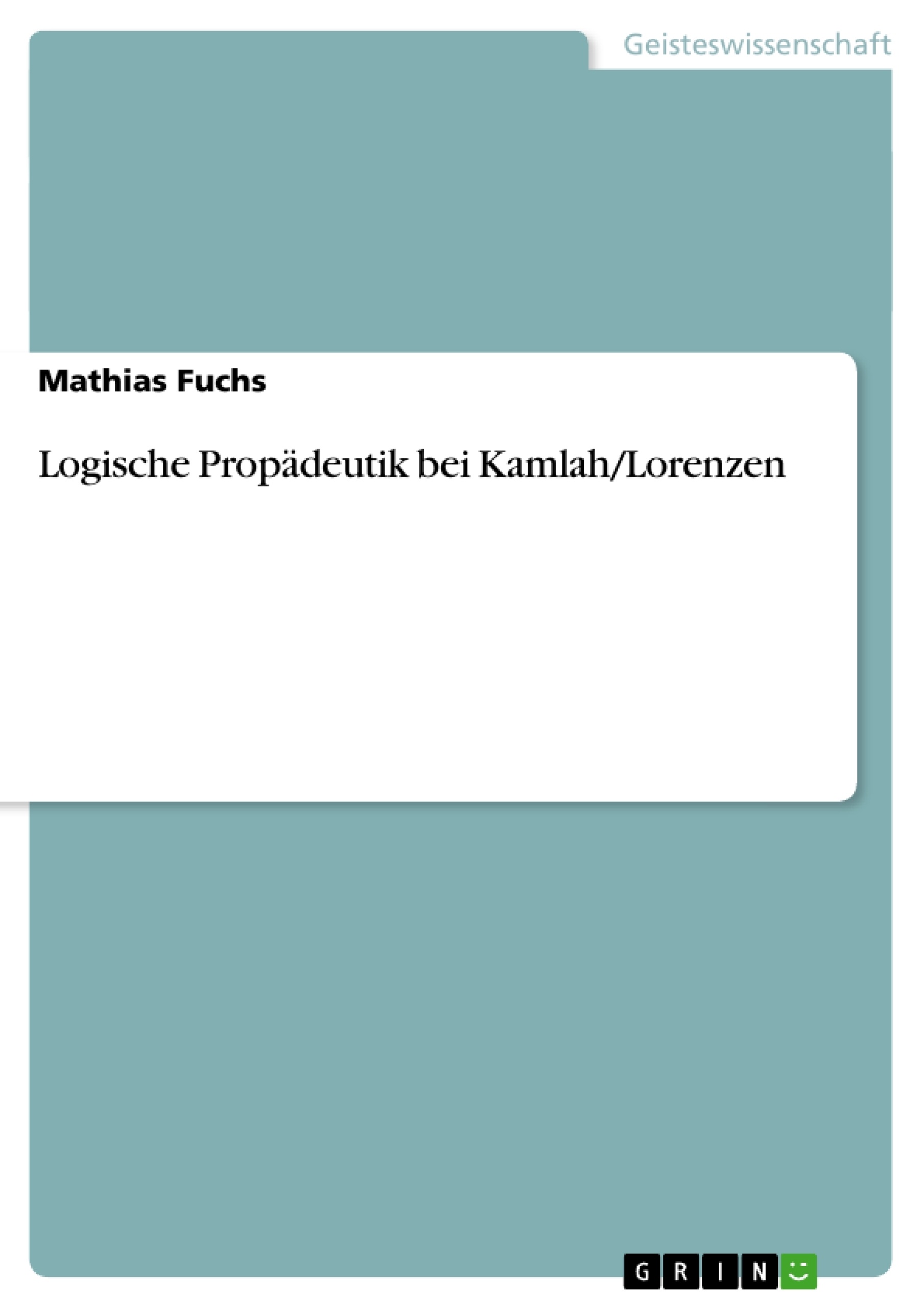Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Missverständnisse in wissenschaftlichen Diskussionen der Vergangenheit angehören. In dieser Welt, die von Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen in ihrer bahnbrechenden "Logischen Propädeutik" konzipiert wurde, wird eine wissenschaftliche Sprache geschaffen, die auf Klarheit, Präzision und der Vermeidung von Mehrdeutigkeiten basiert. Dieses Werk, ein Eckpfeiler der konstruktiven Wissenschaftstheorie der "Erlanger Schule", entführt den Leser in eine methodische Rekonstruktion des vernünftigen Redens, die die Fundamente unseres Verständnisses von Wahrheit und Gültigkeit neu definiert. Entdecken Sie, wie Kamlah und Lorenzen die Umgangssprache als Modell nutzen, um eine systematische Sprachkonstruktion zu entwickeln, die auf der Prädikation und der Bildung von Elementarsätzen basiert. Erfahren Sie, wie diese Sätze durch Junktoren zu komplexen Aussagen verknüpft werden, wodurch ein logisch nachvollziehbares Konstrukt entsteht, das die Grundlage für einen konsensualen Diskurs bildet. Die "Logische Propädeutik" bietet nicht nur eine Kritik an traditionellen wissenschaftlichen Ansätzen, sondern auch einen konstruktiven Ausweg aus dem hermeneutischen Zirkel. Sie befasst sich mit der Verteidigungsfähigkeit von Sätzen, die konstruktiv und logisch eindeutig aufgebaut sind, und demonstriert, wie die Analysis innerhalb der Mathematik bestätigt werden kann. Dieses Buch ist eine Einladung, die Grundlagen unseres Denkens und Sprechens zu hinterfragen und eine neue Perspektive auf die Möglichkeiten der Verständigung zu gewinnen. Tauchen Sie ein in die Welt der konstruktiven Wissenschaftstheorie und entdecken Sie, wie Kamlah und Lorenzen eine Brücke zwischen Philosophie, Logik und Alltagssprache schlagen, um eine rationalere und verständlichere Welt zu schaffen. Die "Logische Propädeutik" ist mehr als nur ein philosophisches Werk; es ist ein Werkzeugkasten für alle, die an einer klaren, kohärenten und konstruktiven Kommunikation interessiert sind, ein Muss für Philosophen, Wissenschaftler und jeden, der die Kunst des vernünftigen Redens beherrschen will. Lassen Sie sich von der Präzision und Tiefe dieses Werkes inspirieren und entdecken Sie die transformative Kraft einer logisch fundierten Sprache.
Thesenpapier zum ReferatLogische Propädeutik
bei Kamlah/Lorenzen
Allgemein:
Mit konstruktiver Wissenschaftstheorie wird das philosophische Programm der
„Erlanger Schule“ innerhalb der Wissenschaftstheorie bezeichnet. Begründer waren die beiden an der Universität Erlangen tätigen Wissenschaftler Kamlah & Lorenzen mit ihrem erstmals 1967 erschienenWerk Logische Propädeutik.
Als Blütezeit gelten die 70er und 80er Jahre. Mitte der 70er Jahre weitete sich dieser Gedanke auf andere Universitäten aus. Sie wurde sowohl in weiteren dt. Universitäten aufgenommen, wie auch in Holland (E. M. Bath, E. C. W. Krabbe), Belgien und den USA (H. Robinson, P. T. Sagal, J. Silber).[1] In den 80er Jahren spezialisierten sich Schüler von Kamlah und Lorenzen auf verschiedene Schwerpunkte und vertieften so den Ansatz in Spezialgebieten und entwickelten ihn weiter.[2]
Geschichte:
Die historischen Wurzeln liegen in der Wechselbeziehung zwischen Phänomenologie & Göttinger Lebensphilosophie in den 20er Jahren, sowie in den Arbeiten H. Dinglers zur methodischen Ordnung des Aufbaus der Wissenschaften. Kamlah kam in den 20er Jahren, Lorenzen in den 30er Jahren in Göttingen mit dieser Diskussion in Kontakt. In diese Diskussion gehören auch die Heideggersche Reformierung des Phänomenologischen Programms, die Kamlah in Marburg kennen lernte und die von M. Heidecker beeinflußte Weiterführung der Phänomenologie durch O. Becker, mit der sich Lorenzen nach dem 2. WK. in Bonn auseinandersetzte. Weitere vorangengangene Gedanken waren von Dingler gekommen, der sich als Schüler Husserls verstand.[1]
Absicht:
Das Ziel dieser Theorie war:
1. Widerlegung Gadamers These von der Unausweichlichkeit eines hermeneutischen Zirkels.[1]
2. Die Gründung einer wissenschaftlichen Sprache, die, entgegen der bisherigen wissenschaftlichen Sprache, es ermöglicht, eine Diskussion nach Regeln zu führen, ohne daß Mißverständnisse unter den Gesprächspartnern hinsichtlich der Bedeutung eines gebrauchten Begriffes auftreten.
3. Anhand einer methodisch geleiteten Rekonstruktion der Grundlagen einer These soll deren Gültigkeit überprüft werden. Diese Überprüfung findet durch eine geregelte Sprachkonstruktion statt.[2]
Methodik:
Diese zentrale Sprachkonstruktion, die von Kamlah/Lorenzen entwickelt wurde, hatte die Umgangssprache/Muttersprache zum Vorbild, da hier nach Kamlah/Lorenzen keine Begriffe auftauchen, die einen hohen abstrakten Gehalt beinhalten, wie z.B. das in der wissenschaftlichen Sprache vorkommende WortKonstruktivismus.Die Umgangssprache bedient sich eher beschreibender Worte und Sätze, deren Gebrauch wir durch die langjährige Schulung in unserer Kindheit sicherer sind. Aus diesem Gedanken heraus bildeten die zwei als Grundlage ihrer Sprachkonstruktion die sog.Prädikation, einen Satz mit beschreibenden Charakter, wie z.B.dies ist eine Straße.
Die dafür entwickelte Gleichung lautet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Straße bzw. P ist dabei der sog.Prädikatorder einen Sachverhalt aus unserer Umgebung beschreibt und dessen Rechtfertigung sich aus der lebensweltlichen Erfahrung des Subjektes ergibt.
Mit dieserPrädikationwerden die sog.Elementarsätzegebildet, die als Basis des Diskurses dienen. Dieser Vorgang hat zu Beginn einer jeden Diskussion zu stehen und soll nach Kamlah & Lorenzen gemeinsam von den Gesprächspartnern stattfinden, so werden Mißverständnisse hinsichtlich der Bedeutung eines Begriffes vermieden. Der neue Gehalt dieser Gedanken liegt in der internalistischen Legitimation der Begriffsbildung. Es bedarf keiner weiteren
Instanz oder gar Messgeräten zur Definition von Sachverhalten, wie es im Gegensatz bei externalistischen Rechtfertigungen der Fall ist.[3] So wird nach Kamlah/Lorenzen eine Zirkelhaftigkeit von vornherein ausgeschlossen.
Durch die Einführung weiterer Junktoren wieekönnen dieseElementarsätzezu komplexen Sätzenmiteinander verknüpft werden, wodurch sich ihr Sachverhalt von Grund auf logisch Nachvollziehen läßt.[1]
Solche Verknüpfungen kommen auch in der von uns verwendeten Umgangssprache vor, z.B. durch und, oder durch entweder-oder Aussagen. Eine durch und verknüpfte Aussage (symbolisiert durch ^) wird alsKonjunkturbezeichnet und ist nur wahr, wenn die verknüpftenTeilaussagenbeide wahr sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Weitere Junktoren sind z.B:
- Disjunktion>-< (entweder-oder)
- Negation¬ (nicht)
- Negatkonjunktur ψ (weder-noch)
Diese Definitionen derJunktorenstellt lediglich den zweiten Schritt (1. Schritt: Bildung derPrädikatoren) in ihrer logischen Propädeutik dar, die versucht, rein formal die Sätze einer Theorie darzustellen. Nach und nach entsteht ein Konstrukt, was noch weitaus umfassender wird, als es das hier dargestellte erahnen läßt. Ich habe dieses Konstrukt nun lediglich in seinen Grundzügen dargestellt, doch denke ich, der Ansatz ist deutlich geworden.
Um diesen zu vertiefen, bedarf es der Auseinandersetzung mit ihrem Buch.
1973: Kamlah, Wilhelm/Lorenzen, Paul. Logische Propädeutik, Vorschule des vernünftigen Redens. Mannheim: B.I. Wissenschaftsverlag. 2. Auflage.
Kamlahs & Lorenzens Begründung von wissenschaftlichen Sätzen besagt:
Verteidigungsfähigkeit von konstruktiv und logisch eindeutig aufgebauten Sätzen im nach Dialogregeln geführten Diskurs.[2]
Durch ihre Methode konnte beispielsweise die Analysis innerhalb der Mathematik bestätigt werden.
Kritik:
Findet sich u.a. bei Gebhard Kirchgässner.[2]
Halten wir noch einmal das nach dem Referat gemeinsam im Unterricht erarbeitete fest:
- Dieser Ansatz, eine Theorie auf wahr oder falsch zu prüfen, nimmt als Kriterium die Sprache. So wird ein menschlicher Aspekt innerhalb dessen als Bezugspunkt gewählt.
- Die logische Propädeutik bejaht den synthetischen Aprorismus.
- Hier wird nicht wie etwa beim logischen Empirismus von einer Ursprache ausgegangen.
[...]
[1] 1984: Mittelsraß, Jürgen (Hrsg.).Enzyklopädie Philosophie & Wissenschaftstheorie 4. Mannheim: J.B. Metzler. S. 746.
[2] 1999: Häußling. A.Konstruktive Wissenschaftstheorie. Arbeitspapier Proseminar WS 99/00, Einführung in die Wissenschaftstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Thesenpapier zum Referat Logische Propädeutik"?
Der Text behandelt die konstruktive Wissenschaftstheorie der "Erlanger Schule", insbesondere das Werk "Logische Propädeutik" von Kamlah und Lorenzen. Er beleuchtet die Geschichte, Absichten und Methodik dieser Theorie.
Wer waren die Begründer der konstruktiven Wissenschaftstheorie?
Die Begründer waren Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen, beide tätig an der Universität Erlangen.
Was waren die Hauptziele der konstruktiven Wissenschaftstheorie?
Die Hauptziele waren die Widerlegung der These von der Unausweichlichkeit eines hermeneutischen Zirkels, die Gründung einer wissenschaftlichen Sprache zur Vermeidung von Missverständnissen und die Überprüfung der Gültigkeit von Thesen durch geregelte Sprachkonstruktion.
Welche Methodik wurde in der Logischen Propädeutik verwendet?
Zentral war die Sprachkonstruktion, die sich an der Umgangssprache orientierte. Die Prädikation (z.B. "dies ist eine Straße") diente als Grundlage für Elementarsätze, die als Basis für den Diskurs dienten. Junktoren wie "und", "oder", "nicht" wurden verwendet, um komplexe Sätze zu bilden.
Was ist ein Prädikator im Kontext der Logischen Propädeutik?
Ein Prädikator ist ein Begriff, der einen Sachverhalt aus der Umgebung beschreibt und dessen Rechtfertigung sich aus der lebensweltlichen Erfahrung des Subjektes ergibt (z.B. "Straße" in "dies ist eine Straße").
Was sind Elementarsätze und wie werden sie gebildet?
Elementarsätze werden durch die Prädikation gebildet und dienen als Basis des Diskurses. Sie sollen von den Gesprächspartnern gemeinsam festgelegt werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
Wie werden Elementarsätze miteinander verknüpft?
Elementarsätze werden durch Junktoren wie "und" (Konjunktur), "oder" (Disjunktion), "nicht" (Negation) miteinander verknüpft, um komplexere Sätze zu bilden.
Was besagt Kamlahs & Lorenzens Begründung von wissenschaftlichen Sätzen?
Sie besagt die Verteidigungsfähigkeit von konstruktiv und logisch eindeutig aufgebauten Sätzen im nach Dialogregeln geführten Diskurs.
Wo findet sich Kritik an der konstruktiven Wissenschaftstheorie?
Kritik findet sich unter anderem bei Gebhard Kirchgässner.
Welche Kernpunkte wurden nach dem Referat im Unterricht festgehalten?
Der Ansatz, eine Theorie auf wahr oder falsch zu prüfen, nimmt als Kriterium die Sprache. Die logische Propädeutik bejaht den synthetischen Aprorismus, und es wird nicht wie beim logischen Empirismus von einer Ursprache ausgegangen.
- Quote paper
- Mathias Fuchs (Author), 1999, Logische Propädeutik bei Kamlah/Lorenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95864