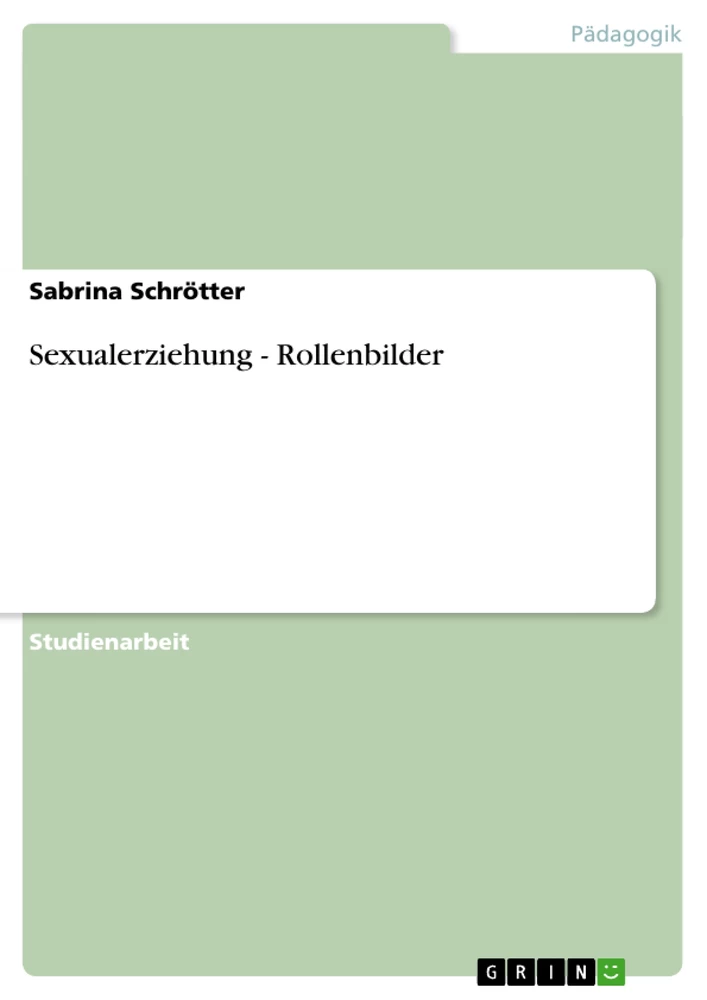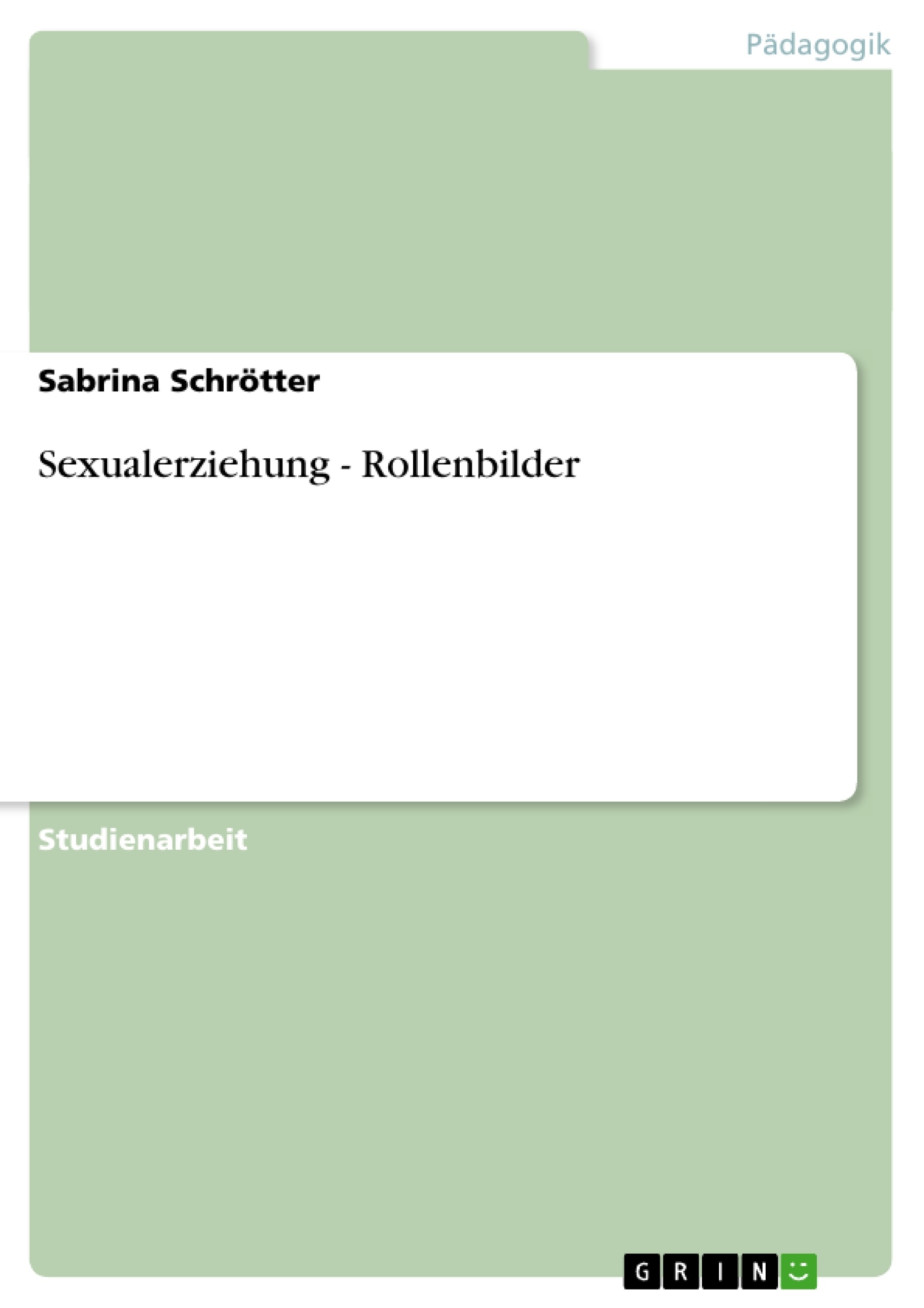Inhaltsverzeichnis
Das Rollenbild des Mannes
1. Konsequenzen
2. Akzeptanz des eigenen Körpers
3. Unterrichtsvorschläge
1. Das Rollenbild der Frau
1. Konsequenzen
2. Akzeptanz des eigenen Körpers bei Mädchen
3. Unterrichtsvorschläge
Literaturverzeichnis
1 Das Rollenbild des Mannes
Bereits im Alter von 3 - 4 Jahren, also im Kindergartenalter, lernen Kinder bereits, wie sie sich geschlechterspezifisch verhalten sollen.
Zunächst werden die Jungen, durch die nach wie vor übliche Rollenverteilung, hauptsächlich von Frauen versorgt und erzogen, was in den ersten Jahren von grundlegender Bedeutung ist. Ihre Hauptbezugsperson ist also zunächst die Mutter, die für die Nahrungs- und emotionale Versorgung zuständig ist.
Im Alter von zwei Jahren (wenn sie sich nicht mehr mit der Mutter identifizieren können) beobachten Jungen zunehmend ihre Väter, sowie männliche Verwandte und Bekannte und identifizieren sich mit ihnen (vgl. BZgA, Sexualpädagogische Jungenarbeit, 1995, S. 18).
Später kommen noch Vorbilder außerhalb der Familie hinzu, z. B. Lehrer und Freunde und unerreichbare Vorbilder, wie Sportler, Schauspieler, Sänger, Models, die sie anhand der Medien kennenlernen.
Schon die Anforderungen der Eltern an ihren Sohn sind groß. Sie erwarten von ihm, daß er mit dem täglichen Konkurrenzkampf im Leben zurechtkommt. Er soll lernen, um Positionen in der Freundschaftsgruppe zu kämpfen und natürlich um ihr Bild, das sich andere von ihnen machen könnten. Vor allen Väter müßten sich eigentlich noch an die Zeit erinnern, als sie selbst "den Helden" spielen mußten. Dennoch erwarten viele Väter das gleiche von ihren Söhnen (vgl. BZgA, Unser Kind fällt aus der Rolle, 1994, S.7). Die Eltern wollen also einen Gewinner und keinen Schlaffi, oder gar einen Außenseiter, zum Sohn haben (vgl. BZgA, Unser Kind fällt aus der Rolle, 1994, S.7).
Von Verwandten und Bekannten müssen sie sich teilweise Sätze anhören, wie: "Ein Indianer kennt kein Schmerz !", "Heul nicht, du bist doch ein Mann!" oder "Mann oder Maus"?
Mädchentypische Verhaltensweisen werden von nun an durch Disziplin, Selbstkontrolle und Verzicht unterdrückt. So werden die Jungen auf Überlegenheit und Sieg programmiert und müssen eigene Gefühle und Interessen unterdrücken.
Des Weiteren dürfen Jungen keine Schwäche zeigen, um nicht als "Waschlappen" zu gelten. Laut einer Jungenbefragung von Bank/Zimmermann bestätigen viele Jungen dies, anhand ihrer eigenen Wahrnehmung (vgl. Preuss-Lausitz, U. in Schüler´96, 1996, S. 62).
Jungen lernen also schon früh, wie man sich als ein "richtiger Mann" zu verhalten hat und daß man als Mann ein angstfreier Held sein soll.
Sie sind also einem enormen Druck ausgesetzt, um die Erwartungen der Eltern und die der Gesellschaft zu erfüllen.
So neigen Jungen, die unter ungünstigen Bedingungen aufgewachsen sind dazu, sich einen aggressiv nach innen, wie nach außen gerichteten Panzer zuzulegen (vgl. Preuss-Lausitz, U. in Schüler´96, 1996, S. 62).
Und da die Jugendlichen meist dem "richtigen" Männerbild kaum entsprechen können und ihm vielleicht nur durch Bluffs oder besonderem "männlichen" Verhalten näherkommen (BZgA, Unser Kind fällt aus der Rolle, 1994, S.8).
Auch die Sexualerziehung erfolgt in erster Linie im Elternhaus. Als zusätzliche Vorbilder (ob gewollt oder ungewollt) kommen auch hier Verwandte, Bekannte, Medien, Medienstars, Lehrer und Lehrerinnen hinzu (vgl. Etschenberg, K. in Schüler´96, 1996, S. 89).
Der Aspekt der Sexualität, welcher mit zunehmenden Alter immer mehr an Bedeutung gewinnt, setzt den "Erwartungsdruck" und die Angst Gefühle zu zeigen fort. Die jungen Männer haben Angst, daß der Partner oder die Partnerin "Mißgeschicke" der Clique weitererzählen könnte und daß sie daraufhin ausgelacht werden (vgl. Menzel, M. in Schüler´96, 1996, S. 39).
Ebenso existiert für die Jungen auch der Druck, ihr Image durch viele sexuelle Erfahrungen, z.B. durch häufig wechselnde Beziehungen, zu stärken (vgl. Tillmann, K. in Schüler´96, 1996, S. 51).
1.1 Konsequenzen
Der ständige Streß der Jungen, nämlich, stets jemand anderes sein zu müssen als man wirklich ist, kann unter Umständen schwere Konsequenzen haben.
Denn dadurch steigert sich die Angst Gefühle zu zeigen und somit die Unterdrückung der eigenen Gefühle. Dies kann dazu führen, daß sie sich niemanden anvertrauen und ihren Kummer in sich hineinfressen. Sie können dadurch krank, einsam und unglücklich werden.
Außerdem müssen sie sich in jeder Situation als Siegertypen beweisen und wollen nicht ausgelacht werden. Wenn sie die erwartete Leistung nicht bringen können. bleibt es nicht aus, daß sie beginnen zu schwindeln oder Dinge vorzutäuschen.
Typisch männliche Jungenerziehung kann auch in sofern gefährlich werden, wenn sich das Bedürfnis nach Stärke und Überlegenheit gegen Schwächere wendet (vgl. BZgA, Unser Kind fällt aus der Rolle, 1994, S. 8).
Sie bekommen Angst, nicht als "richtiger Junge" angesehen zu werden oder gar mädchenhaft und unmännlich zu wirken. Oft stehen sie dann unter einem enormen Leistungsdruck, um dem Urteil der Gesellschaft und besonders dem der Mädchen und Frauen gerecht zu werden.
In der Partnerschaft kann es soweit gehen, daß sie Angst haben, die Freundin aus "technischer Unkenntnis" zu verlieren. Ihr streben nach dem idealen Verhalten und der dadurch entstehende Druck ist nun so groß, daß sie sich eher um die "perfekte Befriedigung" der Partnerin bemühen, anstatt auf die eigenen Gefühle zu achten und zu hören (vgl. Menzel, M. in Schüler´96, 1996, S. 39).
1.2 Akzeptanz des eigenen Körpers
Als Jugendliche bilden sich manche Jungen ein, daß sie zu klein sind, nicht muskulös genug sind oder sie sind mit der Größe ihrer Geschlechtsteile unzufrieden.
Wenn sie älter werden kommt dann das Empfinden dazu, daß sie zuwenig Haare auf dem Kopf oder einen Schmierbauch haben So beginnen viele Jugendliche und Männer ihren Körper zu trainieren, um ihre Muskeln, welche ja eine enorme Stärke ausdrücken, sprießen zu lassen und riskieren somit ein enormes gesundheitliches Risiko. Eventuell kann dies in einem Fitnesswahn enden und so weit gehen, daß sie ihren Körper mit Anabolika aufputschen. Auch nutzen immer mehr Männer die Schönheitsoperation, um ihren Schönheitsideal entgegen zu kommen.
Die primäre Ängste von Jungen sind Selbstzweifel. Sie haben Angst, nicht attraktiv und/oder nicht "cool" genug zu sein. Sie fürchten, in den Augen der Anderen nicht o.k. zu sein, da sie ihren eigenen Empfindungen noch nicht trauen. Eine "vorgeschriebene Männlichkeit" hindert die Jungen daran, Gefühle wie Scham, Hilflosigkeit und Anlehnungsbedürfnisse als persönliche Charaktereigenschaften anzuerkennen. Dies kann bis zur Wahrnehmungshemmung eigener Empfindungen kommen. Somit werden die eigenen Gefühle unterdrückt, bis man sie kaum mehr bemerkt. Hierdurch entstehen auch die Ängste, die sich auf die Sexualität beziehen (vgl. Menzel, M. in Schüler´96, 1996, S. 40).
Um eine gelingende Entwicklung des Kindes zu erzielen können die Eltern in der Erziehung beitragen, indem:
Väter und Mütter sollten etwas mehr von der ganzen Breite ihrer Qualitäten zeigen und vormachen, daß beide Verstand und Gefühle haben, selbständig und fürsorglich sind.
Des Weiteren sollten sie nicht nur Leistung fordern, sondern auch das persönliche Befinden des Kindes wichtig nehmen, sowie viel Körperkontakt pflegen (unter Beachtung der Schamgrenzen) und Hilfe, Nachgeben, Geduld und Sich-Kümmern als Stärken anerkennen (vgl. BZgA, Unser Kind fällt aus der Rolle, 1994, S. 8).
1.3 Unterrichtsvorschläge
( Was kann man mit den Kindern im Unterricht machen, damit sie ein positives Körpergefühl entwickeln?)
I. Man greift einen aktuellen Anlaß auf, z. B. wenn die Kinder sich mit obszönen
Wörtern beschimpfen oder geschlechterspezifische Konflikte herrschen. Die Kinder können sich schriftlich und anonym zum Thema äußern und die Lehrkraft stellt die aufgekommen Fragen nach Themenbereichen, wie z. B.: Zuneigung, Freundschaft, Liebe... zusammen. Anschließend erhalten die Kinder eine Kopie der aufgestellten Fragen zu den jeweiligen Themen und man kann mit Kindern in der Gruppe über die Fragen sprechen und eventuell können sie auch zu Hause mit den Eltern darüber sprechen.
II. So sehe ich mich (Darstellung des eigenen Körpers)
Jedes Kind legt sich auf den Boden, auf einen großen Bogen Papier und sucht sich einen Partner aus. Dieser ummalt den Körper des Kindes mit einem Stift. Anschließend kann es seien "Körper" ausschneiden und ausmalen. Danach kann man die Selbstdarstellungen an die Wand heften und mit den Kindern über die Körperteile reden, die sie gerne mögen und über die, die sie nicht so gerne mögen. Außerdem kann man auf die Frage eingehen, warum sie diese Körperteile mögen oder warum nicht.
III. Mädchen und Junge sind gleich und verschieden
Gleiche und verschiedene Körperteile bei Jungen und Mädchen benennen und verschiedene Begriffe für geschlechterspezifische Körperteile benutzen. Dabei sollte man unter der "öffentlichen" und "privaten" Sprache unterscheiden (Vgl. Beispiele, 3/95, S. 52).
Literaturverzeichnis (Rollenbild des Mannes)
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Unser Kind fällt aus der Rolle, Die eigene Rolle finden, November 1994.
Menzel, Manfred: "Ein Indianer kennt seinen Schmerz" in Schüler ´96 - Liebe und Sexualität, Erhard Friedrich Verlag u. Klett Verlag, 1996.
Tillmann, Klaus-Jürgen: "Streß mit Mädchen-Streß mit Jungen" in Schüler ´96 - Liebe und Sexualität, Erhard Friedrich Verlag u. Klett Verlag, 1996.
Preuss-Lausitz, Ulf: "Der ´richtige´ Junge stirbt aus" in Schüler ´96 - Liebe und Sexualität, Erhard Friedrich Verlag u. Klett Verlag, 1996.
Etschenberg, Karla: "Vorbild, Vermittler, Berater" in Schüler ´96 - Liebe und Sexualität, Erhard Friedrich Verlag u. Klett Verlag, 1996.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Sexualpädagogische Jungenarbeit, Band 1, 1995.
Niedersächsisches Kultusministerium: "Ich und mein Körper" in BeispieleSexualerziehung, Friedrich Verlag, September 1995.
Literaturverzeichnis (Rollenbild der Frau)
Beispiele - Sexualerziehung, Anregung und Materialien, Friedrich Verlag und Niedersächsisches Kultusministerium, 13. Jahrgang, September 1995.
Milhofer, Petra (Hrsg.): Sexualerziehung von Anfang an, Arbeitskreis Grundschule - Der Grundschulverband - ev., Frankfurt am Main, 1995.
Nissen, U., In: Pruss-Lausitz, Rülcker, T., Zeiher, H. (Hrsg.): Selbständigkeit für Kinder - die große Freiheit?, Weinheim, Basel 1990, Zitiert nach: Beispiele Sexualerziehung, Friedrich Verlag 1995.
Schüler ´96 - Liebe und Sexualität, Friedrich Verlag 1996.
Sellenberg, Dorothee; Hermanowski, Susanne: 30 Jahre Barbie und kein Ende. In: Büttner, Christian, Dittmann, Marianne (Hrsg.): Brave Mädchen, böse Buben, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1992.
Sielert, Uwe; Herrath, Frank; Wendel, Heidrun; Hanswille, Reinert u.a.:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus des Textes?
Der Text analysiert das Rollenbild des Mannes und der Frau in der Gesellschaft, deren Konsequenzen, die Akzeptanz des eigenen Körpers und gibt Unterrichtsvorschläge für die Bearbeitung dieser Themen.
Was wird über das Rollenbild des Mannes gesagt?
Der Text beschreibt, wie Jungen schon früh lernen, sich geschlechterspezifisch zu verhalten, und unter enormem Druck stehen, den Erwartungen der Eltern und der Gesellschaft zu entsprechen. Dies führt oft zur Unterdrückung eigener Gefühle und Interessen.
Welche Konsequenzen hat das Rollenbild des Mannes?
Die Konsequenzen des ständigen Stresses, jemand anderes sein zu müssen, können schwerwiegend sein. Es kann zu Angstzuständen, Unterdrückung von Gefühlen, Einsamkeit und dem Bedürfnis führen, Schwäche zu verbergen.
Wie können Jungen ihren Körper akzeptieren lernen?
Der Text schlägt vor, dass Eltern ihren Kindern zeigen sollten, dass sowohl Verstand als auch Gefühle wichtig sind und dass Körperkontakt, Hilfe, Geduld und Sich-Kümmern als Stärken anerkannt werden sollten.
Welche Unterrichtsvorschläge werden zur Förderung eines positiven Körpergefühls gegeben?
Die Unterrichtsvorschläge umfassen die Aufgreifung aktueller Anlässe, die Darstellung des eigenen Körpers und die Unterscheidung zwischen gleichen und verschiedenen Körperteilen bei Jungen und Mädchen.
Was wird über das Rollenbild der Frau gesagt?
Der Text erwähnt das Rollenbild der Frau und Unterrichtsvorschläge, jedoch nicht im Detail wie das Rollenbild des Mannes. Die vollständigen Inhalte zum Rollenbild der Frau sind in den gegebenen Auszügen nicht enthalten.
Wo finde ich weitere Informationen zu den Themen?
Der Text enthält ein Literaturverzeichnis mit Quellen, die für weitere Recherchen zu den Rollenbildern von Mann und Frau genutzt werden können.
- Quote paper
- Sabrina Schrötter (Author), 1996, Sexualerziehung - Rollenbilder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95839