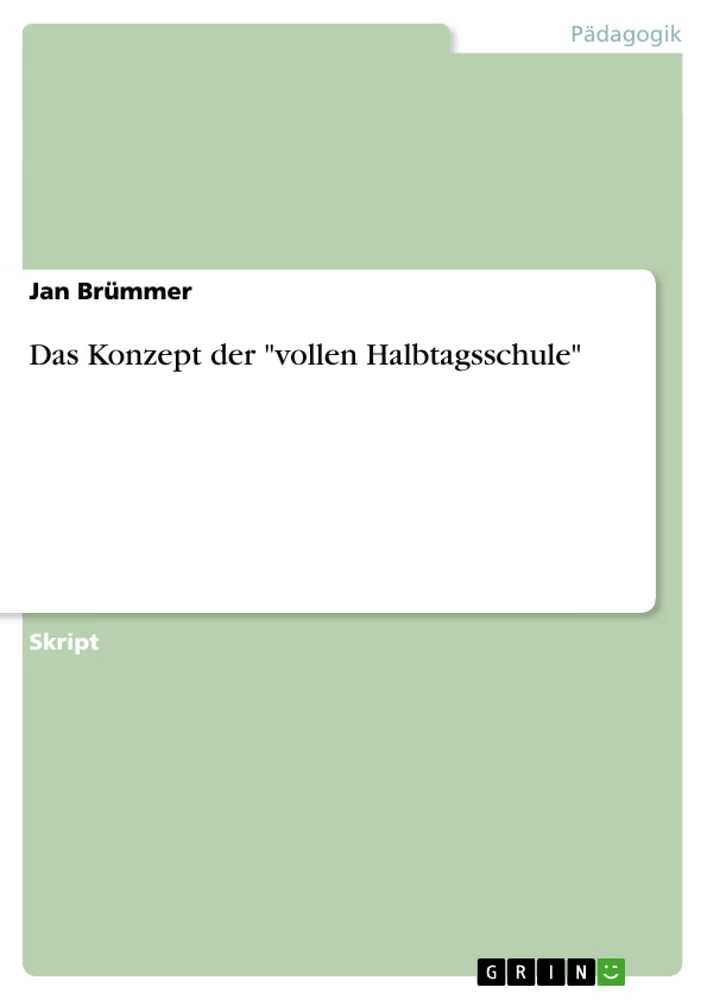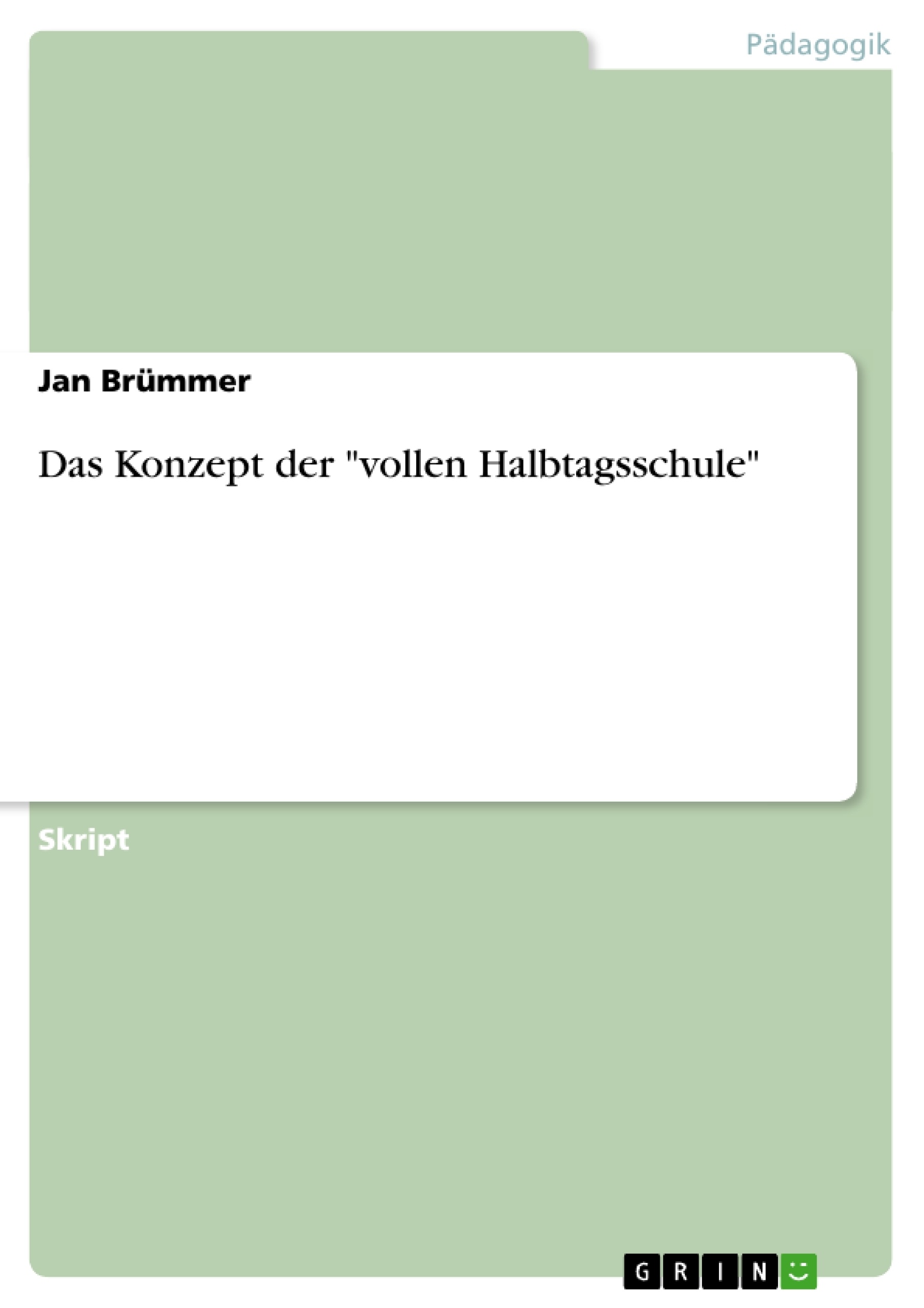Das Konzept der "Vollen Halbtagsschule"
(ein Bericht von Jan Brümmer /Tutorium für die Einführung in die Grundschulpädagogik [WS 97/98 / v. d. Steinen])
Im 19. Jahrhundert konnte in Deutschland die Allgemeine Schulpflicht nur als Halbtagsschule durchgesetzt werden, damit es den Kindern möglich war, den Eltern bei der Arbeit auf dem Hof und im Betrieb zur Hand zu gehen. In anderen europäischen Ländern wie z.B. England oder Frankreich sollte die Kinderarbeit eingedämmt werden, so daß dort die Ganztagsschule eingeführt wurde.
Gerade heute besteht jedoch - resultierend aus den veränderten sozialen und familiären Bedingungen - ein großer Nachholbedarf bezüglich der Betreuung der Kinder in öffendlichen pädagogischen Einrichtungen. In den alten Bundesländern stehen gerade für 4% der 6 bis 10 Jährigen Hortplätze zur Verfügung. So wurde hier wie auch in den neuen Bundesländern - obwohl die Situation dort nicht ganz so kritisch ist - die Forderung nach einem neuen familienpolitischen und pädagogischen Konzept laut, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Hierbei sollte es nicht darum gehen, die veränderte Lage den Ansprüchen der Eltern durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote anzupassen, sondern den pädagogischen Bedürfnissen und den veränderten Erziehungs- und Bildungsansprüchen der Kinder gerecht zu werden.
Auf dieser Grundlage versuchten Pädagogen, Eltern, Erziehungswissenschaftler und Vertreter von Lehrerverbänden ein geeignetes Konzept zu entwickeln, welches der veränderten Kindheit Rechnung tragen würde. Das Ergebnis dieser Bemühungen war das Konzept der vollen Halbtagsschule, welches verschiedene Veränderungen im Primarbereich, wie man ihn bis heute kennt, vorsieht:
1. Sowohl Kinder als auch LehrerInnen brauchen in der Schule mehr Zeit, damit besser auf die heute sehr komplex gewordenen Lebens- und Arbeitsbedingungen vor und hinter dem Lehrerpult eingegangen werden kann. Die volle Halbtagsschule soll gewährleisten, daß die Schüler sich in unserer immer schneller verändernden, multikulturellen Welt besser orientieren und ihren Lernweg von Anfang an erfolgreich bewältigen können. Durch mehr Zeit soll auch den Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht werden, besser auf die unterschiedlichen Bedingungen bezüglich der kulturellen und sozialen Herkunft, den verschiedenen Entwicklungsständen und dem daraus resultierenden Lerntempo der einzelnen Schüler einzugehen.
2. Weiterhin werden für die Grundschule verläßliche Unterrichtszeiten gefordert, damit es den Eltern möglich ist, die Aufgaben von Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Zudem soll die volle Halbtagsschule Raum dafür lassen, über die erweiterte Unterrichtszeit hinaus, die Kinder bei Bedarf weiter zu betreuen und gegebenenfalls weitere Betreuungsangebote zur Verfügung zu organisieren.
3. Um sich auf die örtlichen Gegebenheiten (z.B. soziale Brennpunkte) flexibel einstellen zu können, braucht die einzelne Schule mehr Selbstständigkeit. Um eben diese speziellen "Anpassungen" vorzunehmen, sind Schulleitung, Lehrkräfte und Eltern aufgefordert, gemeinsam vor Ort an geeigneten Organisationsformen und der inhaltlichen Weiterentwicklung ihrer Grundschule zu arbeiten.
Bei der Umsetzung dieses Konzeptes, welches zum Jahreswechsel 1998/99 landesweit in Rheinland-Pfalz eingeführt werden soll, gehen die Meinungen, gerade was den Zeitraum für die Einführung der neuen Richtlinien betrifft, noch etwas auseinander. Die einen fordern eine Übergangszeit zwischen 3 und 5 Jahren, die anderen, so auch die Direktorin einer Koblenzer Grundschule, welche ich zu diesem Thema befragt habe, vertreten die Ansicht, das eine Einführung des neuen Systems von allen Grundschulen in Rheinland-Pfalz gleichzeitig an einem festgelegten Termin erfolgen soll, frei nach dem Motto "kurz und schmerzlos". Der momentan aktuelle Termin für die Einführung ist der Schuljahreswechsel 1998/99. Allerdings haben einige Grundschulen in Rheinland-Pfalz schon zum heutigen Zeitpunkt begonnen, Umstrukturierungen in Richtung des Konzeptes volle Halbtagsschule vorzunehmen. So auch die von mir besuchte Grundschule im Zentrum von Koblenz: Hier hat schon eine Sozialpädagogin ihren Dienst aufgenommen, um Schülern, Lehrern und Eltern in Problemfragen zur Seite zu stehen. Allerdings ist nicht vorgesehen - wie eigendlich in den Richtlinien für das neue Konzept gefordert - noch weitere Sozialpädagogische Hilfskräfte einzustellen, so daß in jeder Klasse eine solche Fachkraft zur Unterstützung der Lehrerin bzw. des Lehrers vorhanden ist, so die befragte Direktorin.
Die gravierensten Veränderungen sollen in der Organisation und Dauer der Wochenstunden vorgenommen werden. Die Stundenorganisation in ihrer heutigen Art soll völlig neu gestaltet werden, die Grundschule soll feste "Öffnungszeiten" bekommen, die dem Rahmenkonzept "Mehr Zeit für Kinder" gerecht werden. Diese Veränderungen sollen den Kindern mehr Zeit zum Lernen, den Eltern verläßliche Betreuungszeiten und den einzelnen Grundschulen größere und bessere Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich einer eigenverantwortlichen Unterrichtorganisation bieten.
Nach den neuen Richtlinien sollen Erst- und Zweitkläßler eine tägliche Unterrichtszeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, alle Dritt- und Viertklässler von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr haben. Abweichungen in den Anfangs- und Endzeiten, resultierend aus besonderen Bedingungen vor Ort, z.B. bei der Schülerbeförderung, sollen auch künftig in einem festgelegten Rahmen möglich sein.
Ein weiterer, sehr große Veränderungen beinhaltender Punkt auf der Umstukturierungsliste ist die Auflösung des bisherigen 45-Minuten-Taktes zugunsten von 50-Minuten-Einheiten. Dadurch soll eine durchschnittliche Lernzeiterhöhung von 40 Minuten für die Schüler erreicht werden (siehe Tabelle).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: Schwerpunkt: Halbtagsgrundschule S.4)
Einhergehen mit dieser Umstrukturierung der Stundendauer soll auch eine Rhytmisierung des Schulvormittages, die den Kindern ein besseres, effektiveres Lernen ermöglichen soll. Diese Rhymisierung teilt den Schulvormittag in verschiedene Unterrichtsblöcke ein, welche neben den Arbeitsphasen auch verschiedene Phasen der Erholung für die Kinder beinhalten. Dieser Wechsel zwischen den einzelnen Phasen und deren zeitliches Verhältnis soll sich nach dem Alter, der Aufnahmefähigkeit und Belastbarkeit der Schüler richten.
Ein entsprechend rhytmisierter Schulvormittag für könnte demnach etwa so aussehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: Grundschulunterricht 9/1997 S.21)
Um eine derartige Umstrukturierung in der Grundschule überhaupt realisieren zu können, muß konsequenterweise auch eine neue Arbeitszeitregelung für die Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen eingeführt werden. Dies ist bereits jetzt in der Pflichtstundenverordnung § 2 i. d. F. vom Juni 1997 festgelegt: "Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an Grundschulen und in Grundschulklassen an Schulen, die mit der Grundschule verbunden sind, haben eine wöchendliche Präsenzverpflichtung von 26 Zeitstunden. Davon entfallen 22,5 Zeitstunden auf unterrichtsbetreuende Tätigkeiten."
Bleibt zu hoffen, daß das Konzept der vollen Halbtagsschule, welches meiner Meinung nach wirklich gute und wichtige Veränderungen vorsieht, nicht am Rotstift des Finanzministers scheitert, wie dies ja leider bei verschiedenen anderen Institutionen unserer heutigen Bildungslandschaft der Fall ist. ›
Häufig gestellte Fragen zum Konzept der "Vollen Halbtagsschule"
Was ist die "Volle Halbtagsschule"?
Die "Volle Halbtagsschule" ist ein pädagogisches Konzept, das darauf abzielt, den veränderten sozialen und familiären Bedingungen von Kindern Rechnung zu tragen. Es sieht eine Verlängerung der Unterrichtszeiten, verlässliche Betreuungszeiten für Eltern und mehr Selbstständigkeit für die einzelnen Schulen vor, um besser auf die Bedürfnisse der Schüler und die örtlichen Gegebenheiten eingehen zu können.
Warum wurde das Konzept der "Vollen Halbtagsschule" entwickelt?
Das Konzept wurde entwickelt, um dem steigenden Bedarf an Betreuung von Kindern in öffentlichen pädagogischen Einrichtungen gerecht zu werden, insbesondere angesichts der geringen Hortplatzverfügbarkeit und der veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen von Familien. Es soll nicht nur die Betreuungssituation verbessern, sondern auch den pädagogischen Bedürfnissen und den veränderten Erziehungs- und Bildungsansprüchen der Kinder entsprechen.
Welche Veränderungen sieht die "Volle Halbtagsschule" vor?
Die "Volle Halbtagsschule" sieht im Wesentlichen folgende Veränderungen vor: mehr Zeit für Kinder und Lehrer, verlässliche Unterrichtszeiten für Eltern, mehr Selbstständigkeit für die Schulen zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, eine Neustrukturierung der Wochenstunden und die Auflösung des bisherigen 45-Minuten-Taktes zugunsten von 50-Minuten-Einheiten.
Wie sollen die Unterrichtszeiten in der "Vollen Halbtagsschule" aussehen?
Nach den neuen Richtlinien sollen Erst- und Zweitklässler eine tägliche Unterrichtszeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr haben, alle Dritt- und Viertklässler von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Abweichungen in den Anfangs- und Endzeiten sollen in einem festgelegten Rahmen möglich sein.
Was bedeutet die Rhytmisierung des Schulvormittages?
Die Rhytmisierung des Schulvormittages teilt den Schulvormittag in verschiedene Unterrichtsblöcke ein, die neben den Arbeitsphasen auch Phasen der Erholung für die Kinder beinhalten. Der Wechsel zwischen den einzelnen Phasen und deren zeitliches Verhältnis soll sich nach dem Alter, der Aufnahmefähigkeit und Belastbarkeit der Schüler richten.
Welche Arbeitszeitregelung gilt für Lehrerinnen und Lehrer in der "Vollen Halbtagsschule"?
Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an Grundschulen haben eine wöchentliche Präsenzverpflichtung von 26 Zeitstunden, von denen 22,5 Zeitstunden auf unterrichtsbetreuende Tätigkeiten entfallen.
Wann sollte das Konzept in Rheinland-Pfalz eingeführt werden?
Das Konzept sollte zum Jahreswechsel 1998/99 landesweit in Rheinland-Pfalz eingeführt werden. Einige Schulen haben jedoch bereits vorher mit Umstrukturierungen in Richtung des Konzepts begonnen.
Was ist das Rahmenkonzept "Mehr Zeit für Kinder"?
Das Rahmenkonzept "Mehr Zeit für Kinder" ist ein übergeordnetes Konzept, das die "Volle Halbtagsschule" unterstützt. Es zielt darauf ab, den Kindern mehr Zeit zum Lernen, den Eltern verlässliche Betreuungszeiten und den einzelnen Grundschulen größere und bessere Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich einer eigenverantwortlichen Unterrichtorganisation zu bieten.
Was ist die Pflichtstundenverordnung § 2 i. d. F. vom Juni 1997?
Diese Verordnung legt die Arbeitszeitregelung für Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an Grundschulen fest, einschließlich der wöchentlichen Präsenzverpflichtung und der Stunden, die für unterrichtsbetreuende Tätigkeiten aufgewendet werden müssen.
- Quote paper
- Jan Brümmer (Author), 1997, Das Konzept der "vollen Halbtagsschule", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95838