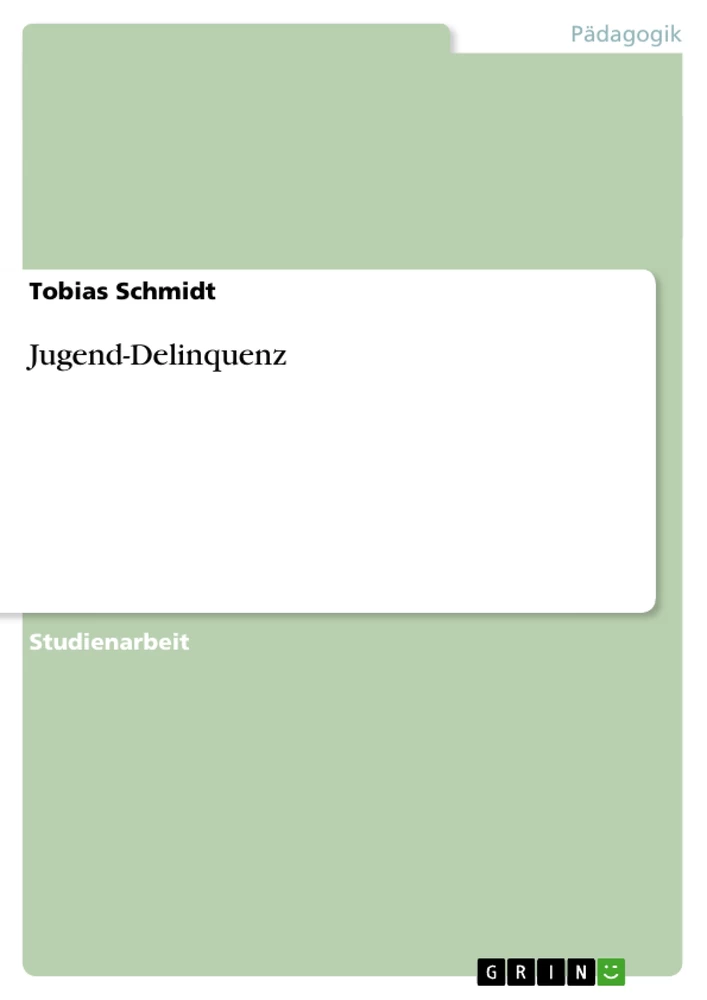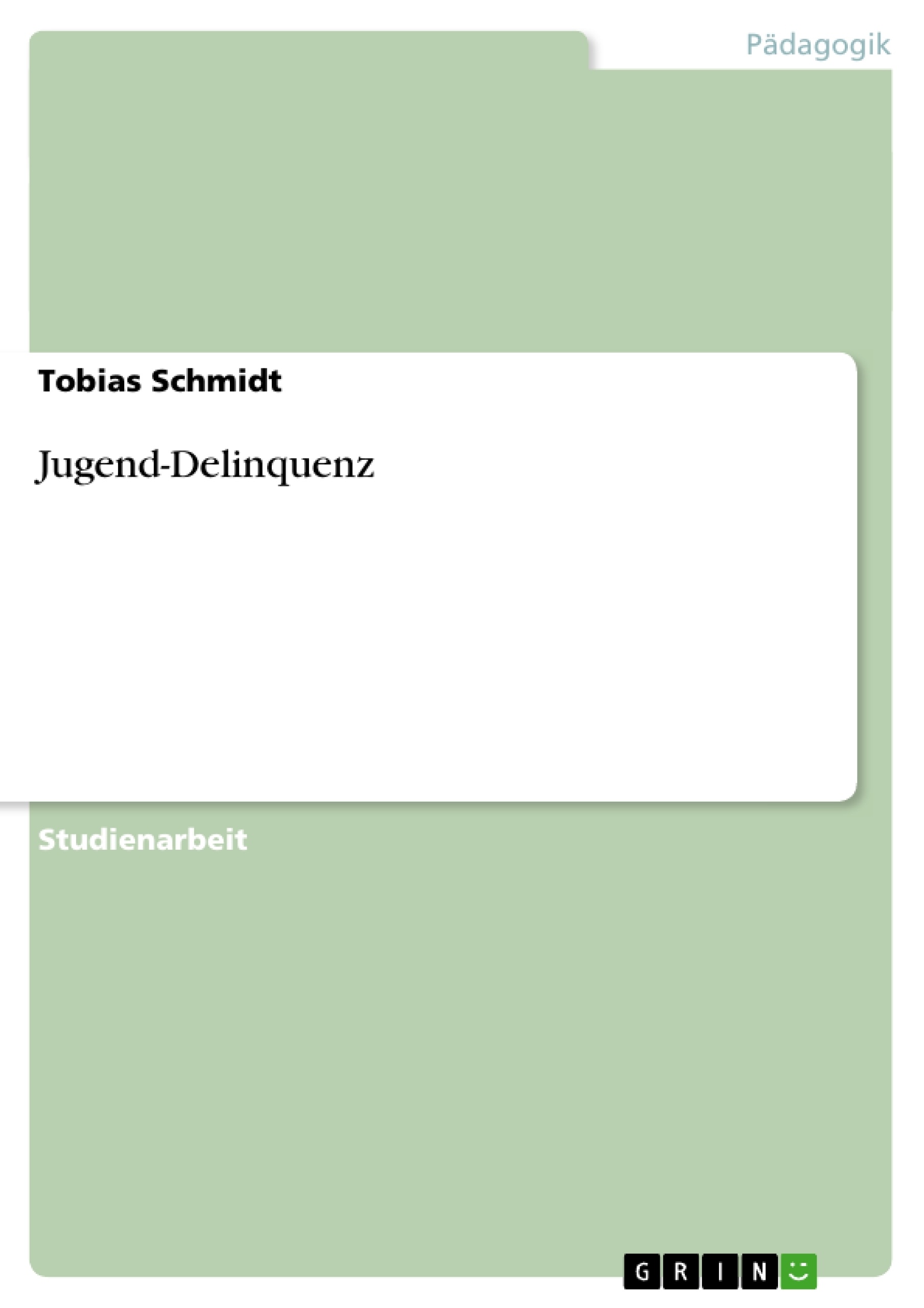Was treibt Jugendliche auf die schiefe Bahn? Tauchen Sie ein in eine tiefgreifende Analyse der Jugenddelinquenz, die nicht nur die statistische Deliktstruktur beleuchtet, sondern auch die komplexen Persönlichkeitsstrukturen junger Straftäter. Diese umfassende Untersuchung widmet sich der Frage, welche soziokulturellen Merkmale, wie Sozialstatus, Schulbildung und Berufsausbildung, eine Rolle spielen und wie diese Faktoren mit kriminellen Verhaltensweisen korrelieren. Erfahren Sie mehr über die psychologischen Erklärungsmodelle, von entwicklungspsychologischen Ansätzen bis hin zu psychoanalytischen, individualpsychologischen und lerntheoretischen Perspektiven, die das kriminelle Verhalten Jugendlicher zu entschlüsseln suchen. Die Auseinandersetzung mit Kriminalbiologischen Theorien bietet einen historischen Kontext und zeigt, wie unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze das Verständnis von Jugendkriminalität geprägt haben. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendkriminalität, unter Berücksichtigung des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) und der darin vorgesehenen Erziehungsmaßregeln. Die kritische Auseinandersetzung mit politischen Vorschlägen, wie der Absenkung des Strafmündigkeitsalters, eröffnet neue Perspektiven auf die Prävention und Intervention. Abschließend werden praxisorientierte Diversionsmaßnahmen und innovative Projekte vorgestellt, die sich in der Alten-, Behinderten- und Krankenhilfe bewährt haben. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Pädagogen, Sozialarbeiter, Juristen und alle, die sich mit den Ursachen und Konsequenzen von Jugendkriminalität auseinandersetzen möchten. Es bietet fundierte Einblicke in die Lebenswelten junger Straftäter und zeigt Wege auf, wie man ihnen helfen kann, ein straffreies Leben zu führen. Schlüsselwörter: Jugenddelinquenz, Kriminalität, Persönlichkeitsstruktur, Erklärungsmodelle, Maßnahmen, Jugendgerichtsgesetz, Sozialisation, Prävention, Intervention, Erziehungsmaßregeln, Viktimologie, Strafrecht, Psychologie, Soziologie, Sozialarbeit, Pädagogik, Kriminologie, Jugendstrafrecht, Resozialisierung, soziale Arbeit, abweichendes Verhalten, Normen und Werte, Deliktanalyse, Ursachenforschung, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Gesellschaftsanalyse, empirische Forschung, Fallstudien, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Jugendhilfe, Familie, Schule, Ausbildung, Integration, Ausgrenzung, Gewaltprävention, Suchtprävention, Extremismusprävention, Radikalisierung, Integration, soziale Kompetenzen, Lebenskompetenzen, Medienkompetenz, Opferschutz, Täter-Opfer-Ausgleich, Konfliktlösung, Mediation, soziales Lernen, Moralentwicklung, ethisches Bewusstsein, gesellschaftliche Verantwortung, Zivilcourage, Toleranz, Vielfalt, Inklusion, Partizipation, Empowerment, Selbstwirksamkeit, Lebensperspektiven, Zukunftschancen, Entwicklungsförderung, Persönlichkeitsentwicklung, Bildung, Erziehung, Wertevermittlung, Vorbilder, Mentoring, Netzwerke, Kooperation, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Qualitätsstandards, Evaluation, Forschungsergebnisse, Best Practices, Innovationen, gesellschaftlicher Wandel, soziale Herausforderungen, Lösungsansätze, Zukunftsperspektiven.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Jugend-Delinquenz
2. Deliktstruktur
3. Persönlichkeitsstruktur der Straftäter
4. Erklärungsmodelle kriminellen Verhaltens
5. Maßnahmen
6. Quellenverzeichnis
Anhang
Delinquentes Verhalten - Kriminalität
1. Jugend-Delinquenz
Begriffliche Klärung
Der Begriff der Delinquenz hat seinen Ursprung im Englischen und umfasst ein „gegen geltende Gesetze verstoßendes Verhalten, das differenzierter benannt werden kann als Pflichtverletzung, Missetat, Vergehen und Verbrechen.“ (Myschker 1996, 377)
Kriminalität und Delinquenz bedeuten in etwa das Gleiche.
Als Straftäter laut Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind folgende Jugendliche und Heranwachsende zu betrachten:
§ 1 Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.
(2) Jugendlicher ist, wer z.Z. der Tat vierzehn, aber noch nicht acht- zehn, Heranwachsender, wer z.Z. der Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig Jahre alt ist.
§ 3 Verantwortlichkeit. Ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn er z.Z. der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.
Jedes Kind vor Vollendung des 14. Lebensjahres ist nicht strafrechtlich verantwortlich. Das Strafgesetzbuch wird zur Definition von Straftaten bei Jugendlichen und Heranwachsenden ebenso herangezogen, wie bei Erwachsenen.
Entwicklung und Verständnis von Jugend
Häufig werden mit dem Begriff Jugend Vorstellungen verbunden, wie körperliches und psychisches Jung-Sein, „von Unfertigkeit, Unerfahrenheit von Sorglosigkeit oder Optimismus.“ (Walter 1995, 45)
Jugend jedoch genau zu definieren fällt sehr schwer, da es nicht allein auf das bestimmte Lebensalter, sondern auch „auf die Umschreibung einer Lebensphase“ (ebd.) ankommt. Diese ist wiederum von sozialen Bedingungsgefügen, wie Schule, gekennzeichnet. Ehe man eine Beziehung zwischen Jugend und Kriminalität herstellen kann, ist es zunächst nötig, das Wesen der Jugend zu erfassen.
Geschichtlich betrachtet gibt es Gesellschaften, so z.B. das Mittelalter, in denen die Phase „Jugendalter“ gänzlich fehlte. An die Kindheit schloß sich gleich das Erwachsensein an. Jugend ist also nicht als „etwas Absolutes und von sozialen Entwicklungen Unabhängiges“ (ebd.) feststellbar, sie wird als „ folgenbezogen definiert “ (ebd.).
Wenn eine Gesellschaft also Jugend als etwas zweckmäßiges oder notwendiges anerkennt, bildet sich also Jugend als ein entsprechender Status heraus. Notwendig können Jugendphasen werden, um z.B. „...einen passenden Rahmen zur Erfüllung erhöhter beruflicher Ansprüche zu schaffen.“ (Walter 1995, 46) Diese gesellschaftlichen Anliegen an solch eine Phase prägen natürlich den zeitlichen Begriff von Jugend.
Thematisiert man nun Jugend speziell in Zusammenhang mit Jugendkriminalität, müssen die gesellschaftlichen Interessen, die zur Herausbildung einer solchen Untergruppe von Kriminellen geführt haben, „...zugleich im maßgeblichen Jugendverständnis“ (ebd.) nachgewiesen werden. Im folgenden soll nun ein mittelbarer Zusammenhang betrachtet werden, da direkte und unvermittelte Einflüsse kaum zu erwarten sind: „Das strafrechtliche Interesse bewirkt die Bevorzugung derjenigen wissenschaftlichen Sichtweisen, über die mit dem Jugendbegriff verbundene Kontrollanliegen besonders gut befördert werden können...“ (ebd.). Trotha ist sogar der Ansicht, dass Jugend und Jugendkriminalität nicht zwei voneinander trennbare Begriffe darstellen. Der Jugendbegriff sei geschaffen worden, „um junge Menschen der Kontrolle berufsmäßiger Sozialisatoren zu unterstellen...“ (ebd.).
Bestehen sogenannte Jugendkulturen, ergibt sich daraus eine besondere Verbindung zwischen Jugend und abweichendem Verhalten, da diese eine „Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften“ (ebd.) darstellen. Laut Kohlbergs Theorie von der Entwicklung des moralischen Bewußtseins wird eine natürlich begründete Verbindung zwischen Jugend und fehlender Moralität und damit verbundenen Normbrüchen dargestellt. Jeder sich in der Moralentwicklung befindender, durchläuft verschiedene Moralstufen, jede nachfolgende Stufe stellt ein höheres Niveau dar. Hat ein Jugendlicher die unteren Stufen noch nicht durchschritten und abgeschlossen, sind Abweichungen von der Norm zu erwarten.
Ausgehend von speziellen Jugendproblemen, wie Haschischrauchen, Protestverhalten oder sogar Vandalismus, was ebenfalls ein abweichendes Verhalten darstellt, ergeben sich enge Verbindungen von Jugend und Kriminalität. Einzelne Verhaltensmuster, wie z.B. Gruppenbildung oder politische Aktivitäten stellen in der gesellschaftlichen Abfolge eine positive Einschätzung dar. Probleme treten dann auf, wenn man bei Gruppenbildung an Fußballrowdies oder Strassengangs denkt, oder bei politischer Betätigung in Hinblick auf links- wie rechtsradikale Tendenzen, an extremistische Aktivitäten.
2. Deliktstruktur
Bei Tatverdächtigen und bei Verurteilten stehen Vermögensdelikte deutlich im Vordergrund, wenn man einmal von Straftaten im Strassenverkehr absieht. 1989 => 19561 Jugendliche wegen Diebstahls und Unterschlagung verurteilt Diese Zahl schlüsselt sich noch wie folgt auf: 12407 wegen Diebstahls 6674 wegen schweren Diebstahls 332 wegen Unterschlagung Setzt man diese Zahlen in Beziehung zu den 38020 verübten Verbrechen und Vergehen, stellen diese einen Prozentsatz von 51,44 % dar. Addiert man auch Raub, Erpressung, Begünstigung und Hehlerei, Betrug und Untreue, Urkundenfälschung und Falschbeurkundung dazu, dann ergibt sich ein Prozentsatz von 65,06 %. Schliesst man in den Betrachtungen die Straßenverkehrsdelikte aus, so ergeben sich 78,6 %. Führt man die gleiche Betrachtungsweise bei Heranwachsenden und Erwachsenen durch, ergeben sich deutlich niedrigere Werte von 62,8 % bzw. 60,9 %. Hierdurch wird verdeutlicht, daß Vermögensdelikte alterspezifisch sind. Es wird die Aufgabe des Pädagogen deutlich, nach Ursachen, Kriminalprophylaxe und korrigierenden Maßnahmen zu suchen und dementsprechend zu verfahren. Mit großem Abstand zu den Vermögensdelikten folgen Straftaten in allen Betrachtungsgruppen gegen Personen, unter die Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, aber auch Mord, Totschlag, Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung fallen. Straftaten gegen Personen 1989:
von Jugendlichen 3997,
von Heranwachsenden 7053 und von Erwachsenen 49038.
Soziokulturelle Merkmale der Straftäter
Nachfolgend sollen in diesem Zusammenhang soziokulturelle Merkmale, wie Sozialstatus, Schulbildung und Berufsausbildung betrachtet werden.
Nach Untersuchungen in Jugendanstalten in Norddeutschland konnte festgestellt werden, dass 2/3 von inhaftierten Jugendlichen aus der unteren und oberen Schicht stammen. Diese Untersuchungen wurden nach Kriterien wie Beruf und Einkommen der Eltern, eigene Schul- und Berufsausbildung durchgeführt. Im Gegensatz zum Strafvollzug, wo 33,7 % der Unter- bzw. Oberschicht angehören, sind in Jugendanstalten Inhaftierte der Unterschicht deutlich überrepräsentiert.
Jugendliche, die straffällig geworden sind, weisen in Beziehung zu nicht straffällig gewordenen einen deutlichen Besuch der Schule für Lernbehinderte und Schulbesuch verbunden mit geringem Erfolg auf. Ähnliches kann auf Jugendliche ohne Hauptschulabschluß übertragen werden. Absolventen der Hauptschule sind Untersuchungen zufolge in Strafanstalten deutlich weniger anzutreffen. Real- und Gymnasialschüler kommen nur selten vor. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass schlechte Schulbildung einen kriminell- werdenden Faktor besitzt, jedoch steht geringer Schulerfolg in enger Beziehung zu Verwahrlosung. Probleme wie Schuleschwänzen, sozial unangepaßtes Verhalten und Herumstreunen als Indikatoren für Verwahrlosung haben eine „...prognostische Bedeutung...“ (Myschker 1996, 380), d.h. es besteht „...die Gefahr einer kriminellen Entwicklung...“ (ebd.).
Da schlechte Schulausbildung auch Auswirkung auf die spätere Berufslaufbahn hat, weil Chancen gemindert werden, hat sie ebenfalls Bedeutung. Man kann also vermuten, dass ein erheblicher Teil von Inhaftierten auch die berufliche Entwicklung nicht erfolgreich gemeistert hat. Ein Großteil von inhaftierten Jugendlichen hat überhaupt noch keine abgeschlossene Berufsausbildung, Strafgefangene mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung sind eher selten.
Zusammenfassend läßt sich also sagen, dass die Jugendlichen
Verhaltensweisen, „...-zumeist auf dem Hintergrund einer fehlenden Einbettung in ein geordnetes und tragendes Familienleben-...“ (ebd.), entwickelt haben, die einer kriminellen Entwicklung dienend gegenüber stehen. Darunter versteht man z.B. geringe Frustrationstoleranz, geringe Zielverfolgungsbereitschaft über längere Zeiträume, Verlangen nach sofortiger Bedürfnisbefriedigung, Bereitschaft zu aggressiver Konfliktlösung, reduzierte personale Bindungsfähigkeit.
Neben geringen Schul- und Berufserfolgen zeigen delinquente Jugendliche auch eine Persönlichkeitsproblematik, die für die Förderung von kriminellen Verhaltens von Bedeutung ist und im folgenden Teil näher erläutert werden soll!
3. Persönlichkeitsstruktur der Straftäter
Die im obigen Abschnitt getroffenen Aussagen zur Entwicklung der Jugendlichen Straftäter in Familie, Schule oder Beruf gibt Anlass zur Annahme, das sie „... kriminalitätsfördernde Persönlichkeitsdimensionen entwickelt haben.“ ( Myschker 1996, 380 )
Myschker wertet in seinem Buch empirische Untersuchungen aus, die im Jugendstrafvollzug gemacht wurden. Er kommt zu der Erkenntnis, dass die Jugendlichen wie folgt zu charakterisieren sind: Sie sind als „... überdurchschnittlich psychophysisch gestört und unausgeglichen (Dimension Nervosität - Ner), als aggressiv, emotional unreif, impulsiv und unbeherrscht (Dimension Aggression - Agg), als mißgestimmt, unsicher, ängstlich und konzentrationsschwach (Dimension Depressivität - Dep), als reizbar, leicht frustriert, unverträglich und intolerant (Dimension Erregbarkeit - Err) und als durchsetzungsstark, streng, engstirnig, intrigant, argwöhnisch und egozentrisch (Dimension Dominazst reben - Dom)“ (Myschker 1996, 381) einzuordnen.
Aufgrund der eben angeführten Normabweichungen sieht man den größten Teil dieser Jugendlichen im Strafvollzug als verhaltensgestört an und sie sind durch pädagogische und therapeutische Maßnahmen zu fördern. Myschker versucht zu verdeutlichen, dass delinquente Jugendliche und Heranwachsende „... als psychosozial gestört anzusehen sind...“ (Myschker 1996, 382).
4. Erklärungsmodelle kriminellen Verhaltens
Kriminalbiologische Theorien
Nach der sozialdarwinistischen Theorie von Lombroso besteht ein Zusammenhang zwischen der erblichen Anlage und delinquenten Verhaltens. In seinen Untersuchungen stellte er eine kriminelle und eine nicht kriminelle Gruppe gegenüber und verglich u.a. folgende Merkmale: „ Schädelkapazität, fliehende Stirn, Entwicklung der Kiefer- und Jochbögen, dichtes krauses Haar, große Ohren, Anomalien des Ohrs, Sehschärfe usw.“ (Myschker 1996, 384)
Schlussendlich beschrieb Lombroso den „geborenen Verbrecher“ als einen Menschen, der körperlich und seelisch auf einer niedrigeren menschlichen Entwicklungsstufe steht und damit kriminellen Neigungen ausgeliefert sei. Obwohl von mehreren Wissenschaftlern solche Theorien widerlegt wurden, werden auch heute noch kriminalbiologische Theorien vertreten und Straftäter als menschlich unterentwickelte Individuen betrachtet, die durch ihr kriminelles Verhalten versuchen, etwaige Fehlentwicklungen auszugleichen.
Solche Theorien stiessen gerade in der Nazizeit in Deutschland auf fruchtbaren Boden, denn damit wurden wissenschaftliche Begründungen gegeben, solches unwertes Leben zu vernichten. In der Folgezeit wurden immer neue Theorien in Bezug auf Erblichkeit kriminellen Verhaltens aufgestellt, die jedoch sehr widersprüchliche Züge annehmen.
Psychologische Theorien
Versucht man delinquentes Verhalten unter psychologischen Aspekten zu erklären, sind dabei besonders entwicklungspsychologische, psychoanalytische, individualpsychologische und lernpsychologische Ansätze heranzuziehen.
Entwicklungspsychologischer Ansatz:
Wie in der Einleitung dieser Arbeit beschrieben, versteht man in der heutigen Gesellschaft auf gesetzlicher Grundlage Jugend zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr. Erst seit kurzer Zeit, anhand neuer entwicklungspsychologischer Erkenntnisse, werden Kindheit und Jugend als separate Lebensabschnitte eines Menschen gesehen.
Betrachtet man die Phase der Jugend entwicklungspsychologisch, so ist diese nur schwer zeitlich abzugrenzen. In der Jugendphase erwirbt ein Mensch Identitätskompetenzen, genauer gesagt „... die Entwicklung eines stabilen, starken, steuerungs- und kontrollfähigen Ichs.“ (Myschker 1996, 385). So stellen sich für Jugendliche Anforderungen die häufig eine innere Zerrissenheit und Überlastung darstellen, es treten Reibungen mit Eltern oder sonstigen Bezugspersonen, in anderen Fällen sogar Verhaltensschwierigkeiten und oft Devianz auf. Behinderte Jugendliche brauchen in dieser Entwicklungsphase besondere Unterstützung, da sie noch größeren Anforderungen gegenüberstehen.
Myschker zitiert die besonderen Entwicklungsaufgaben nach einem Aufsatz von Oerter in Oerter, R./ Montada, L. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie. München 1982, S. 242-313:
1. „Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung und effektive Nutzung der Körpers.“
2. „Erwerb der männlichen bzw. weiblichen Rolle.“
3. „Erwerb neuerer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts.“
4. „Gewinnung emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen.“
5. „Vorbereitung auf eine berufliche Karriere.“
6. „Vorbereitung auf Heirat- und Familienleben.“
7. „Gewinnung eines sozial verantwortungsvollen Verhaltens.“
8. „Aufbau eines Wertsystems und eines ethischen Bewußtseins als Richtschnur für eigenes Verhalten.“
Durch viele weitere Probleme der persönlichen Entwicklung in der Jugend, die ich im folgenden nicht alle aufzählen will, werden noch weitere verursacht. Das sind u.a.:
- eine früherer Abschluss der physischen Entwicklung
- lange Ausbildungszeiten im Beruf
- Übernahme negativer Bilder gesellschaftlichen Verhaltens
- Gruppenzwänge um „dazuzugehören“
Psychoanalytischer Ansatz:
Basierend auf Erkenntnissen des Darwinismus wird kriminelles Verhalten hier als „... Triebdurchbrüche aus dem Es, als Regressionen der Libidoentwicklung oder als Identifikationsproblematik...“ (Myschker 1996, 386) dargestellt. Die Ursache kriminellen Verhaltens wird hierbei in der frühen Kindheit gesehen, da das Kind als eines seinen kriminellen Trieben ausgesetztes Wesen auf die Welt kommt. Es muss der Aufbau eines kontrollierenden und steuernden Ichs erfolgen. Kriminelles Verhalten zeigt sich, wenn die Ausbildung eines solchen Ichs zu schwach war und sich somit nicht den Triebdurchbrüchen des Es widersetzten kann.
Andererseits kann der mit Schuldgefühlen gekoppelte Ödipuskomplex entwickelt sein, der ein delinquentes Verhalten unterstreicht und ein Bedürfniss solchen hervorruft. Begeht man dann eine Straftat kommt es zu einer seelischen Entlastung, nach Freud wird „...das ödipale Schuldgefühle abgebaut.“ (Myschker 1996, 387).
Zusammenfassend sagt man, dass kriminelles Verhalten „ Ergebnis mißlungener Sozialisation...“ (ebd.) ist und seine Begünstigung im Erziehungsstil der Eltern liegt, was durch folgendes Verhalten gekennzeichnet ist: Unfähigkeit, ablehnende Haltung, Lieblosigkeit, Kälte, Inkonsequenz und Überforderung.
Individualpsychologischer Ansatz:
„Nach Alfred Müller steht jeder Mensch ob seiner organischen Minderwertigkeit in der Gefahr, über Minderwertigkeitsgefühle und Kompensationen kriminelles Verhalten zu zeigen.“ (Myschker 1996, 387) So kommt es bei Kindern dazu, dass sie gegenüber den Erwachsenen eine organische Minderwertigkeit erleben, ein Machtstreben entwickeln und damit versuchen, Überlegenheit zu erreichen. Wenn dazu das Gemeinschaftsgefühl aufgegeben wird, kann sich eine kriminelle Entwicklung anbahnen. Im individualpsychologischen Ansatz werden als ausschlaggebend genannt: organisch oder sozial begründete Minderwertigkeitsgefühle, hohes Geltungsbedürfnis und Streben nach Macht einerseits und Entmutigung, sowie andererseits ein aufgegebenes Gemeinschaftsgefühl. Endkonsequenz für eine solche Entwicklung ist ein kriminelles Lebensbild und ein solches Selbstbild.
Lerntheoretischer Ansatz
Betrachtet man kriminelles Verhalten unter lerntheoretischen Aspekten, so wird es ebenso wie Sozialverhalten erlernt. Hierbei spielen die Lernprinzipien des Modellernes, des Klassischen Konditionierens und des Operanten Konditionierens eine tragende Rolle.
Die Theorie von Sutherland versucht zu erklären, wie Individuen kriminelle Werte und Normen übernehmen, man kann sie laut dem Buch von Myschker in folgenden Thesen zusammenfassen:
„1. Das kriminelles Verhalten wird erlernt.
2. Das kriminelle Verhalten wird in der Interaktion mit anderen Personen in einem Kommunikationsprozeß erlernt.
3. Der Hauptteil des Lernprozesses, in dem kriminelles Verhalten erworben wird, vollzieht sich im Rahmen intimer persönlicher Gruppen.
4. Das Erlernen von kriminellen Verhalten umfaßt sowohl Techniken, mit deren Hilfe das Verbrechen begangen wird, als auch spezifische Richtung der entsprechenden Beweggründe, Strebungen, Rationalisierungen und Einstellungen.
5. Die spezifische Richtung der Motive und Triebe wird durch die Definition der Gesetzesbücher als gesetzmäßig oder gesetzeswidrig erkannt.
6. Eine Person wird delinquent, wenn sie mehr Definitionen erlernt, welche die Gesetzesübertretungen begünstigen, als solche, welche sie mißbilligen.
7. Differentielle Kontakte können verschieden sein nach Häufigkeit, Dauer, Priorität und Intensität.
8. Der Prozeß des Erlernens von kriminellen Verhalten aufgrund der Assoziation mit kriminellen und antikriminellen Kulturmustern umfaßt die gleichen Mechanismen, die sich auch in allen anderen Lernprozessen finden.
9. Obgleich das kriminelle Verhalten eine Ausdrucksform allgemeiner
Bedürfnisse und Werte darstellt, kann es nicht aus diesen allgemeinen Bedürfnissen und Werten erklärt werden, da nicht kriminelles Verhalten dieselben Bedürfnisse und Werte zum Ausdruck bringt.“
(Myschker 1996, 387 f. aus: Göppinger, H.: Kriminologie - Eine Einführung. München 1971)
Soziologische Theorien
Die soziologischen Erklärungsmodelle für abweichendes Verhalten kann man zusammenfassend als Ergänzung ansehen. Auf diese soll hier nicht weiter eingegangen werden.
5. Maßnahmen
In diesem Abschnitt sollen nur kurz die Maßnahmen aus dem Buch von Myschker zitiert werden, vielmehr eine Rede des Bundestagsabgeordneten Eckart von Klaeden (CDU), der sich mit „Vorschläge zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität“ eingehender befasst hat. Im Zuge derzeitiger politischer Diskussionen um die Errichtung von Erziehungsanstalten erachte ich diese Verfahrensweise als effektiver und interessanter.
Denkt man über Maßnahmen bei Jugendkriminalität nach, muss man sich natürlich auf der gesetzlichen Grundlage des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) bewegen. Nun folgend soll kurz beschrieben werden, welche Maßnahmen die gesetzliche und damit staatliche Seite vorsieht.
Im §5 findet man im Abschnitt (1): „ Aus Anlaßder Straftat eines Jugendlichen können Erziehungsmaßregeln angeordnet werden. “
Das Gesetz fordert weiter, wenn Erziehungsmaßregeln nicht ausreichend sind, Zuchmittel einzusetzen oder Ahndung mit Jugendstrafe. Davon wird abgesehen, wenn die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus oder Erziehungsanstalt durch den Richter verfügt wurde.
Was sind Erziehungsmaßregeln?
Dazu findet man in §9 des JGG:
„ 1. die Erteilung von Weisungen,
2. die Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung im Sinne des § 12. “
Weisungen sind Gebote und Verbote, die zur Regelung des Lebens des Jugendlichen bestimmt sind, die erziehungsfördernd sein sollen. Solche Weisungen können auch die Wohnpflicht bei den Eltern, Gebundenheit an einen bestimmten Aufenthaltsort, Betreuungsangebote zu nutzen oder Teilnahme an Verkehrsunterricht sein.
Heute setzen allerdings Richter verstärkt auf Diversion (englisch: Umleitung). Dabei haben sich als günstige Diversionsmaßnahmen, so „z.B. Formen des Täter-Opfer-Ausgleichs und Projekte in der Alten-, Behinderten- und Krankenhilfe erwiesen.“ (Myschker 1996, 389)
Eckart von Klaeden (MdB) hielt seine Rede zur Bekämpfung von Kinder- und
Jugendkriminalität schon im September 1997. Er nennt darin drei Maßnahmen die derzeit politisch diskutiert werden:
1. Absenkung des Strafmündigkeitsalters von 14 auf 12 Jahre
2. Stärkere oder generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende (18-21 Jahre)
3. Anhebung der Höchststrafe im Jugendstrafrecht von 10 auf 15 Jahre Freiheitsstrafe für besonders schwere Straftaten Heranwachsender zu 1.)
Seiner Ansicht nach löst die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters die Probleme mit straffällig gewordenen Jugendlichen nicht, mit dieser Maßnahme ist ein nennenswerter „Abschreckungseffekt“ nicht zu erreichen. Er betont, dass als Voraussetzung für eine Verurteilung die individuelle Strafreife festzustellen wäre. Da dies aber meistens nicht gelingen wird, führt das nicht automatisch zu einer steigenden Zahl von Verurteilungen. Deshalb seine Forderung: Bestrebungen, die verhindern sollen, dass Kinder Straftaten begehen, müssen sich auf präventive, erzieherische Handlungsmöglichkeiten konzentrieren.
Polizeiliche Maßnahmen reichen bei Kindern die erstmals eine leichte Straftat begehen, wie Ladendiebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung, aus, um eine andauernde „Abschreckung“ zu erreichen.
Probleme sieht von Klaeden bei Kindern, die die Intensität ihrer Straftaten steigern, wie bei Raub und Erpressung. Dabei kommt es häufig vor, dass diese Kinder die Straftaten im Bewusstsein ihrer Strafunmündigkeit begehen und sich von polizeilichen Maßnahmen nicht beeindrucken lassen.
In der Praxis wird bereits derzeit bei unter 16-jährigen keine Jugendstrafe verhängt, da harte Interventionen im Gegenteil häufig „kriminalisierend“ bzw. „kriminalitätsverfestigend“ wirken. zu 2.)
In den vergangenen Jahren ist bei bis zu 60 % der heranwachsenden Kriminellen das Jugendstrafrecht zur Anwendung gekommen. Entwicklungspsychologische Erkenntnisse haben gezeigt, dass die Phase des Erwachsenwerdens oft bis über das 20. Lebensjahr hinausreicht, ausserdem bietet das Jugendstrafrecht differenziertere Möglichkeiten der Einwirkung auf die Täter als das allgemeine Strafrecht.
Die oft und zu recht beklagten Erziehungsdefizite in der heutigen Gesellschaft können bei straffällig gewordenen Heranwachsenden gerade nicht dadurch gelöst werden, dass das Ziel der Erziehung hinter den allgemeinen Strafzwecken des Erwachsenenstrafrechts zurücktritt.
Im allgemeinen Strafrecht wird bei bis zu 80 % der Fälle Geldstrafe verhängt, diese Strafe ist jedoch nicht jugendgemäß. Durch das Mittel der Weisung (s. § 10 JGG) besteht ausserdem die Möglichkeit, Sanktionen auf die jeweilige Täterperson individuell abzustimmen, fordert von Klaeden. zu 3.)
Bei Straftaten Heranwachsender, die im allgemeinen Strafrecht mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, sollte die Höchststrafe im JGG auf 15 Jahre heraufgesetzt werden. Bei gemeinschaftlich von Erwachsenen (über 21 Jahre) und Heranwachsenden oder Jugendlichen begangenen Taten ist sonst das Gerechtigkeitsgefühl der Allgemeinheit und der erwachsenen Straftäter empfindlich gestört. Schwerkriminellen Jugendlichen muss, wenn eine Verurteilung nach dem allgemeinen Strafrecht nicht möglich oder angezeigt ist, trotzdem die volle Härte des Gesetzes treffen. Auch systematisch bietet sich die Erhöhung auf 15 Jahre an, da nach dieser Zeit auch die lebenslange Freiheitsstrafe des allgemeinen Strafrechts nach der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes überprüft werden muss, sagt von Klaeden abschliessend.
Im Anhang ist noch ein Statement von Johann Hahlen, Präsident des Statistischen Bundesamtes, beigelegt, das neuere Zahlen zur derzeitigen Situation krimineller Jugendlicher enthält.
6. Quellenverzeichnis
Myschker, Norbert: Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen : Erscheinungsformen - Ursachen - hilfreiche Massnahmen / Norbert Myschker. - 2. Aufl. - Stuttgart ; Berlin ; Köln : Kohlhammer, 1996
Walter, Michael: Jugendkriminalität : eine systematische Darstellung / von Michael Walter. - Stuttgart ; München ; Hannover ; Berlin ; Weimar ; Dresden ; Boorberg, 1995
Haferkamp, Hans: Kriminelle Karrieren : Handlungstheorie - Teilnehmende Beobachtung und Soziologie krimineller Prozesse / Hans Haferkamp. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1975
Petermann, Franz (Hrsg.): Verhaltensgestörtenpädagogik: neue Ansätze und ihre Erfolge / hrsg. von Franz Petermann. - Berlin: Marhold, 1987
Linden, Michael (Hrsg.): Verhaltenstherapie: Techniken, Einzelverfahren und Behandlungsanleitungen / M. Linden ; M. Hautzinger (Hrsg.). - 3. überarb. und erw. Auflage. - Berlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Budapest ; Hongkong ; London ; Mailand ; Paris ; Santa Clara ; Singapur ; Tokio : Springer, 1996
Internet:
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text behandelt Jugenddelinquenz und Kriminalität, einschließlich Definitionen, Deliktstruktur, Persönlichkeitsstruktur von Straftätern, Erklärungsmodelle kriminellen Verhaltens und entsprechende Maßnahmen.
Wie wird Delinquenz im Text definiert?
Delinquenz wird als ein „gegen geltende Gesetze verstoßendes Verhalten“ definiert, das differenzierter als Pflichtverletzung, Missetat, Vergehen und Verbrechen benannt werden kann. Im Wesentlichen wird es synonym zu Kriminalität verwendet.
Wer gilt laut Jugendgerichtsgesetz (JGG) als Straftäter?
Laut JGG gelten Jugendliche (14-17 Jahre) und Heranwachsende (18-20 Jahre) als Straftäter, wenn sie eine Verfehlung begehen, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist, und wenn der Jugendliche nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.
Welche Delikte stehen bei Jugendlichen im Vordergrund?
Bei Tatverdächtigen und Verurteilten stehen Vermögensdelikte deutlich im Vordergrund, abgesehen von Straftaten im Straßenverkehr. Dazu gehören Diebstahl, Unterschlagung, Raub, Erpressung, Betrug und Urkundenfälschung.
Welche soziokulturellen Merkmale haben straffällige Jugendliche häufig?
Straffällige Jugendliche stammen häufig aus der unteren Schicht, haben geringe schulische Erfolge (z.B. Besuch der Schule für Lernbehinderte, kein Hauptschulabschluss) und keine abgeschlossene Berufsausbildung.
Wie wird die Persönlichkeitsstruktur der Straftäter beschrieben?
Die Persönlichkeitsstruktur der Straftäter wird als psychophysisch gestört, unausgeglichen, aggressiv, emotional unreif, impulsiv, unbeherrscht, missgestimmt, unsicher, ängstlich, konzentrationsschwach, reizbar, leicht frustriert, unverträglich, intolerant, durchsetzungsstark, streng, engstirnig, intrigant, argwöhnisch und egozentrisch beschrieben.
Welche Erklärungsmodelle für kriminelles Verhalten werden genannt?
Es werden verschiedene Erklärungsmodelle genannt, darunter kriminalbiologische Theorien (z.B. Lombroso), psychologische Theorien (entwicklungspsychologisch, psychoanalytisch, individualpsychologisch, lernpsychologisch) und soziologische Theorien.
Welche Maßnahmen gegen Jugendkriminalität werden diskutiert?
Diskutiert werden Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Jugendstrafe, Diversion (Täter-Opfer-Ausgleich), Absenkung des Strafmündigkeitsalters, stärkere Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende und Anhebung der Höchststrafe im Jugendstrafrecht.
Was sind Erziehungsmaßregeln laut JGG?
Erziehungsmaßregeln sind die Erteilung von Weisungen und die Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung. Weisungen können Gebote und Verbote sein, die zur Regelung des Lebens des Jugendlichen bestimmt sind und erziehungsfördernd sein sollen.
Welche Kritikpunkte werden an bestimmten Maßnahmen geäußert?
Die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters wird als nicht zielführend angesehen, da sie keinen nennenswerten Abschreckungseffekt habe. Zudem könnten zu harte Interventionen bei Jugendlichen kriminalitätsverfestigend wirken. Die Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende wird kritisiert, da das Jugendstrafrecht differenziertere Möglichkeiten der Einwirkung auf die Täter biete.
- Quote paper
- Tobias Schmidt (Author), 1999, Jugend-Delinquenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95819