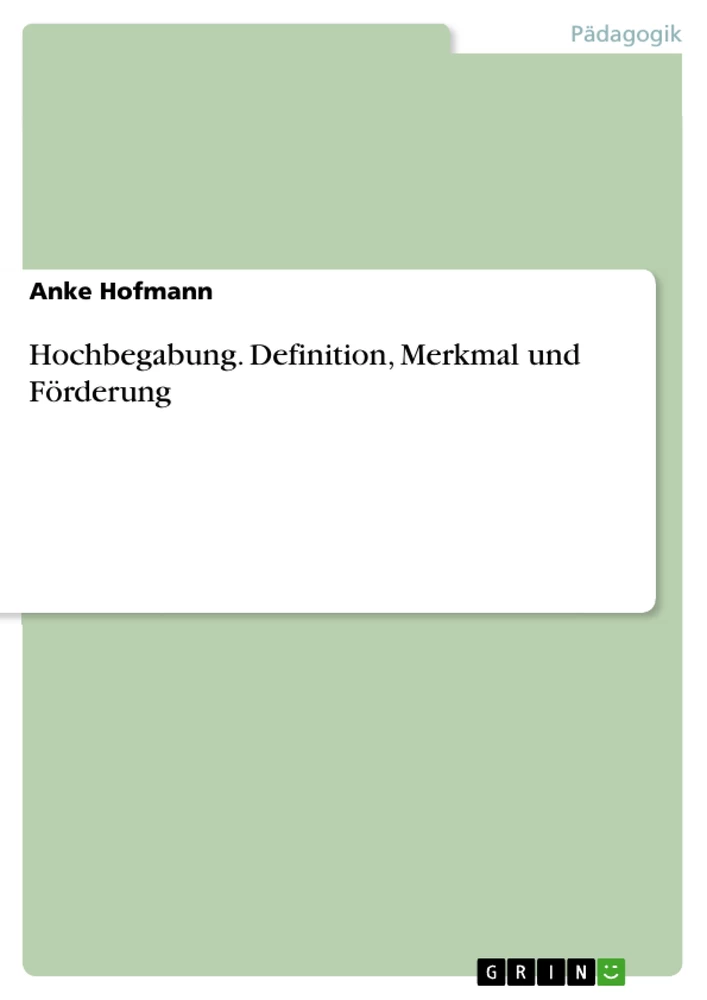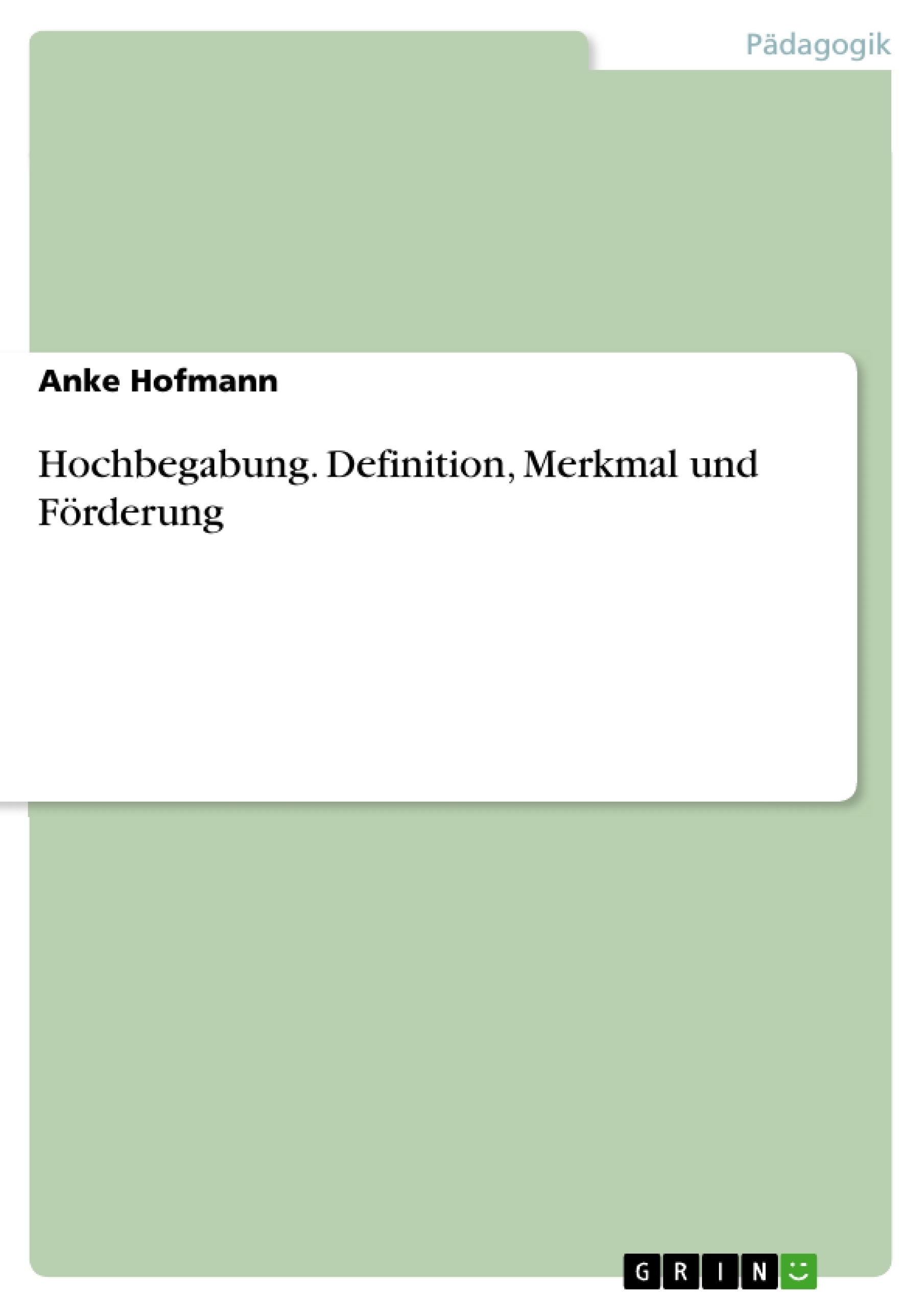Entdecken Sie die faszinierende Welt der Hochbegabung, ein ebenso komplexes wie vielschichtiges Phänomen, das weit mehr umfasst als nur einen hohen IQ. Diese tiefgründige Analyse beleuchtet die verschiedenen Definitionen und Erklärungsansätze, von den Fähigkeitsmodellen bis hin zu soziokulturell orientierten Perspektiven, und enthüllt, wie innere Faktoren wie Fleiß und Neugier, äußere Einflüsse wie Erziehung und Zufallsfaktoren ineinandergreifen, um das Potenzial eines hochbegabten Menschen zu entfalten oder zu hemmen. Anhand historischer Meilensteine, von den visionären Ideen Platos bis zu den bahnbrechenden Studien von Terman, wird die Entwicklung der Hochbegabtenforschung nachgezeichnet. Tauchen Sie ein in die charakteristischen Merkmale hochbegabter Kinder, von ihrer frühen Wissbegierde und ihrem außergewöhnlichen Gedächtnis bis hin zu ihrer Neigung, über den Sinn des Lebens zu philosophieren. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Begabungsformen, die von intellektuellen Leistungen über kreatives Schaffen bis hin zu sozialer Kompetenz reichen, und erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die diagnostischen Instrumente zur Erfassung kognitiver, kreativer, psychomotorischer und sozialer Fähigkeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den nachteiligen Einflußgrößen, die die Entfaltung von Hochbegabung behindern können, von geographisch-ökologischen Faktoren bis hin zu Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit. Der Band präsentiert eine Vielzahl von Fördermaßnahmen, von Akzeleration und Enrichment bis hin zu Spezialklassen und individualisierten Lehrangeboten, und zeigt auf, welche Aktivitäten die Entwicklung hochbegabter Kinder tatsächlich unterstützen und welche vermieden werden sollten. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Eltern, Erzieher, Lehrer und alle, die sich für das Thema Hochbegabung interessieren und dazu beitragen möchten, das Potenzial hochbegabter Menschen optimal zu fördern. Es bietet wertvolle Einblicke und praktische Anleitungen, um hochbegabte Kinder auf ihrem Weg zu unterstützen und ihnen ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu ermöglichen.
Hochbegabung
Anke Hofmann 10.07.1998
Oberseminar Pädagogische Psychologie
Literatur:
Heller, Kurt A.: ,,Hochbegabung im Kindes- und Jugendalter", Hogrefe Verlag, Göttingen, 1992.
Mönks, Franz J.; Ypenburg, Irene H.: ,,Unser Kind ist hochbegabt", Ernst Reinhardt Verlag, München,1993.
Feger, Barbara: ,,Hochbegabung- Chancen und Probleme", Huber Verlag, Bern, 1988.
Definition:
- Hochbegabte verfügen über verwirklichte oder potentielle Fähigkeiten, die Ausdruck sind von hohen Leistungsmöglichkeiten auf intellektuellem, kreativem, künstlerischem (musikalisch und darstellend) oder spezifischem akademischem Gebiet oder von außergewöhnlichen Führungsqualitäten. Es sind Kinder, die ein differenziertes Unterrichtsangebot und Fördermaßnahmen erfordern, die gewöhnlich in der Regelschule nicht geboten werden, damit sie ihren Beitrag für sich und die Gesellschaft verwirklichen können. (Marland-Definition) ... sehr umstritten, bezieht weder nichtintellektuelle Faktoren, noch Motivationsfrage, noch soziales Umfeld mit ein.
- Triade: hohe intellektuelle Fähigkeiten (IQ bei oder über 130), Kreativität (Die meisten kreativen Personen sind auch hochbegabt, aber nicht jeder Hochbegabte ist auch kreativ.) und Motivation.
Beispiele:
Johann Wolfgang Goethe
Albert Einstein
Norbert Wiener (,,Vater der Kybernetik")
Henri Dunant (Begründer des Roten Kreuzes und Friedensnobelpreisträger 1901) = sozial hochbegabt
Hochbegabte Kinder
- fixieren schon bald nach der Geburt Menschen und Dinge.
- reagieren schon nach wenigen Wochen auf seine Umwelt mit Lächeln.
- nehmen mit seiner Umwelt eher als andere Babys Kontakt auf.
- brauchen wenig Schlaf.
- können meist schon mit sieben oder acht Monaten laufen (normal: 12. - 18. Monat).
- sind sehr wißbegierig und löchern ihre Eltern mit Fragen.
- werden ungehalten, wenn man es mit unzureichenden Antworten abspeist.
- lernen vor der Einschulung ohne größere Hilfe lesen und beschäftigen sich dann häufig mit Nachschlagewerken und Atlanten.
- vergleichen viel und stellen Ähnlichkeiten und Unterschiede gegenüber, z.B. bei Personen, Begriffen, Ideen und Erfahrungen.
- haben einen außergewöhnlichen Sinn für Humor.
- führen mechanische Arbeiten, bei denen man nicht nachdenken muß, lustlos oder gar nicht aus.
- bevorzugen Spiele, die mit Kombinationsvermögen (Organisieren, Sortieren, Klassifizieren) und nicht vom Glück abhängig sind.
- gehen in selbstgestellten Aufgaben konzentriert auf und neigen zum Perfektionismus.
- sammeln ungewöhnliche Dinge und eignen sich über die ein ungewöhnliches Spezialwissen an.
- zählen über zehn oder zwanzig hinaus.
- lösen einfache Rechenaufgaben.
- können sich mit mehreren Aufgaben gleichzeitig beschäftigen.
- haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis.
- Nachdenken über den Sinn des Lebens (nicht selten bereits im Alter von drei oder vier Jahren)
-Heller s. 275 ff.
Geschichte:
- schon immer Forderung nach besonderer Förderung der intellektuell Begabten (Plato, Luther, Fichte)
- moderne Hochbegabtenforschung rund 100 Jahre alt
- um die Jahrhundertwende Auflehnung gegen die ,,alte Schule" mit Drill, Zwang und Einheitsmethoden · Reformpädagogik
- Anfänge der Intelligenzforschung:
Binet und Stern
- Terman-Studie: Lewis M. Terman (1877-1956)
- startete Anfang der 20er eine Längsschnittuntersuchung an 1500 hochbegabten Schülern, die bis heute noch andauert,
- fand heraus, daß Intelligenz als Indikator für Hochbegabung nicht ausreicht
- 1933 Unterbrechung der Forschung und Reformpädagogik durch die Nazis
- 1949 Busemann ,,Höhere Begabung"
- 1953 Juda ,,Höchstbegabung , ihre Erbverhältnisse sowie ihre Beziehungen zu psychischen Anomalien"
- diverse Stiftungen und Projekte in BRD, DDR und anderen Ländern
Statistik:
- nach Prozentsatzdefinition: 15-20% aller Schüler der Sekundarstufe II
- mitunter auch Zahlen um die 10% herum
Erklärungsansätze:
a) Fähigkeitsmodelle: (... geistige , intellektuelle Fähigkeiten können bereits im frühen Alter festgestellt werden und verändern sich in Laufe des Lebens nicht wesentlich) · Marland-Definition
b) Kognitive Komponentenmodelle: (IQ wird QI ... Qualität der Informationsverarbeitung)
c) Leistungsorientierte Modelle: (Anlagen sind Voraussetzungen für zu vollbringende Leistung) · Forderung nach Erziehung, damit der Mensch sich in Übereinstimmung mit seinen Fähigkeiten entwickeln kann.
d) soziokulturell orientierte Modelle: Hochbegabung kann sich nur bei einem günstigen Zusammenwirken von individuellen und sozialen Faktoren verwirklichen. Ansatzmöglichkeiten für Eltern, Erzieher, Lehrer und andere Vertrauenspersonen (Trainer, Großeltern...)
e) umfassendes Erklärungsmodell:
1. nichtintellektuelle innere Faktoren: Fleiß, Ausdauer, Neugier, Ehrgeiz, emotionale Stabilität
2. äußere Faktoren: Erziehung, Eltern...
3. Zufallsfaktoren: Lehrer...
4. entwicklungspsychologische Faktoren: Eltern und Lehrer denken, daß es am besten ist, wenn das Kind erst in der Schule lesen lernt
5. Physische Faktoren: Behinderungen, Unfallfolgen...
Begabungsformen:
1. auf dem Gebiet der geistigen Fähigkeiten, der intellektuellen Leistungen,
2. auf dem Gebiet der Kreativität und Produktivität,
3. auf dem Gebiet der Kunst, in den darstellenden und musischen Künsten,
4. auf dem sozialen Gebiet (soziale Wahrnehmung, prosoziales Verhalten, moralisches Urteilen, Führungseigenschaften).
Diagnostik
1. Erfassung kognitiver Fähigkeiten
- Kognitiver Fähigkeiten-Test von Heller, Gaedicke & Weinländer (1985)
- Zahlenverbindungstest von Oswald & Roth (1987)
- Spiegelbilder und Abwicklungen aus Wilde- Intelligenzstrukturdiagnostikum von Jäger & Althoff (1983)
- Aufgaben aus Physik und Technik
2. Erfassung kreativer Begabung
- Torrance-Kreativitätstest (angefangene Zeichnungen fertigstellen)
- Verwendungstest (VWT) Was kann ich mit einem Holzlineal und einer Zeitung machen?
- Verbaler Kreativitätstest von Schoppe (1975)
- Fragebogen zu Kreativität
3. Erfassung psychomotorischer Fähigkeiten
- Finger- und Handgeschicklichkeit
- Reaktionsgeschwindigkeit
4. Erfassung sozialer Kompetenz
- Fragebogen zur sozialen Kompetenz bei Grundschülern und Sekundarstufenschülern
5. Erfassung musikalischer Begabung
- Lehrerchecklisten
Nachteilige Einflußgrößen:
1. Geographisch-ökologische Faktoren _ Schaustellerkinder, Eskimokinder, Kinder in Dürregebieten.
2. Ethnische Faktoren _ Mexikaner, Indianer in den USA, Kindern aus den Ostblockländern, Farbige
3. Ökonomische Faktoren _ Slumbewohner, Kinder langjähriger Arbeitsloser
4. Zugehörigkeit des weiblichen Geschlechts _ Mädchen im Islam
5. Faktoren der Behinderung oder Krankheit _ Blinde, Taube, gelähmte Kinder, chronisch kranke Kinder
6. Faktoren der Eltern-Kind-Beziehung _ indifferente Eltern, mißhandelnde Eltern, Eltern unerwünschter Kinder
7. Faktoren der aktiven Mißachtung von Normen _ Kriminelle, Vorbestrafte, Aussteiger, Drogensüchtige, Alkoholiker
8. Schlechte schulische Ausbildung u. -möglichkeit _ aufgrund von ungünstigen ökonomischen, geographischen und ethnischen Bedingungen
9. Kulturelle Benachteiligung _ Flüchtlinge aus Schwarzafrika, Menschen im Exil
Fördern
1. Beschleunigung (Akzeleration)
- frühzeitige Einschulung in die Grundschule
- frühzeitiger Übergang in weiterführende Schulen oder auf die Universität
- Überspringen einer oder mehrerer Klassen
2. Anreicherung des normalen Unterrichtsangebotes (Enrichment)
- Erweiterung und Vertiefung des Lehrstoffes
- Extra-Wahlfächer
- Samstagsschulen, wo in Gruppen oder einzeln an bestimmten Themen gearbeitet werden kann oder wo herausfordernde Aufgaben mit Entwicklungsgleichen gelöst werden
3. Hilfslehrkraft
- ähnlich zur Unterstützung von Lernbehinderten
4. Projekte
- einzeln oder in Gruppen
5. Arbeitsgemeinschaften
6. Renzullis Drehtürmethode
- Schüler kann den Unterricht verlassen und z. B. während einzelner Stunden in höhere Klassen gehen
7. Spezialklassen
- Zusammenfassung vieler Hochbegabter
8. D-Zug-Klassen
- Sonderklassen, zumeist in der Sekundarstufe, die Lehrpensum mit höherem Tempo durchlaufen
9. Reformschulen
- Montessori-Pädagogik
- Jena-Plan-Schulen
10. Individualisierung des Lehrangebotes
- Fördermaterial und -möglichkeiten
- Herausforderung
- Umgang mit den Schülern
- Beratung
- Lehrerfortbildung
- Lehrerausbildung
11. Außerschulische Programme
- Schülerakademien
- Samstagclubs
- Ferienlager
12. Hochbegabtenschulen
- Ballettschule in Dresden (Palucca-Schule)
- Sportschulen (KJS)
- Christopherusschule in Braunschweig
Diese Aktivitäten sind nicht begabungsfördernd:
- das Sortieren von alten Zeitungen,
- Besorgungen für den Lehrer machen,
- die Rolle des Pförtners übernehmen,
- Mitschülern, für die das Lerntempo zu hoch liegt, Nachhilfe geben,
- Klassenarbeiten und Hausaufgaben von Mitschülern nachsehen und beurteilen lassen,
- Schränke aufräumen und Pflanzen versorgen,
Häufig gestellte Fragen
Was ist Hochbegabung laut Anke Hofmanns Oberseminararbeit?
Hochbegabung wird definiert als verwirklichte oder potentielle Fähigkeiten, die Ausdruck sind von hohen Leistungsmöglichkeiten auf intellektuellem, kreativem, künstlerischem oder spezifischem akademischem Gebiet oder von außergewöhnlichen Führungsqualitäten. Es sind Kinder, die ein differenziertes Unterrichtsangebot und Fördermaßnahmen erfordern.
Welche Merkmale haben hochbegabte Kinder oft?
Hochbegabte Kinder fixieren schon bald nach der Geburt Menschen und Dinge, reagieren früh auf ihre Umwelt, brauchen wenig Schlaf, sind wißbegierig, lernen früh lesen, vergleichen viel, haben einen Sinn für Humor, bevorzugen kombinatorische Spiele, sind konzentriert, sammeln ungewöhnliche Dinge, rechnen früh, beschäftigen sich mit mehreren Aufgaben gleichzeitig und haben ein gutes Gedächtnis.
Wer sind einige Beispiele für hochbegabte Persönlichkeiten?
Genannt werden Johann Wolfgang Goethe, Albert Einstein, Norbert Wiener (,,Vater der Kybernetik") und Henri Dunant (Begründer des Roten Kreuzes).
Wie alt ist die moderne Hochbegabtenforschung?
Die moderne Hochbegabtenforschung ist rund 100 Jahre alt.
Welche Erklärungsansätze für Hochbegabung gibt es?
Es gibt Fähigkeitsmodelle, kognitive Komponentenmodelle, leistungsorientierte Modelle, soziokulturell orientierte Modelle und umfassende Erklärungsmodelle, die nichtintellektuelle innere Faktoren, äußere Faktoren, Zufallsfaktoren, entwicklungspsychologische Faktoren und physische Faktoren berücksichtigen.
Welche Begabungsformen werden unterschieden?
Es werden Begabungen auf dem Gebiet der geistigen Fähigkeiten, der Kreativität, der Kunst und auf dem sozialen Gebiet unterschieden.
Welche diagnostischen Verfahren werden zur Erfassung von Hochbegabung eingesetzt?
Zur Diagnostik gehören die Erfassung kognitiver Fähigkeiten (z.B. Kognitiver Fähigkeiten-Test), kreativer Begabung (z.B. Torrance-Kreativitätstest), psychomotorischer Fähigkeiten, sozialer Kompetenz und musikalischer Begabung.
Welche Faktoren können die Entwicklung von Hochbegabung negativ beeinflussen?
Nachteilige Einflußgrößen sind geographisch-ökologische, ethnische, ökonomische Faktoren, das weibliche Geschlecht (in bestimmten Kulturen), Behinderung oder Krankheit, ungünstige Eltern-Kind-Beziehungen, aktive Mißachtung von Normen, schlechte schulische Ausbildung und kulturelle Benachteiligung.
Welche Fördermöglichkeiten für hochbegabte Kinder gibt es?
Fördermöglichkeiten sind Beschleunigung (Akzeleration), Anreicherung des normalen Unterrichtsangebotes (Enrichment), Hilfslehrkräfte, Projekte, Arbeitsgemeinschaften, Renzullis Drehtürmethode, Spezialklassen, D-Zug-Klassen, Reformschulen (z.B. Montessori-Pädagogik), Individualisierung des Lehrangebotes und außerschulische Programme.
Welche Aktivitäten sind nicht begabungsfördernd?
Aktivitäten, die nicht begabungsfördernd sind, umfassen das Sortieren von Zeitungen, Besorgungen für den Lehrer, die Rolle des Pförtners, Nachhilfe geben, Klassenarbeiten korrigieren, Schränke aufräumen und sich wiederholende Aufgaben.
Welche Literatur wird in der Arbeit zur Hochbegabung erwähnt?
Genannte Literatur: Heller, Kurt A.: ,,Hochbegabung im Kindes- und Jugendalter", Mönks, Franz J.; Ypenburg, Irene H.: ,,Unser Kind ist hochbegabt", Feger, Barbara: ,,Hochbegabung- Chancen und Probleme".
- Arbeit zitieren
- Anke Hofmann (Autor:in), 1998, Hochbegabung. Definition, Merkmal und Förderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95802