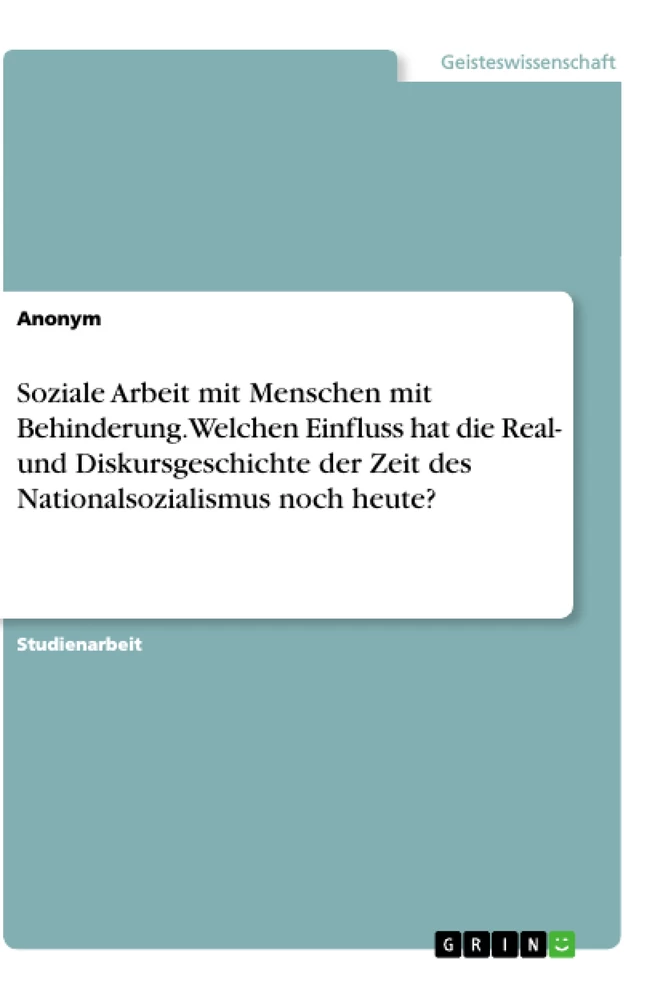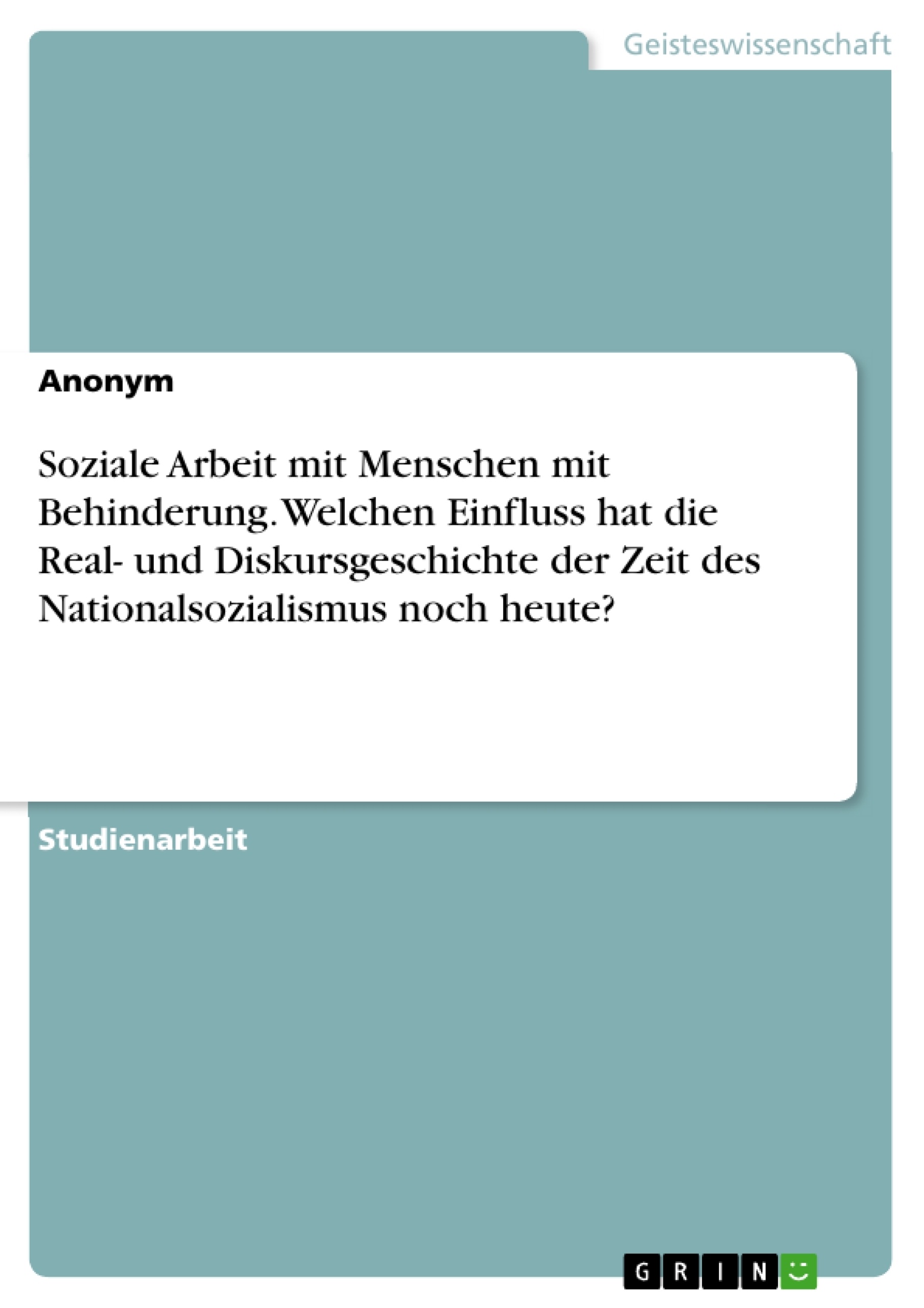Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit die Real- und Diskursgeschichte der Zeit des Nationalsozialismus die Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung bis heute beeinflusst. Zunächst wird dafür die Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Vor allem die Zeit von 1933 bis 1945, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten steht, prägt eine beispiellos abweichende Vorstellung auf das Bild eines Menschen mit einer Behinderung als es heute der Fall ist. Als Erstes werden deshalb die historischen Ereignisse und der Aufstieg der Nationalsozialisten rund um das Jahr 1933 betrachtet, um anschließend die Fürsorge und das Hilfeverständnis der Sozialen Arbeit in dieser Zeit allgemein, sowie um den Personenkreis von Menschen mit Behinderung im Speziellen zu betrachten. Eine Endlösung für soziale Fragen soll durch Euthanasie geschaffen werden und vollendet das grausame Verständnis von „Hilfe“ in dieser Zeit. Anschließend werden die Veränderungen nach dem Jahr 1945 beschrieben. Das Ende des zweiten Weltkrieges läutete nicht nur den Untergang der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten ein, sondern auch eine Neugestaltung der sozialen Fürsorge. Es finden Umstrukturierungen im Bereich der Wohlfahrt statt und andere Blickwinkel auf Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Einschränkungen werden im Näheren beschrieben. Vor allem das Konzept der Lebensweltorientierung von Hans Thiersch ist bis heute ein bedeutsamer Teil der Sozialen Arbeit mit Menschen mit sogenannten „besonderen Bedürfnissen“. Nachfolgend werden die kritischen Sichtweisen auf die Theorie der Lebensweltorientierung beschrieben, um am Ende eine Konsequenz für die Soziale Arbeit in der heutigen Zeit zu ziehen und die Arbeit mit einem Fazit abzuschließen.
Das Ende des zweiten Weltkrieges und damit auch die Zeit des Nationalsozia-lismus sind seit mehr als 74 Jahre vorbei und auch die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung hat sich seitdem stark verändert. Personen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung prägen schon lange die Arbeit von Fachkräften der Sozialen Arbeit. Neue Theorien und Ansätze ermöglichen eine erweiterte Sichtweise auf diese Klientel und führen zu mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. Doch in der Vergangenheit findet sich ein ganz anderes Verständnis gegenüber diesem Personenkreis.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung
- Von der Fürsorge zur Volkspflege
- Auftrag der Sozialen Arbeit und des Hilfeverständnisses im Nationalsozialismus
- Handlungsfeld Menschen mit Behinderung
- Endlösung Euthanasie
- Die Entwicklung der Sozialen Arbeit im Umgang mit Menschen mit Behinderung (nach 1945)
- Das Konzept der Lebensweltorientierung
- Kritik am Konzept der Lebensweltorientierung
- Konsequenz für die Soziale Arbeit heute
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der nationalsozialistischen Vergangenheit auf die Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung bis in die Gegenwart. Sie analysiert die historische Entwicklung des Umgangs mit Behinderung in Deutschland, insbesondere während der NS-Zeit, und beleuchtet die Veränderungen nach 1945. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Lebensweltorientierung und seiner Kritik.
- Der Wandel des Hilfeverständnisses in der Sozialen Arbeit während des Nationalsozialismus.
- Die Rolle der Euthanasie und die Behandlung von Menschen mit Behinderung im NS-Regime.
- Die Entwicklung der Sozialen Arbeit nach 1945 und die Entstehung des Konzepts der Lebensweltorientierung.
- Kritikpunkte am Konzept der Lebensweltorientierung.
- Die heutigen Konsequenzen aus der historischen Entwicklung für die Soziale Arbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Fragestellung der Arbeit, nämlich den Einfluss der nationalsozialistischen Vergangenheit auf die heutige Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Sie skizziert den zeitlichen Rahmen und die methodische Vorgehensweise, indem sie die historische Entwicklung vor und nach 1945 beleuchtet und das Konzept der Lebensweltorientierung sowie dessen Kritikpunkte thematisiert. Die Einleitung betont den Wandel im Verständnis von Behinderung und den damit verbundenen Veränderungen in der Sozialen Arbeit.
Historische Entwicklung: Dieses Kapitel beginnt mit der Weltwirtschaftskrise und dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Es beschreibt den Verlust der demokratischen Strukturen und die Machtergreifung Hitlers. Der Fokus liegt auf den politischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die den Boden für die nationalsozialistische Ideologie bereiteten. Der Zusammenbruch der Weimarer Republik und die sich verschärfenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme werden als wichtige Faktoren für die Akzeptanz des Nationalsozialismus dargestellt.
Von der Fürsorge zur Volkspflege: Dieses Kapitel analysiert die Transformation des Fürsorgesystems während der NS-Zeit. Die Ablehnung des wohlfahrtsstaatlichen Systems durch die Nationalsozialisten, die Selbsthilfeforderung und die Bevorzugung „wertvoller“ gegenüber „minderwertigen“ Personen werden detailliert erläutert. Die Gleichschaltung des Fürsorge- und Gesundheitswesens unter der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) und die Umwandlung der Wohlfahrtspflege in Volkspflege im Dienste der Rassenhygiene werden hervorgehoben. Der sozialdarwinistische Ansatz der NS-Ideologie und die Einteilung der Bevölkerung in verschiedene Kategorien werden hier als zentrale Aspekte der Volkspflege dargestellt.
Auftrag der Sozialen Arbeit und des Hilfeverständnisses im Nationalsozialismus: Dieses Kapitel befasst sich mit dem fundamentalen Wandel des Hilfeverständnisses in der Sozialen Arbeit während des Nationalsozialismus. Es zeigt auf, wie die Profession den rassistischen und eugenischen Zielen der NS-Ideologie untergeordnet wurde. Die Umdeutung von Hilfe, die durch Sanktionen und die Deportation in Konzentrationslager ging, steht im Zentrum der Betrachtung. Die Ausbildung in der Sozialen Arbeit wird im Kontext dieser Ideologie analysiert und ihre Auswirkungen auf die professionelle Praxis beleuchtet.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Behinderung, Nationalsozialismus, Euthanasie, Rassenhygiene, Lebensweltorientierung, Volkspflege, Fürsorge, NS-Ideologie, Hilfeverständnis, historische Entwicklung, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Einfluss der NS-Vergangenheit auf die Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht den Einfluss der nationalsozialistischen Vergangenheit auf die Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung bis in die Gegenwart. Er analysiert die historische Entwicklung des Umgangs mit Behinderung in Deutschland, besonders während der NS-Zeit und nach 1945, mit Fokus auf dem Konzept der Lebensweltorientierung und dessen Kritik.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt den Wandel des Hilfeverständnisses in der Sozialen Arbeit während des Nationalsozialismus, die Rolle der Euthanasie und die Behandlung von Menschen mit Behinderung im NS-Regime, die Entwicklung der Sozialen Arbeit nach 1945 und die Entstehung des Konzepts der Lebensweltorientierung, Kritikpunkte an diesem Konzept und die heutigen Konsequenzen der historischen Entwicklung für die Soziale Arbeit.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung (inkl. Unterkapiteln zu "Von der Fürsorge zur Volkspflege" und "Auftrag der Sozialen Arbeit und des Hilfeverständnisses im Nationalsozialismus"), ein Kapitel zur Entwicklung der Sozialen Arbeit nach 1945, ein Kapitel zu den Konsequenzen für die heutige Soziale Arbeit, ein Fazit, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die Fragestellung des Textes, den zeitlichen Rahmen und die methodische Vorgehensweise. Sie skizziert die historische Entwicklung vor und nach 1945 und thematisiert das Konzept der Lebensweltorientierung und dessen Kritikpunkte. Sie betont den Wandel im Verständnis von Behinderung und die damit verbundenen Veränderungen in der Sozialen Arbeit.
Was wird im Kapitel zur historischen Entwicklung behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Aufstieg des Nationalsozialismus, den Verlust demokratischer Strukturen, die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die die nationalsozialistische Ideologie begünstigten, den Zusammenbruch der Weimarer Republik und die sich verschärfenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme.
Was wird im Kapitel "Von der Fürsorge zur Volkspflege" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Transformation des Fürsorgesystems während der NS-Zeit. Es erläutert die Ablehnung des wohlfahrtsstaatlichen Systems durch die Nationalsozialisten, die Selbsthilfeforderung und die Bevorzugung "wertvoller" gegenüber "minderwertigen" Personen. Die Gleichschaltung des Fürsorge- und Gesundheitswesens und die Umwandlung der Wohlfahrtspflege in Volkspflege im Dienste der Rassenhygiene werden hervorgehoben.
Was wird im Kapitel "Auftrag der Sozialen Arbeit und des Hilfeverständnisses im Nationalsozialismus" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit dem fundamentalen Wandel des Hilfeverständnisses in der Sozialen Arbeit während des Nationalsozialismus. Es zeigt auf, wie die Profession den rassistischen und eugenischen Zielen der NS-Ideologie untergeordnet wurde. Die Umdeutung von Hilfe, die durch Sanktionen und die Deportation in Konzentrationslager ging, steht im Zentrum der Betrachtung. Die Ausbildung in der Sozialen Arbeit wird im Kontext dieser Ideologie analysiert.
Welche Schlüsselwörter werden im Text verwendet?
Schlüsselwörter sind: Soziale Arbeit, Behinderung, Nationalsozialismus, Euthanasie, Rassenhygiene, Lebensweltorientierung, Volkspflege, Fürsorge, NS-Ideologie, Hilfeverständnis, historische Entwicklung, Diskriminierung.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht den Einfluss der nationalsozialistischen Vergangenheit auf die heutige Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Er analysiert die historische Entwicklung des Umgangs mit Behinderung und beleuchtet die Veränderungen nach 1945. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Lebensweltorientierung und seiner Kritik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Welchen Einfluss hat die Real- und Diskursgeschichte der Zeit des Nationalsozialismus noch heute?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957997