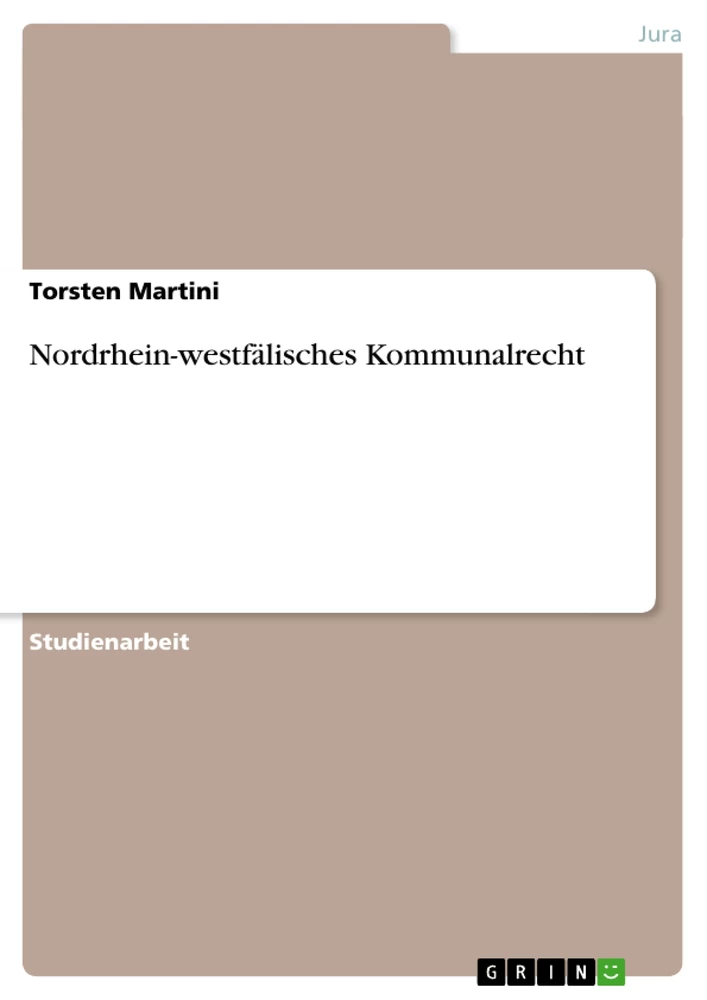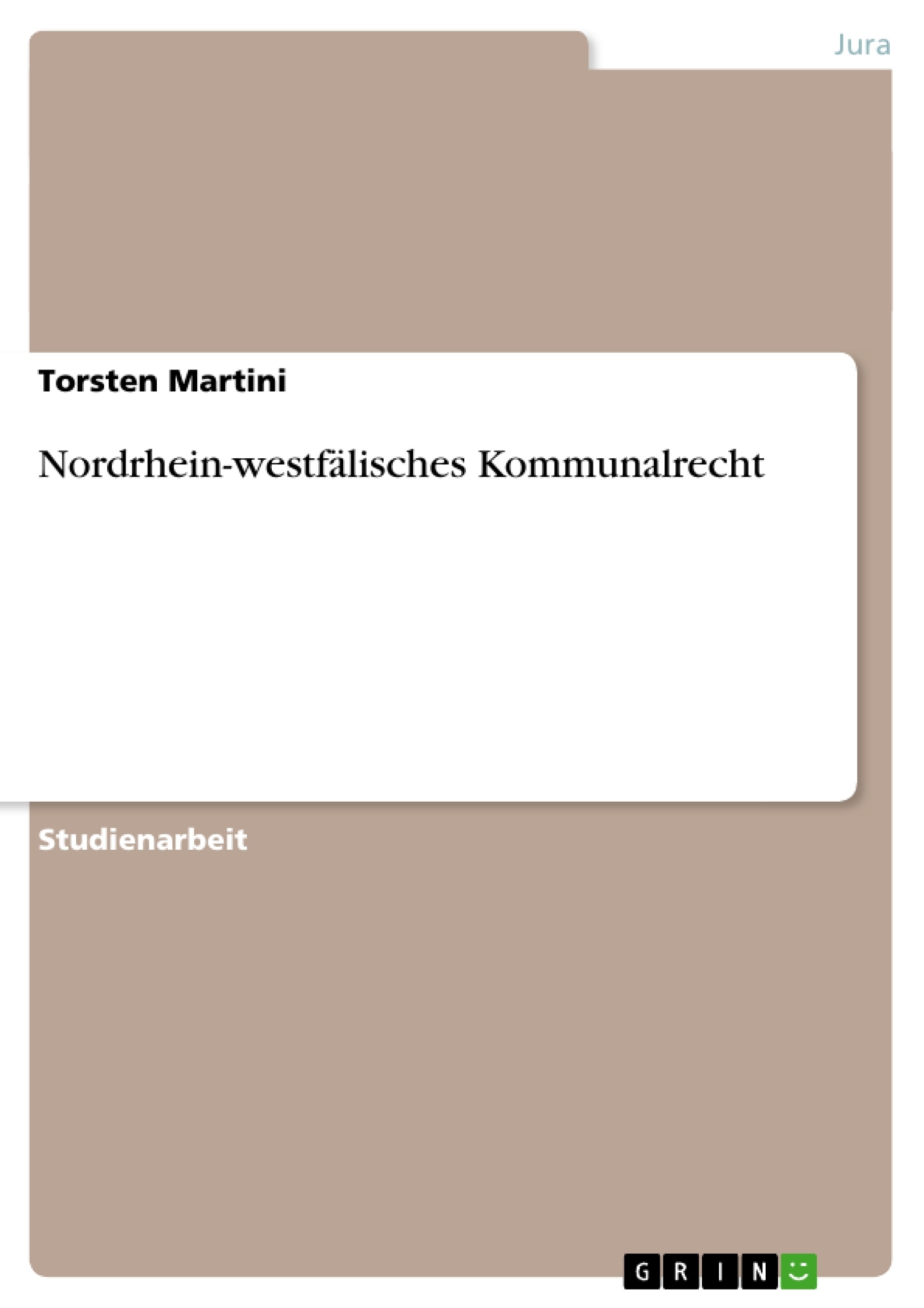Kommunalrecht NW
A. (Vorbemerkung) Begriff, Regelungsgedanke und historische Entwicklung des Kommunalrechts in NW
1. Begriff: "Kommunalrecht" ist der Sammelbegriff für alle Rechtsvorschriften, die die Organisation, Rechtsstellung, Aufgaben, Bildung, Umbildung und Auflösung von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die Rechtsverhältnisse zu ihren Angehörigen regeln.
2. Zweck: Bürgerschaftliche Mitwirkung an der örtlichen Verwaltung.
Entwicklung: Ansätze einer Bürgerbeteiligung gab es schon zu frühgeschichtlicher Zeit. Eine Ausformung erhielt diese durch die Städtebildung im Mittelalter. Nachdem die Städte ihre Funktion als Verwaltungseinheiten im 18. Jahrhundert wieder verloren hatten, gelang der Preuß. Städteordnung von 1808 des Frhrn. von Stein die Reanimation des Gedankens der bürgerschaftlichen Mitwirkung. Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts war zunächst in der WRV normiert, wobei im Gebiet des heutigen NW die preuß. Städteordnungen bis zum Erlaß der DGO im Jahre 1935 fortgalten. Die DGO schaffte die komm. Selbstverwaltung de facto wieder ab (BM als "Leiter der Gemeinde"/Abschaffung des Rates). Neufassung der DGO in der brit. Besatzungszone im Jahre 1946, die im wesentlichen als "Norddeutsche Ratsverfassung" durch die GO NW von 1952 übernommen wurde: Einführung der (mißverständlich so genannten) komm. Doppelspitze.
Zunehmende Kritik an dieser Zweigleisigkeit (vgl. den Kritikpunk tekatalog in: "Reform der Kommunalverfassung in NW", hrsg. vom Innenministerium des Landes NW, Düsseldorf 1991. Dieser Punktekatalog beruht auf einer Befragung aller nordrhein-westfälischen Ratsmitglieder )
und das Bestreben, geltendes Recht mit der Praxis der Gemeindearbeit und der Vorstellungen der Bürgerschaft von dem Aufbau der Kommunalverwaltung
( Umfragen des damaligen Innenministers Schnoor ergaben, daßin der Bevölkerungüberwiegend der Bürgermeister, nicht der Gemeindedirektor, als Chef der Verwaltung angesehen werde und man daher auch in diesem den Entscheidungsträger sehe, der mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sein müsse. Dies entspreche auch der Ausrichtung der kommunalen Wahlkämpfe auf die Person des Bürgermeisterkandidaten und nicht die des Gemeindedirektors)
in Einklang zu bringen führte zum Kommunalverfassungsänderungsgesetz (siehe Ziffer 4).
3. KVerfÄndG: Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassung durch den LT am 17.09.1994.
Hintergrund: Abschaffung der sog. kommunalen Doppelspitze
("norddeutsche Ratsverfassung") aus GD/BM bzw. OKD/LR zur
Vereinfachung der Leitung der Gemeinde, Vermeidung von Reibungsverlusten zwischen den Kommunalorganen, Anpassung der gesetzlichen Regelungen an die praktische Handhabung in der kommunalen Praxis und dem Bild der Bürgerschaft von dem BM als mit weitgehenden Kompetenzen ausgestattetem "Chef der Verwaltung", Stärkung der Einwohner- und Bürgerbeteiligung, Schaffung von Ausländerbeiräten, Experimentierklausel (Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung), Gleichstellung.
A. Gesetzliche Grundlagen des Kommunalrechts
I. Art. 28 II GG, 78 LV (Garantie der komm. Selbstverwaltung).
II. Art. 106 GG (Steuern), vgl. auch Artt. 79 LV; 93 I Nr. 4 b) GG; 75 Nr. 4 LV NW; §§ 12, 52 VGHG
III. GO, KrO, LVerbO; KWahlG; (hinsichtlich der GO/KrO n. F.: KverfÄndG)
IV. Kommunales Satzungsrecht
A. Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundsätze
1. Gebietskörperschaften: Körperschaften des öff. R.‘s, deren Hoheitsbereich durch einen räumlich abgegrenzten Teil des Staatsgebiets bestimmt wird. Mitglieder der G. sind die Bewohner dieses Gebiets. Die Kreise (früher: Landkreise) sind darüber hinaus Verbandskörperschaften aus den ihnen angehörenden Gemeinden.
2. Hoheitsträger; Teil der staatlichen Gesamtverwaltung und den Ländern zugeordnet, daher keine 3. Ebene der Staatlichkeit. Träger der kommunalen Selbstverwaltung.
3. Erscheinungsformen: Die kleinste Gebietskörperschaft ist die Gemeinde (Gemeinden und Städte [kreisfreie und kreisangehörige Städte]), Gemeindeverbände sind die Kreise und die höheren Gemeindeverbände. Die Unterscheidung zwischen kreisfreier und kreisangehöriger (große, mittlere, andere) Stadt hat Bedeutung für Art und Umfang der zugewiesenen Aufgaben (vgl. § 4 GO und HR 20b).
4. Im einzelnen Ziff. D - E.
A. Gemeinden
1. Kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 II GG, 78 LV):
Die Gden sind alleinige Träger der öffentlichen Verwaltung in ihrem Gebiet. Prinzip der Allzuständigkeit. Diese umfaßt das Recht
- alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
- solche Angelegenheiten, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben
- kein allgemein-politisches Mandat, aber interkommunale Zusammenarbeit ("Städtepartnerschaften") möglich, weil politisch wünschenswert und rechtlich unbedenklich.
- Seit Rastede (BVerfG 89, 127 ff.) Beurteilungsspielraum mit Einschätzungsprärogative.
↓ Es gilt eine Zuständigkeitsvermutung.
↓ Kernbestand: Gebietshoheit, Organisationshoheit, Personalhoheit, Finanzhoheit, Planungshoheit, Satzungshoheit, Daseinsvorsorge.
- im Rahmen der Gesetze
- allgemeiner Gesetzesvorbehalt
# kein Eingriff in den unantastbaren Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie, in sonstigen Fällen reine Verhältnismäßigkeitsprüfung (nach hM auch noch nach der Rastede-Entscheidung des BVerfG)
- in eigener Verantwortung
# Art. 28 Abs. 2 GG gilt auch hier.
zu regeln.
Daraus folgt:
a. eine institutionelle Garantie (aber kein Schutz einer bestimmten Gemeinde - ansonsten wäre die kommunale Neugliederung 68/75 üh. nicht möglich gewesen)
b. die Gewährleistung eines eigenen, nicht völlig unbedeutenden Aufgabenbereichs
c. ein subjektives Recht mit Verfassungsrang.
2. Aufgaben: Die verschiedenen, von den Gden wahrzunehmenden Aufgabentypen bestimmen im wesentlichen über den Umfang der staatlichen Aufsicht (siehe 3.).
Erscheinungsformen:
aa) Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (SVAngelegenheiten)
aaa) Pflichtaufgaben (Die von der Gemeinde nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu erfüllenden Aufgaben) (OBG)
bbb) freiwillige Aufgaben (Die Gde entscheidet über das Ob und Wie) -> allgemeine Aufsicht
bb) Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
aaa) Auftragsangelegenheiten (Erfüllung von Bundesaufgaben durch die Gemeinden (Paßwesen))
bbb) In NW keine Auftragsangelegenheiten kraft Landesrechts mehr
1. Staatliche Aufsicht
a. Inhalt/Zweck: Das Ld überwacht die Verwaltung der Gden und Gemeindeverbände. Es kann sich bei Pflichtaufgaben ein Weisungs- und Aufsichtsrecht vorbehalten (Art. 78 LV). Schutz der Gden in ihren Rechten und Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten.
b. Aufsichtsarten:
- Allgemeine Aufsicht, §§ 11, 116 ff. GO: Rechtmäßigkeitskontrolle ohne Weisungsrecht. Unmittelbar, d. h. ohne VV, vor dem VG angreifbar. Aufsichtsmaßnahmen der allg. KA sind VA’e i. S. d. § 35 I VwVfG. Mögliche Rechtsverletzung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung (Achtung! Nach hM keine GR-Fähigkeit mangels "grundrechtstypischer Gefährungslage" (Rastede!). Aber Verfahrensrechte (+)).
- Sonderaufsicht, § 116 II GO: bei Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Der Landesgesetzgeber legt den Gden Pflichten auf und behält sich dabei ein Weisungs- und Aufsichtsrecht vor. Der Gde muß ein Spielraum verbleiben. Alles andere wäre mit ihrem Status als SV-Körperschaft unvereinbar.
- Fachaufsicht, § 13 I LOG: Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle.
a. Aufsichtsbehörden:
- allgemeine Aufsichtsbehörden: LR/BezR, BezR/InnenMin, InnenMin
- Sonderaufsichtsbehörden: ergibt sich aus den entsprechenden Gesetzen. Der LR als untere staatliche Verwaltungsbehörde ist Sonderaufsichtsbehörde über die kreisangehörigen Gden.
- Fachaufsichtsbehörden: § 13 II LOG.
a. Aufsichtsmittel der allgemeinen Aufsichtsbehörden:
- Unterrichtungsrecht, § 118 GO - jederzeit über alle Angelegenheiten der Gemeinde
- Anweisungsrecht, § 119 I 1 GO - an den BM, Beschlüsse des Rates zu beanstanden.
- Aufhebungsrecht, § 119 I 2 GO als nächsten Schritt zu § 119 I 1 GO. · Anordnungsrecht und Ersatzvornahme, § 120 GO.
- Beauftragtenbestellung, § 121 GO (sog. "Staatskommissar") · Auflösung des Rates, § 122 GO (ultima ratio).
- Für Sonder- und Fachaufsichtsbehörden geltenähnliche Aufsichtsmittel nach den jeweiligen Fachgesetzen (vgl. z. B. § 13 III LOG), teilweise weitergehende Mittel (Informationspflichten, Anzeigepflichten, Genehmigungsvorbehalte)
4. Gemeindeorgane
a. Rat, §§ 40 ff. GO
aa) Grundsätze
- wichtigstes Organ der Gemeinde, denn die Verwaltung der Gde wird durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt und diese wird durch den Rat und den BM repräsentiert
- Verwaltungsorgan, Arg. § 3 II GO.
- Wahlzeit: 5 Jahre (§ 42 I GO); Wahlberechtigung §§ 7, 12 KWG.
- Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder: freies Mandat (§ 43 I GO), Teilnahmerecht (§ 47 GO), ↓ ohne ausdrückliche Regelung: Rede- und Antragsrecht der Ratsmitglieder in den Ratssitzungen.
- im Rat (nicht in den Ausschüssen!): Fraktionen ( freiwillige Vereinigung von Mitgliedern des Rates/einer Bezirksvertretung, § 56 I GO) · wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung mit.
- ↓ dem öR zuzurechnen. Begr.: unmittelbare Teilnahme am Entscheidungsfindungsprozeß im Rat.
- innere Organisation muß dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip entsprechen.
- Wahrung der Freiheit des Mandats (Fraktionsdisziplin ja, Fraktionszwang nein) · Fraktionsausschluß: Weitere Zusammenarbeit darf den übrigen Ratsmitgliedern nicht mehr zuzumuten sein.
bb. sog. Allzuständigkeit des Rates, § 41 I 1 GO
- Ausnahme: § 41 I 1 2. HS GO: Zuständigkeitszuweisungen auf andere Gde- Organe sind möglich. Rückausnahme: § 41 I 2 GO: nicht übertragbare Angelegenheiten.
- Weiterhin: §§ 37 I 2 f., 39 VI, 43 II, III 2, 47 II, 55 III, 57 I, IV, 58, 63, 65 II, 66 II, 67, 68 I, 71 I, VII, 73 I, 79 IV, 80 IV , 82 I, 113 GO.
- ↓ Rückholrecht bei Geschäften der lfd. Verwaltung, § 41 III GO.
bb. Aufgaben:
- Überwacht die Amtsführung des BM, vgl. § 55 Abs. 3 GO.
- Beanstandungsrecht hinsichtlich einer Entscheidung des BM in Form eines Beschlusses
- Aufhebung einer Entscheidung des BM (Arg. § 119 Abs. 2, S. 4 GO)
bb. Verfahren im Rat:
↓ Ratsbeschluß (§§ 51 ff. GO):
- Keine Verkündung etc. erforderlich (§ 52 II: "soll"), aber Niederschrift (§ 52 GO) Ausnahme: gemeindeintern vorgeschrieben: Ausnahme von der
Ausnahme: wichtiger Grund.
- in der Regel keine Außenwirkung
- Ausführung durch den BM (§ 53 I GO)
- Beanstandungsrecht des BM (§ 54 I GO)
- Mitwirkungsverbot der Ratsmitglieder bei Befangenheit, §§ 43 Abs. 2, 31 Abs. 1 GO (auch schon bei der Entscheidungsfindung!). Zweck: Vermeidung von Interessenkollisionen. Stichwort "Sonderinteresse". Nunmehr "unmittelbarer" Vor-/Nachteil. Entscheidend sind die Entscheidungsmöglichkeiten, nicht die i. Erg. getroffene Entscheidung. Folge: weder beratende noch entscheidende Mitwirkung. Beachte § 31 II, III GO.
a. Ausschüsse, § 41 II GO
- Zweck: Entlastung des Rates durch Vorbereitung der Ratsbeschlüsse (↓ Durch Satzung kann einem Ausschuß eine Entscheidungskompetenz zugewiesen werden, Bsp.: Dem Bauausschuß das Belegungsrecht für kommunale Friedhöfe - in diesem Fall ist eine Umsetzung in Außenrecht nicht erforderlich) /sachgemäße Erledigung von Fachaufgaben
- Bildung: frei, § 57 I GO, Ausnahme: Pflichtausschüsse, § 57 I GO.
- Zusammensetzung und Verfahren: § 58 GO.
- Pflichtausschüsse: § 57 II GO.
aa) Hauptausschuß, § 59 Abs. 1 GO unter Vorsitz des BM; Koordinierungsfunktion (§ 59 I GO);
Dringlichkeitsentscheidungen (§ 60 I 1 GO) ↓ rechtzeitige Einberufung des Rates nicht möglich u. Gefahr von Nachteilen für die Gde.
bb) Finanzausschuß, § 59 Abs. 2 GO
cc) Rechnungsprüfungsausschuß, § 59 Abs. 3 GO
- Ausschüsse nach sondergesetzlichen Vorschriften (zB Schulausschuß, § 12 SchulverwG)
a. Bezirksvertretungen u. Ortschaften (z. B. 37 I 1,, 2. HS GO)
1. Zweck: Bürgernahe Wahrnehmung komm. Aufgaben
2. Kreisfreie Städte: Obligatorische Bezirksbildung (§ 35 GO)
3. Wahl zur Bezirksvertretung: § 36 I GO.
4. Aufgaben: umfassende Zuständigkeit für alle Angelegenheiten des Stadtbezirks (§ 37 GO, beschränkte Generalklausel), Anhörungsrecht nach § 37 V GO; Katalog des § 37 I 1, 2. HS GO.
a. Hpt.-amtl. BM
a. Funktion: Hauptverwaltungsbeamter der Gde; kommunaler Wahlbeamter (§ 62 I 1 GO, Folge: § 195 LBG); "Chef der Verwaltung".
b. Wahl: Direktwahl (§ 65 I GO) auf die Dauer von 5 Jahren. Abwahl nach § 66 GO möglich.
c. Aufgaben/Kompetenzen:
1. Leitung/Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung (§ 62 I 2 GO).
2. Leitung und Verteilung der Geschäfte (§ 62 I 3 GO).
3. Vorsitz im (neuen) Verwaltungsvorstand (§ 70 I 2 GO).
4. Dringlichkeitsentscheidungen, § 60 I 2 GO.
5. Geschäfte der laufenden Verwaltung, § 41 Abs. 3 GO (regelmäßig wiederkehrende Geschäfte, die nach feststehenden Grundsätzen entschieden werden können und denen keine weittragende Bedeutung zukommt). ↓ Die Unterscheidung nach "einfachen" Geschäften der lfd. Verwaltung ist entfallen.
6. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (§ 3 II GO); Erledigung staatlicher Weisungen, § 62 Abs. 2, S. 2, 2. HS GO
7. Übertragene Entscheidungen (§§ 41 II, 62 II 3 GO) ↓ Rückholrecht des Rates
8. Auftragsangelegenheiten (§ 129 GO).
9. Gesetzlicher Vertreter der Gde (§ 63 I 1 GO).
10. Widerspruchs-/Beanstandungsrecht ( § 54 I, II GO).
11. Vorsitz im Rat/Repräsentation der Gde (§ 40 II GO), Folge: Leitung der Sitzungen des Rates ( § 51 GO); Vorbereitung/Durchführung der Beschlüsse des Rates, § 62 Abs. 2, S. 1 und 2, 2. HS
a. Beigeordnete (§§ 70 f. GO)
a. Funktion: Unterstützung des BM bei der Verwaltungsführung; Vertreten den BM in ihrem Arbeitsgebiet (§ 68 II GO).
b. Wahl: acht Jahre (§ 71 I GO).
c. Vgl. auch § 71 IV GO
a. Verwaltungsvorstand (§ 70 GO)
a. Funktion/Aufgaben: Gremium von Fachleuten; Bindeglied zwischen Rat und Verwaltung; Entlastung des Rates; Mitwirkung bei den Grundsätzen der Organisation, Planung bedeutsamer Verwaltungsentscheidungen, Aufstellung des HHPl., Personalführung und - verwaltung. ↓ Keine eigene Organstellung.
b. Besteht idR aus dem BM (der im Zweifel entscheidet), dem Kämmerer, den weiteren hauptamtlichen Beigeordneten.
6. Einwohner und Bürger (§ 21 GO)
a. Einwohner ist, wer im Gde-Gebiet wohnt (§ 21 GO).
b. Bürger ist, wer zu den Gde.-Wahlen berechtigt ist (§ 7 KWahlG).
↓ Ausländerwahlrecht: Art. 28 Abs. 1 S. 3 GG: aktives und passives Wahlrecht für EG-Bürger in den Kreisen und Gemeinden nach Maßgabe des EG-Rechts. # Nunmehr klar: Kein komm. Wahlrecht für Nicht-EG-Bürger ohne Verfassungsänderung möglich.
a. Ausländerbeirat (§ 27 GO).
b. Petitionsrecht (§ 24 GO).
c. Servicerechte ( § 22 GO).
d. Unterrichtungspflicht der Gden (§ 23 GO).
e. Einwohnerantrag, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid (§§ 25 ff. GO)
f. Benutzungsanspruch für öffentliche Einrichtungen im Rahmen des geltenden Rechts (§ 8 II GO)
↓ Rechtsweg: Zwei-Stufen-Theorie
↓ öffentliche Einrichtung: jede besondere Einrichtung [= jeder benutzbare Gegenstand], die die Gemeinde [Entscheidungsbefugnis der Gemeinde] im öffentlichen Interesse und durch Widmung [ausdrücklich oder konkludent] der allgemeinen Benutzung durch die Einwohner zugänglich macht.
↓ "im Rahmen des geltenden Rechts": Beschränkungen durch den Widmungszweck, die Kapazität, Benutzungsregelungen (die insbesondere mit GR’en vereinbar sein müssen), ↓ Verfassungsfeindlichkeit einer Partei: Parteienprivileg, Art. 21 Abs. 2 S. 2 GG, beachten.
↓ Widmung: muß ihrerseits rechtmäßig sein (# Grundrechte, aber: § 8 Abs. 2 GO ist ein Teilhaberecht, GR’e können daher nicht zur Schaffung o. Erweiterung öE zwingen).
↓ § 8 Abs. 4 GO: Wegen § 5 PartG auch bei überörtlichem Charakter (hM).
↓ Zulassungsanspruch aus Art. 8 GG? GR’e sind in erster Linie Abwehrrechte gg. den Staat. Einen Leistungsanspruch begründen sie nur, wenn dies unerläßlich ist.
↓ § 8 Abs. 2 GO (-)? # Sonderbenutzung. Bei GR-Berührung (ebenso bei Kapazitätserschöpfung und Ortsfremde besteht ein Destimationsanspruch (Rspr.).
7. Satzungshoheit (§ 7 I GO)
a. Begriff:
- ö.-r. Regelung
- eines selbständigen Verwaltungsträgers kraft der staatlich verliehenen Satzungsautonomie
- mit allgemeinem Inhalt
- im Bereich eigener Angelegenheiten
b) RM- und Wirksamkeitsvoraussetzungen
aa) Ermächtigungsgrundlage (Spezialnorm/Generalklausel) bb. formelle RM
aaa) Zuständigkeit (Verbandskompetenz: § 7 GO, Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG;
Organkompetenz des Rates, § 41 Abs. 1 S. 2 Ziff. f) GO
ccc) Verfahren: Ratsbeschluß
ddd) Form
eee) ggf. Genehmigung der Aufsichtsbehörde (selten)
fff) Ausfertigung und Verkündigung, § 7 Abs. 4 f. GO
cc) materielle RM
aaa) Voraussetzungen der EG
bbb) Kein Verstoß gegen höherrangiges Recht, Vhm.
ccc) Benutzung öE? Keine Überschreitung des Anstaltszwecks
ddd) Allgemeine RM-Voraussetzungen (Bestimmtheit, Vhm., ggf. Ermessen)
cc. Fehlerfolgen:
aaa) Grundsätzlich Nichtigkeit
bbb) Ausnahmen: Verstoß gg. unwesentliche Verfahrensvorschriften; § 214 BauGB; Heilung nach § 7 Abs. 6 GO.
ccc) Heilung?
dd) ↓ Verwerfungskompetenz kommunaler Organe? hM: (-)
8. Rechtsschutz der Gden gegen gesetzliche Regelungen (zB gg. die Übertragung eines neuen Aufgabenbereichs):
- Kommunal-VB vor dem VerfGH, Art. 75 Nr. 4 LV, §§ 12 Nr. 8, 52 VGHG
- Kommunal-VB vor dem BverfG, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, §§ 13 Nr. 8a, 91 BverfGG
- Individual-VB vor dem BverfG, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 91 BVerfG (↓ Rüge der Verletzung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung, nicht aber von Grundrechten (BverfG), Ausnahmen: Verfahrensrechte, Wahrnehmung grundrechtlich geschützter Lebensbereiche durch die öffentliche Hand (Bsp.: öff.-r. Rundfunk.)
9. Kommunalverfassungsstreitverfahren:
- Streitigkeit zwischen Organen und Organteilen einer kommunalen Gebietskörpterschaft über die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme, deren Rechtswirkungen sich auf die Beziehungen innerhalb der Körperschaft beschränken.
- keine eigene Klageart, sondern FK oder allg. LK
- Klagebefugnis: Verletzung von Mitgliedschaftsrechten aus seiner Organ- oder Organteilstellung.
A. Zulässigkeit
I. VRW: wenn Norm des ÖR streitentscheidend: auch bei Innenrechtsbeziehung, also (+)
II. Klageart: Mangels Außenwirkung kein VA, daher AK (-). LK (+), falls auf Tun, Duldung, Unterlassung gerichtet; sonst FK, da für festzustellendes Rechtsverhältnis auch Innenrechtsbeziehungen ausreichend sind. Nicht mehr vertreten: Klageart sui generis.
III. Besondere SUV’en
1. Klagebefugnis analog § 42 II VwGO: Geltendmachung der Verletzung von Mitgliedschaftsrechten: Teilnahme an den Ratssitzungen, Beratung, Abstimmung, aber nicht: Grundrechte, materielles Recht. I. e. streitig.
2. Bei der FK: Feststellungsinteresse
I. Beteiligtenfähigkeit
1. § 61 Nr. 2 VwGO bei Kollegialorganen
2. § 61 Nr. 2 VwGO analog bei Organteilen oder Einzelorganen. § 61 Nr. 1 VwGO (-), da nicht in der Eigenschaft als natP, sondern als Organ(teil).
A. Begründetheit
Organschaftliche Maßnahme rechtswidrig und Verletzung der Mitgliedschaftsrechte des Klägers.
10. Rechtsbeziehungen der Gde zu Dritten:
- aus §§ 62 Abs. 2 S. 2 und 3 GO sowie 63 GO ergibt sich, daß der BGM allgemeine Behörde der Gde ist.
- Ratsbeschlüsse haben nur ausnahmsweise externe Wirkung haben (z. B. kraft Natur der Sache bei der Umbenennung einer Straße, kein Umsetzungsakt erforderlich; vgl. auch § 29 III; 71, 104 II GO als besondere gesetzliche Regelung), idR betreffen sie aber lediglich die innergemeindliche Willensbildung.
- Vertretung: § 63 GO: grundsätzliche Vertretung der Gde durch den BGM (↓ für die interne Willensbildung ist idR der Rat zuständig)
- Verpflichtungsgeschäfte: § 64 GO: Schriftform + zwei Unterschriften (BGM und eine weitere vertretungsberechtigte Person). ↓ Ausnahme: § 64 Abs. 2 GO - Geschäfte der laufenden Verwaltung.
↓ Verhältnis zwischen Vertretung und Willensbildung: §§ 63 f./ 41 GO. ↓
Abstraktionsprinzip: ob ein Rechtsgeschäft für und gegen die Gde wirkt richtet sich allein nach der Frage einer wirksamen Vertretung. Ausnahmen: Kollusion und Evidenz (wie im BGB AT),
↓ Schriftform des § 64 bei Verpflichtungsgeschäften: nach hM ist wie folgt zu unterscheiden:
1. bei privatrechtlichen Erklärungen stellt § 64 Abs. 1 S. 1 GO keine echte Formvorschrift im Sinne des § 125 BGB dar. Arg.: abschließende Kodifikation der Formvorschriften im Zivilrecht. Hier daher: öff.-r. Beschränkung der Vertretungsmacht. Verstoß: § 177 BGB, genehmigungsfähiges, schwebend unwirksames Rechtsgeschäft. Beachte: Grundsätze über die Anscheins/Duldungsvollmacht nach hM nicht anwendbar.
2. bei öffentlich-rechtlichen Erklärungen: echte Formvorschriften. Arg.: Vorrang des BGB greift hier nicht.
11. Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden
- § 107 GO:
- Unternehmen nur, wenn dringender öffentlicher Zweck besteht und ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gde besteht
- Nicht wirtschaftliche Einrichtungen: § 107 II GO.
- § 108 GO: privatrechtliche Beteiligung
A. Kreise
1. Rechtliche Einordnung: siehe zunächst C. 1. Darüber hinaus Verbandskörperschaften der krs.-angeh. Gden.
2. Aufgaben: Wahrnehmung überörtlicher Angelegenheiten (§ 2 I 1 KrO); § 2 II KrO: übertragener Wirkungskreis
3. Subsidiär ggü. der Gde (Komplementärfunktion: BVerfG).
4. Besonderheiten beim Kreis:
- Wichtigstes Organ: Kreistag, keine Allzuständigkeit, aber § 26 KrO. Sein Vorsitzender ist der Landrat.
- Kreisausschuß: ähnlich dem Hpt-Ausschuß der Gde, "kollegiales Lenkungsorgan des Kreises"
- Landrat: in seiner Funktion als Leiter der Kreisverwaltung hat er ähnliche Aufgaben wie der Bürgermeister, außerdem ist er nach §§ 58 f. KrO zusammen mit dem Kreisausschuß untere staatliche Verwaltungsbehörde. Er führt die allgemeine und die Sonderaufsicht über die Gden des Kreises und nimmt alle Aufgaben wahr, die durch Gesetz der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde zugrewiesen sind.
- Wahl: ab 1999 Direktwahl.
1. Auswirkungen des KVerfÄndG auf Kreisebene
- Direktwahl des LR’s, der, vereinfacht gesagt, die Kompetenzen des bisherigen OKD und des ehrenamtlichen LR’s in sich vereint.
- Keine wesentlichen strukturellen Änderungen
- Einwohnerantrag (§ 22 KrO), Bürgerbegehren und -entscheid (§ 23 KrO)
- Neufassung der Vorschriften über die Zuständigkeiten des Kreistags (§ 26 KrO), der Fraktionsbildung (§ 40 KrO), die Kreisumlage (§ 56 KrO) (Änderungen der Genehmigungserfordernisse)
A. Höhere Gemeindeverbände:
1. Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland (öff.-r. Selbstverwaltungskörperschaften (§ 2 LVerbO), reine Verbandskörperschaften (§ 1 LVerbO), die, wenn sie bestehen, durch Art. 28 II 2 GG geschützt werden: Aufgaben: Straßenwesen, Gesundheitswesen, Kulturwesen usf. (§ 5 LVerbO).
2. KV Ruhrgebiet (KVRG)
3. Zweckverbände (GkG), Aufgabe: gemeinsame Erfüllung komm. Aufgaben aus Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten (häufig: Wasserversorgung; Volkshochschulen)
4. Keine Gde.-Verbände sind die komm. Spitzenverbände ("Deutscher Städetag"; "Deutscher Landkreistag").
A. KVerfÄndG v. 17.05.1994/Übergangsrecht
Häufig gestellte Fragen zu Kommunalrecht NW
Was ist Kommunalrecht?
Kommunalrecht ist der Sammelbegriff für alle Rechtsvorschriften, die die Organisation, Rechtsstellung, Aufgaben, Bildung, Umbildung und Auflösung von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die Rechtsverhältnisse zu ihren Angehörigen regeln.
Welchen Zweck hat das Kommunalrecht?
Das Kommunalrecht dient der bürgerschaftlichen Mitwirkung an der örtlichen Verwaltung.
Was sind die wesentlichen Stationen der Entwicklung des Kommunalrechts in NRW?
Ansätze gab es in frühgeschichtlicher Zeit und im Mittelalter (Städtebildung). Die Preußische Städteordnung von 1808 war ein wichtiger Schritt. Die WRV gewährleistete das kommunale Selbstverwaltungsrecht verfassungsrechtlich. Die DGO von 1935 schaffte die Selbstverwaltung de facto ab. 1946 erfolgte eine Neufassung in der britischen Besatzungszone, die im Wesentlichen durch die GO NW von 1952 (Norddeutsche Ratsverfassung) übernommen wurde. Das Kommunalverfassungsänderungsgesetz (KVerfÄndG) von 1994 führte zur Abschaffung der kommunalen Doppelspitze.
Was waren die Hintergründe des Kommunalverfassungsänderungsgesetzes (KVerfÄndG)?
Das KVerfÄndG zielte auf die Abschaffung der kommunalen Doppelspitze, die Vereinfachung der Gemeindeleitung, die Anpassung der gesetzlichen Regelungen an die kommunale Praxis, die Stärkung der Bürgerbeteiligung, die Schaffung von Ausländerbeiräten und die Förderung der Gleichstellung.
Welche gesetzlichen Grundlagen sind für das Kommunalrecht relevant?
Wesentliche Grundlagen sind Art. 28 II GG, 78 LV (Garantie der komm. Selbstverwaltung), Art. 106 GG (Steuern), GO, KrO, LVerbO, KWahlG sowie kommunales Satzungsrecht.
Was sind Gebietskörperschaften im kommunalen Kontext?
Gebietskörperschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, deren Hoheitsbereich durch einen räumlich abgegrenzten Teil des Staatsgebiets bestimmt wird. Gemeinden und Kreise sind Beispiele.
Welche Erscheinungsformen von Gebietskörperschaften gibt es?
Die kleinste Gebietskörperschaft ist die Gemeinde (Gemeinden und Städte), Gemeindeverbände sind die Kreise und die höheren Gemeindeverbände. Die Unterscheidung zwischen kreisfreier und kreisangehöriger Stadt ist relevant.
Was bedeutet kommunale Selbstverwaltung?
Die kommunale Selbstverwaltung bedeutet, dass Gemeinden alleinige Träger der öffentlichen Verwaltung in ihrem Gebiet sind. Dies umfasst das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze und in eigener Verantwortung zu regeln.
Welche Aufgaben haben die Gemeinden?
Gemeinden nehmen Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben) und Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wahr.
Wie sieht die staatliche Aufsicht über die Gemeinden aus?
Das Land überwacht die Verwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Es gibt allgemeine Aufsicht (Rechtmäßigkeitskontrolle), Sonderaufsicht (bei Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung) und Fachaufsicht (Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle).
Welche Gemeindeorgane gibt es?
Die wesentlichen Gemeindeorgane sind der Rat, die Ausschüsse, die Bezirksvertretungen und Ortschaften sowie der hauptamtliche Bürgermeister.
Welche Funktion hat der Rat?
Der Rat ist das wichtigste Organ der Gemeinde und repräsentiert die Bürgerschaft. Er ist für alle Angelegenheiten der Gemeinde zuständig, sofern diese nicht anderen Organen zugewiesen sind.
Was sind Ausschüsse?
Ausschüsse dienen der Entlastung des Rates und bereiten Ratsbeschlüsse vor. Es gibt Pflichtausschüsse wie den Hauptausschuss, den Finanzausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss.
Welche Aufgaben hat der Bürgermeister?
Der Bürgermeister ist Hauptverwaltungsbeamter der Gemeinde und "Chef der Verwaltung". Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und vertritt die Gemeinde gesetzlich.
Was ist ein Verwaltungsvorstand?
Der Verwaltungsvorstand ist ein Gremium von Fachleuten, das den Bürgermeister bei der Verwaltungsführung unterstützt und als Bindeglied zwischen Rat und Verwaltung fungiert.
Wer sind Einwohner und Bürger einer Gemeinde?
Einwohner ist, wer im Gemeindegebiet wohnt. Bürger ist, wer zu den Gemeindewahlen berechtigt ist.
Was ist die Satzungshoheit der Gemeinden?
Die Satzungshoheit ermöglicht es den Gemeinden, eigene Rechtsnormen (Satzungen) im Bereich eigener Angelegenheiten zu erlassen.
Wie können sich Gemeinden gegen gesetzliche Regelungen wehren?
Gemeinden können sich durch Kommunal-Verfassungsbeschwerde vor dem VerfGH und dem BverfG wehren.
Was ist ein Kommunalverfassungsstreitverfahren?
Ein Kommunalverfassungsstreitverfahren ist eine Streitigkeit zwischen Organen und Organteilen einer kommunalen Gebietskörperschaft über die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme, deren Rechtswirkungen sich auf die Beziehungen innerhalb der Körperschaft beschränken.
Wie sind die Rechtsbeziehungen der Gemeinde zu Dritten geregelt?
Der Bürgermeister ist allgemeine Behörde der Gemeinde. Die Vertretung erfolgt grundsätzlich durch den Bürgermeister, Verpflichtungsgeschäfte bedürfen der Schriftform und zwei Unterschriften.
Unter welchen Voraussetzungen dürfen Gemeinden wirtschaftlich tätig werden?
Gemeinden dürfen Unternehmen nur betreiben, wenn ein dringender öffentlicher Zweck besteht und ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde besteht.
Welche Aufgaben haben die Kreise?
Kreise nehmen überörtliche Angelegenheiten wahr und üben eine Komplementärfunktion gegenüber den Gemeinden aus.
Was sind höhere Gemeindeverbände?
Höhere Gemeindeverbände sind beispielsweise die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland, der KV Ruhrgebiet (KVRG) und Zweckverbände.
Welche Auswirkungen hatte das KVerfÄndG auf Kreisebene?
Das KVerfÄndG führte zur Direktwahl des Landrats, der die Kompetenzen des bisherigen Oberkreisdirektors und des ehrenamtlichen Landrats in sich vereint.
- Quote paper
- Torsten Martini (Author), 1998, Nordrhein-westfälisches Kommunalrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95794