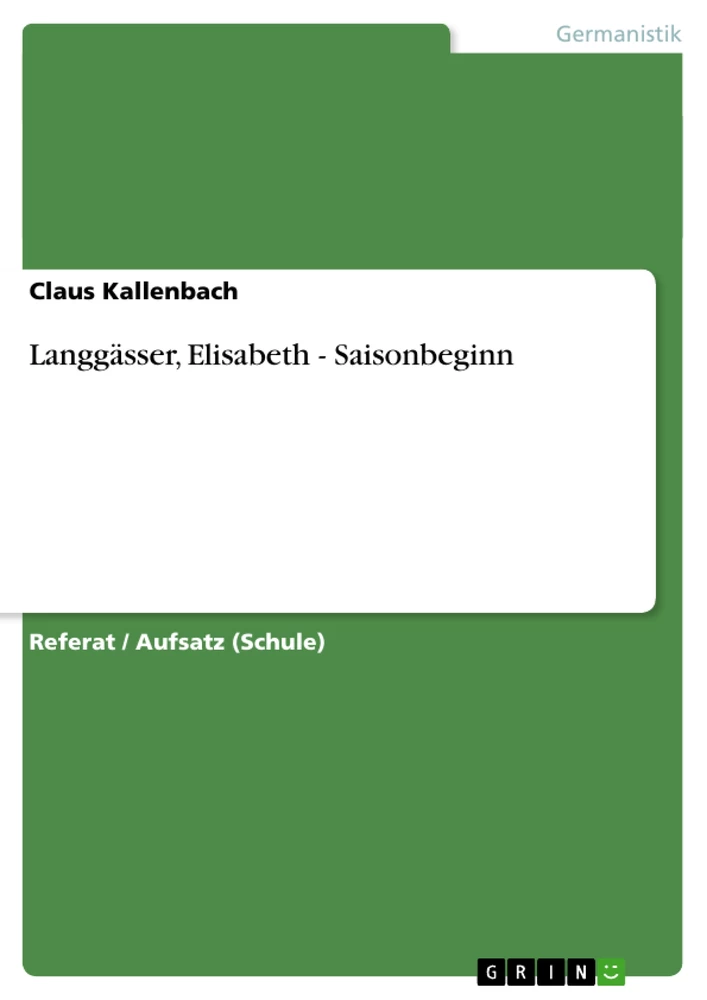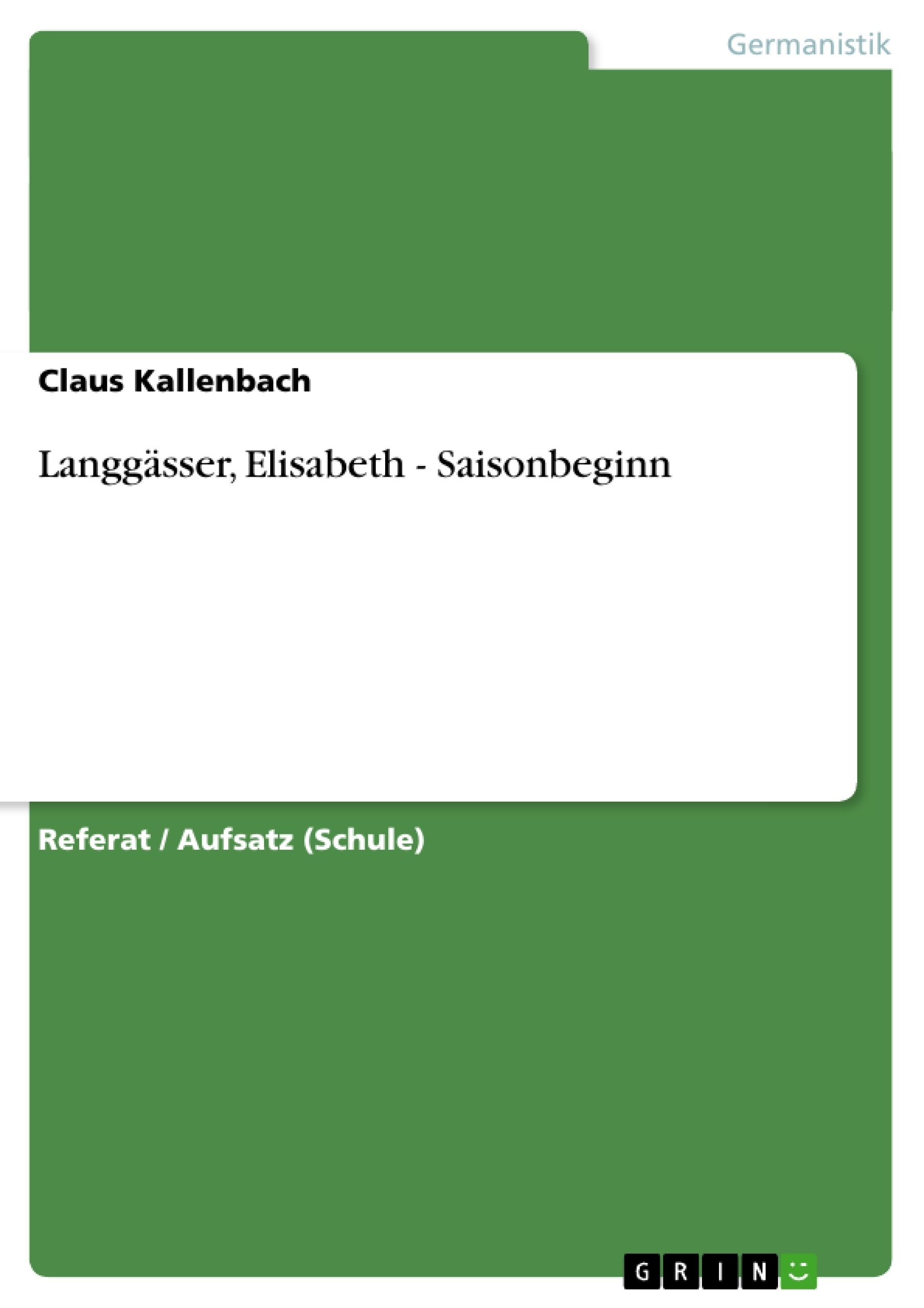Interpretation
Die Autorin Elisabeth Langgässer beginnt in ihrem Text ,, Saisonbeginn" mit einer Situationsbeschreibung und dem Leitmotiv ,, Schild", in den Zeilen eins bis vier. In einer bildhaften Sprache (Metapher) in den Zeilen fünf bis dreizehn, beschreibt sie den Idealismus angelehnt an der Natur, einer Ortschaft, um den Blick im Kontrast dazu auf die Gesellschaft zu lenken. Dies gelingt ihr durch die Beschreibung einer Klassifizierung der Gesellschaft im Durchschnitt in den Zeilen vierzehn bis neunzehn., wobei auch das Umfeld und der Zweck der Ortschaft ausgeleuchtet wird. Das geht am deutlichsten aus den Sätzen in Zeile neunzehn und zwanzig hervor, da es heißt ,, Das Geld würde anrollen,, und ,, Alles war darauf vorbereitet".
Über die Zuordnung in den Zeilen zwanzig bis vierundzwanzig unter Verwendung des Leitmotivs ,, Schild" findet die Autorin zur Religiösen Auseinandersetzung zwischen Christentum und Judentum, über die Passionsgeschichte Jesus Christus. Bevor ich hierauf weiter eingehe, möchte ich vorher nochmals auf die Zuordnung kommen. Mit Zuordnung meine ich zum Beispiel in Zeile einundzwanzig ,, Haarnadelkurven zu dem Totenkopf"; ,, Kilometerschild und Schilder für Fußgänger". Das sind Synonyme für gesellschaftliche Ordnung .
Doch nun zurück zur Religion. Die Geschichte der Menschheit in bezug zur Religion lehrt uns, dass Kriege immer aus Glaubenskonflikten heraus entstanden sind. Diese Aussage sehe ich im Kontext zu dem Satzauszug in Zeile siebenundzwanzig"er behauptet nur, der König zu sein, hatte im Laufe der Jahrhunderte an Heftigkeit eingeb üß t." Diese Anspielung verstehe ich als Hinweis an den Leser zu vergleichen, ob sich hier in der Kurzgeschichte nicht die Geschichte wiederholt, ja, ob Jesus hier nicht zum zweitenmal gekreuzigt wurde, da er auch Jude war.
Im weiteren verlauf des Textes beschreibt die Autorin den Prozess, der sich mit der Aufstellung des Schildes beschäftigt. Dabei personifiziert sie ,, Die Arbeiter", indem sie die Zahlensymbolik benutzt und ,, Drei Männer" schreibt, was man auf die Trinität* beziehen könnte. In diesem Zusammenhang finden wir auch die ,,Ordnung" wieder, da beschrieben wird , wie die drei Männer beraten, wo sie das Schild am besten platzieren können, ohne die Ordnung der Ortschaft durcheinander zu bringen oder gar zu gefährden. Dies finden wir alles in den Zeilen achtundzwanzig bis siebzig. Dem Kontext in diesem Zeilenabschnitt entnehme ich, den bezug zur Glaubensverschiedenheit der Menschen.
Aus den Zeilen einundsiebzig bis achtundachtzig entnehme ich die Reaktionen der verschiedenen Menschen, aus unterschiedlicher Gesellschaftsklassen. Die Autorin versteht es die Passivität und Unschuld darzustellen. Das erkennt an dem Beispiel ,, Schulkinder", die sogar den Arbeitern helfen wollen, aber nicht wissen, was sie tun. ,, Die Nonnen", in Bezug auf Gott und Religion, die trotz ihrer Nähe zu Gott und Glauben ihre Augen vor der Wahrheit schließen. Die Männer sind mit dieser Wirkung zufrieden ist es doch allen aufgefallen und dennoch nimmt niemand Anstoß daran, denn es betrifft ,, sie" ja nicht. Obwohl der Hinweis und die Mahnung durch das Kreuz Jesus Christus offensichtlich ist und im Text rhetorisch in Zeile vierundachtzig durch ,, Der Pfosten, kerzengrade, trug das Schild mit der weithin sichtbaren Inschrift, die Nachmittagssonne glitt wie ein Fingerüber die zollgroßen Buchstaben hin und fuhr jeden einzelnen langsam nach, wie den Richtspruch auf einer Tafel" unterstrichen wird. Es ist auch eine Anklage, eine Anklage an die Gesellschaft, ihr ,,Schwarz-weiß - Denken" zu sehen.
Durch den Schlusssatz in Zeile neunundneunzig ,,In diesem Kurort sind Juden unerwünscht" , der in meinen Augen der Schlüsselsatz zum Verständnis der Kurzgeschichte ist, wird deutlich wie schleichend und unerwartet sich ,,Kriminalität", ,,Menschenverachtung" und ,,Ignoranz" in unserer Gesellschaft ausbreiten können.
*Trinität (Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit), in der christlichen Theologie die Lehre, dass Gott als drei Personen existiert (Vater, Sohn und Heiliger Geist), die in einer Substanz oder Seinsweise vereint sind. Im Neuen Testament, wo die Lehre nicht explizit ausgeführt wird, bezieht sich der Begriff Gott fast ausschließlich auf den Vater. Jesus Christus, der Sohn, wird jedoch in einer einzigartigen Beziehung zum Vater gesehen, während der Heilige Geist auch als eine unterschiedene göttliche Person in Erscheinung tritt.
Der Begriff ,,trinitas" wurde im 2. Jahrhundert von dem lateinischen Theologen Tertullian geprägt, doch die Lehre entwickelte sich erst durch die Diskussionen über das Wesen Christi. Die Trinitätslehre, die schließlich im 4. Jahrhundert formuliert wurde, erklärte die drei Personen für ebenbürtig. Im Westen verglich Augustinus in seinem Werk De Trinitate (400- 416, Über die Trinität) die Dreieinigkeit Gottes mit analogen Strukturen im menschlichen Geist und verstand den Heiligen Geist als die gegenseitige Liebe zwischen Vater und Sohn (obwohl die letztere Ansicht mit dem Glauben schwer zu vereinbaren ist, nach dem der Heilige Geist ein eigenes, ebenbürtiges Mitglied der Trinität ist). Der Nachdruck auf die Gleichrangigkeit hat jedoch nie dazu geführt, den Primat des Vaters in Zweifel zu ziehen, von dem die anderen beiden Personen abstammen, und sei es auch in Ewigkeit. Für ein angemessenes Verständnis der trinitarischen Gottesvorstellungen dürfen die Unterscheidungen zwischen den Personen der Trinität nie so scharf gezogen werden, als ob von einer Vielheit von Göttern die Rede sei, noch dürfen die Unterschiede zugunsten eines undifferenzierten Monismus vernachlässigt werden.
Die Lehre von der Trinität kann auf verschiedenen Ebenen verstanden werden. Auf einer Ebene lässt sie sich als ein Mittel beschreiben, mit dem der Begriff Gottes innerhalb des christlichen Diskurses bestimmt wird. Gott ist nicht nur ein christlicher Begriff, und er bedarf einer spezifischen Definition durch die christliche Theologie. Diese Notwendigkeit einer spezifisch christlichen Definition wird bereits im Neuen Testament sichtbar, wo Paulus sagt: ,,(... es sind viele Götter und viele Herren), so haben wir doch nur einen Gott, den Vater ...; und einen Herrn, Jesus Christus ..." (1. Korinther 8, 5-6). Diese Worte bezeichnen den Beginn eines Prozesses der Klärung und Definition, an dessen Ende die Lehre von der Trinität steht. Auf einer anderen Ebene kann die Dreifaltigkeit als ein Ausdruck der christlichen Erfahrung angesehen werden: Der Gott des Alten Testaments war auf neue Weise erfahren worden, zunächst in der Person Christi, und dann in Gestalt des Geistes, der in der neuen Kirche waltete. Auf einer dritten und spekulativen Ebene des Verständnisses enthüllt die Lehre die Dynamik der christlichen Vorstellung von Gott, die eine Quelle, eine Fortentwicklung und eine Rückkehr enthält (uranfängliches, sich ausdrückendes und vereinigendes Sein). In dieser Hinsicht hat die Lehre von der Trinität Parallelen sowohl in der Philosophie (das ,,Absolute" von G. W. F. Hegel) wie in anderen Religionen (Trimurti des Hinduismus).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Analyse des Textes "Saisonbeginn" von Elisabeth Langgässer?
Die Analyse des Textes "Saisonbeginn" von Elisabeth Langgässer konzentriert sich auf die Auseinandersetzung mit Gesellschaftskritik, religiösen Konflikten (Christentum und Judentum) und dem Aufkommen von Ausgrenzung und Ignoranz.
Wie beschreibt die Autorin Elisabeth Langgässer die Gesellschaft in ihrem Text?
Langgässer beschreibt die Gesellschaft durch eine Klassifizierung und beleuchtet das Umfeld und den Zweck der Ortschaft. Sie deutet an, dass das Geld eine wichtige Rolle spielt und alles darauf ausgerichtet ist.
Welche Rolle spielt das Leitmotiv "Schild" im Text?
Das Leitmotiv "Schild" dient als Verbindungselement und verweist auf die religiöse Auseinandersetzung zwischen Christentum und Judentum, insbesondere auf die Passionsgeschichte Jesu Christi. Es wird auch als Synonym für gesellschaftliche Ordnung interpretiert.
Wie interpretiert der Autor die Rolle der Religion im Text?
Der Autor interpretiert die religiösen Elemente als Hinweise auf Glaubenskonflikte und vergleicht diese mit historischen Kriegen, die aus solchen Konflikten entstanden sind. Es wird sogar eine mögliche Wiederholung der Kreuzigung Jesu angedeutet.
Welche Bedeutung haben die "drei Männer" im Text?
Die "drei Männer" werden als Personifizierung der Arbeiter interpretiert, wobei die Zahlensymbolik auf die Trinität* hinweisen könnte. Ihre Beratung über die Platzierung des Schildes symbolisiert die Suche nach Ordnung und die Vermeidung von Konflikten im Bezug zur Glaubensverschiedenheit der Menschen.
Wie werden die Reaktionen der verschiedenen Gesellschaftsklassen auf das Schild beschrieben?
Die Reaktionen der verschiedenen Gesellschaftsklassen werden als passiv und unschuldig dargestellt. Schulkinder wollen helfen, Nonnen verschließen die Augen, und die Männer sind zufrieden, dass die Botschaft angekommen ist, ohne dass jemand Anstoß daran nimmt.
Was ist die zentrale Botschaft des Schlusssatzes?
Der Schlusssatz "In diesem Kurort sind Juden unerwünscht" wird als Schlüsselsatz interpretiert, der verdeutlicht, wie schleichend und unerwartet sich Kriminalität, Menschenverachtung und Ignoranz in der Gesellschaft ausbreiten können.
Was bedeutet Trinität in diesem Kontext?
Trinität (Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit) ist in der christlichen Theologie die Lehre, dass Gott als drei Personen existiert (Vater, Sohn und Heiliger Geist), die in einer Substanz oder Seinsweise vereint sind. Die Information über die Trinität stammt aus der Microsoft ® Encarta ® 99 Enzyklopädie.
- Quote paper
- Claus Kallenbach (Author), 2000, Langgässer, Elisabeth - Saisonbeginn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95765