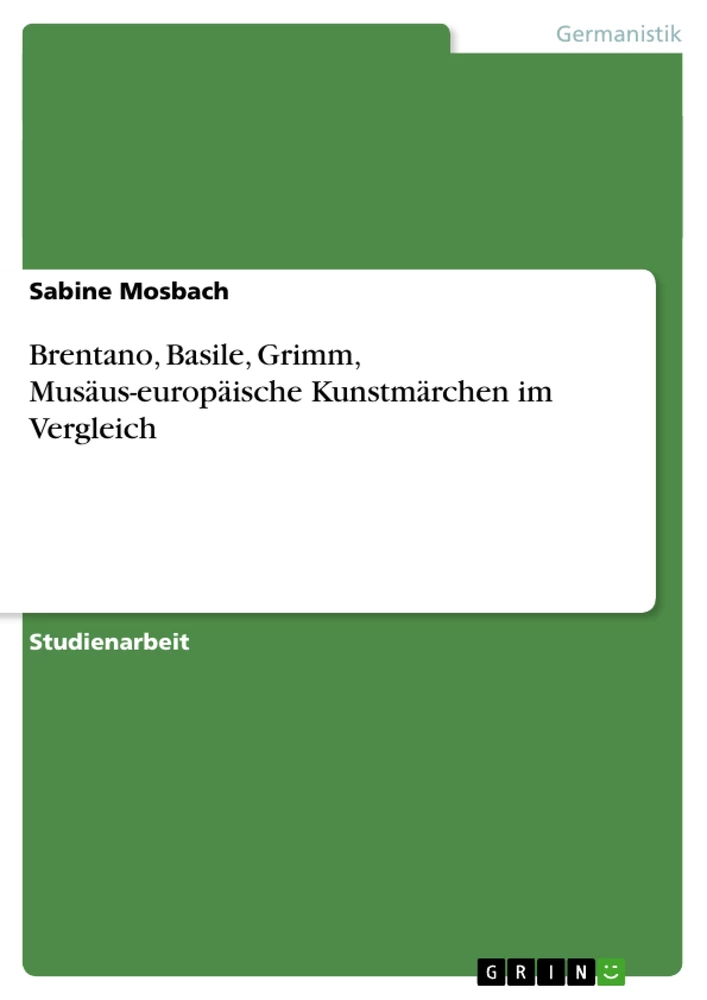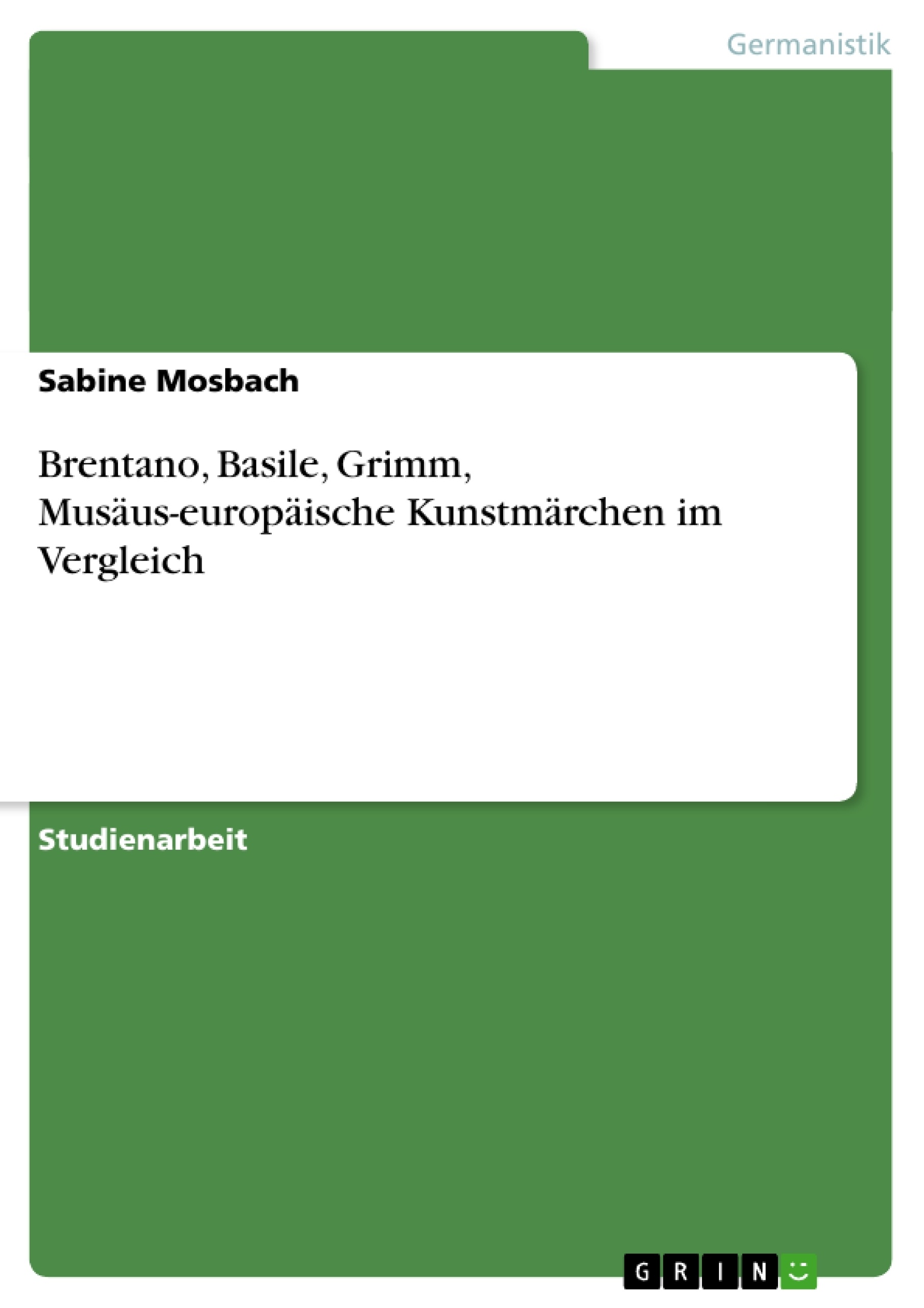Inhaltsverzeichnis
1. Brentano und die Brüder Grimm lesen Basile
1.1. Brentano und Basile Chronik der Entstehung der Märchen Brentanos
1.2. Die Brüder Grimm, Brentano und Basile
2. Giambattista Basile: ,,Lo cunto de'l'Uerco”
1.2. Der wilde Mann
1.3. Der Zauberer
1.4. Vergleich der beiden Übersetzungen
2.3.1 Tabellarischer Vergleich
3. Clemens Brentano: ,,Das Märchen von dem Dilldapp“
3.1. Vergleichende Analyse I
3.1.1. Tabellarischer Vergleich
4. Die Brüder Grimm: ,,Tischchen deck dich, Goldesel streck dich und Knüppel aus dem Sack" KHM 36
4.1. Vergleichende Analyse II
4.1.1. Tabellarischer Vergleich
5. J. K. A. Musäus: ,,Roland Knappen“
5.1. Vergleichende Analyse III
5.1.1. Tabellarischer Vergleich
1. Brentano und die Brüder Grimm lesen Basile
Vier Märchen im Vergleich lassen feststellen, daß sich viele Geschichten um wundersame Dinge ranken: ein dummer Junge, der Dummling, der sich am Ende als kluger Held erweisen wird, Gegenstände, die Zauberkräfte besitzen, geschenkt von phantastischen Wesen. Märchen wurden erzählt und weitergegeben, bis man anfing, sie aufzuschreiben. Es gibt immer wiederkehrende Handlungen, die, einmal gelesen, einen neuen Dichter dazu bewegt haben, selbst auch eine Geschichte zu schreiben.
Mit diesem Thema möchte ich mich in dieser Arbeit befassen: Der Vergleich von Märchen verschiedener Autoren mit ähnlichen, teilweise identischen Rahmenhandlung. Wo liegen Unterschiede, wo Gemeinsamkeiten.
1.1. Brentano und Basile
,,Lo cunto de li trattenemiento de` pecerille"-,,Die Erzählung der Erzählungen oder die Unterhaltung für die Kleinen."
Verfasser dieser Märchensammlung, auch bekannt unter dem Namen ,,Il Pentamerone", ist der Neapolitaner Giambattista Basile (1575-1632) .
Es ist eben dieses Werk, welches zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Dichter Clemens Brentano (1778-1842) dazu inspirierte, seine ,,italienischen Märchen" zu schreiben.
Durch seinen Vater, den italienischen Kaufmann Pietro Antonio Brentano ist Clemens Brentano im Besitz des Pentamerone in der italienischen Übersetzung Roma 1679 .
Brentano ist bei seinen Zeitgenossen als Interpret eigener und fremder Texte bekannt, die er frei vorträgt und auch improvisiert. Angeregt durch den Pentamerone kommt ihm die Idee einer eigenen Märchensammlung, wie er es an seinen Schwager, den Dichter Achim von Arnim, in einem Brief schreibt:
,, Ich denke auf Michaelis, wenn's zuschlägt, die italienischen Kindermärchen für deutsche Kinder zu bearbeiten". 1
Wann genau er wirklich mit dieser Arbeit beginnt, ist nicht sicher geklärt, fest steht aber, daß er bereits in den Jahren 1805/11, die er in Heidelberg verbringt, gehörte Märchen aufschreibt. In Jahre 1815 ersteht Brentano die zweite Übersetzung des Pentamerone, Napole 1749. Er schreibt in einem Brief an Wilhelm Grimm:
,, Ich habe auch den Pentamerone in Prag gekauft, Neapel 1749 oktav 453 Seiten.
Die italienische Ü bersetzung, Cunto delli cunti, die ich hatte und sie kennen, ist
Eigentlich kindischer und nicht so acconciosiacosacheisch (-,,sintemalig", gestelzt). 2
Welche der beiden Übersetzungen des Pentamerone, die sich in Brentanos Besitz befanden, für seine Märchen als Vorlage diente, ist nicht eindeutig geklärt, einige Märchen entstanden vor Erwerb der Ausgabe Napole1749. Es ist aber davon auszugehen, daß er beide benutzte. Brentano gilt schon in seiner Zeit als überragendes Genie, mit oft wechselnden Gemütsverfassungen. Im Text Joseph von Eichendorffs ,,Brentano und seine Märchen" wird dieser von seiner Freundin Karoline von Günderode13 wie folgt beschrieben: ,,Es kommt mir oft vor, als hätte er viele Seelen(...)" (S.619)
Auch gilt er als unsteht und unruhig und voll von fast unkontrollierbarer Phantasie, was dazu führt, daß Brentano seine Werke immer wieder aufs neue überarbeitet, verändert und erweitert.
Im Jahre 1815/16 entsteht ,,Das Märchen vom Dilldapp" basierend auf Basiles Märchen ,,Lo cunto de'l'Uerco".
1.1.1. Chronik der Entstehung der Märchen Brentanos
1804/05 Zu Beginn der Heidelberger Jahre entstehen erste Pläne für eine Sammlung von Kinder- und Volksmärchen.
1805/06 Brentano beginnt mündlich übelieferte Märchen aufzuschreiben
1809 Zwischen Brentano und seinen Freunden kommt es zu vermehrten Nachrichten in brieflicher Form über Märchenpläne
1809 Brentano bittet Wilhelm Grimm um ,,einige Kindermärchen"3
1810 Der Dichter fragt die Brüder Wilhelm und Jacob Grimm nach einer Sammlung ihrer
Märchen; ein Großteil des Materials wird ihm am 25. Oktober des Jahres zugesandt, er läßt es aber kaum in seine Arbeit einfließen.
1810 Seit September arbeitet Brentano an den Rheinmärchen
1811 Brentano beendet die Arbeit an dem ,,Märchen von dem Rhein und dem Müller
Radlauf" und bietet seine Märchen Johann Georg Zimmer zum Druck an, entschließt sich dann aber doch noch weiter an ihnen zu arbeiten
1811/13 Brentano ersteht in Prag die neapolitanische Ausgabe des Pentamerone Napole 1749; in dieser Ausgabe sind heute im Inhaltsverzeichnis einige Titel zur Bearbeitung bezeichnet
1812 Der erste Band der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm erscheint
1813 Brentano ersteht die Kinder- und Hausmärchen und befindet sie als langweilig
1815 Der zweite Band der Kinder- und Hausmärchen erscheint; Brentano möchte die Rheinmärchen drucken lassen
1815/16 Brentano arbeitet mit neuer Intensität vor allem an den Italienischen Märchen; das Märchen vom Dilldapp entsteht
1816 Die Rheinmärchen werden dem Buchhändler Georg Andreas Reimer mit der Option zum Druck vorgelegt, weitere Märchen anfügen zu können; am 6. Februar stellt Brentano sein ,,Märchen vom Witzenspitzel" im Kreise seiner Freunde vor, er erregt Aufsehen mit diesem Werk; am 16. Oktober begegnet Brentano das erste Mal Luise Hensel4, die seine Rückkehr zum katholischen Glauben bewirkt
1817 Brentano reißt nach Dülmen, wo er auf Anna Katharina Emmerick5 trifft, deren Visionen er beobachtet und aufzeichnet; angeblich führt er sogar während dieser Zeit den Pentamerone mit sich
1823 Brentano trifft in Frankfurt auf den Historiker Jaohann Friedrich Böhmer, der ihn mehrfach versucht zu einer weiteren Herausgabe der Märchen zu bewegen
1826 Böhme veröffentlicht ohne Wissen Brentanos in einer Frankfurter Zeitschrift aus den Rheinmärchen: ,,Wie der Müller Radlauf dem Rhein ein Lied sang und einen Traum hatte" und das ,,Myrtenfräulein"
1827 Brentano ist empört über die Art der Veröffentlichung seiner Märchen, bittet erst Böhme um die Bearbeitung seiner Manuskripte, um sich aber dann im November selbst damit zu befassen
1828 Die Pläne für einen neuen Druck werden vorläufig verworfen, da Brentano befürchtet, daß seine Geschichten über Emmericks Visionen ebenso für phantastische Geschichten gehalten werden könnten, wie die Rheinmärchen es sind
1831 Brentano verfaßt weitere Märchen
1837 Die letzte Fassung des ,,Märchen vom Gockel, Hinkel und Gackeleia" erscheint
1839 Es scheint, daß die Rheinmärchen doch noch gedruckt werden sollen, denn Brentano schreibt an Böhmer:
,,Ich wünsche vorerst das Märchen vom Rhein alleine gedruckt, was den Leuten Freude machen und sie einladen würde, die nachfolgenden Märchen zu kaufen" 6
1840 Brentano macht deutlich, dass vor seinem Tode keine Veröffentlichungen der Märchen möglich sein werden, da er sie in seiner Schöpfungswut immer weiter bearbeitet
1.2. Die Brüder Grimm und Brentano
Wilhelm Grimm schreibt im Jahre 1809 an seinen Bruder Jacob: ,,Ein Hauptbuch ist die kleine italienische Sammlung, die er hat, und weil sie so selten, wird wohl nichtsübrig bleiben für uns als das verdammte Abschreiben." 7
Er spricht hier von Brentanos Besitz der italienischen Ausgabe des ,,Il Pentamerone" von Basile. Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm beneiden den Dichter um dessen Buch und bitten ihn, eine Abschrift erstellen zu dürfen. Die Bitte wird ihnen Brentano zunächst nicht erfüllen, ihnen aber später seine eigenen Arbeiten zukommenlassen. Als die Grimms versuchen 1819 bei der Versteigerung der Bibliothek Brentanos den Pentamerone zu erstehen, müssen sie zu ihrem Bedauern feststellen, dass Clemens Brentano das Buch mit sich genommen hat, um weiter an den italienischen Märchen zu arbeiten. Schließlich erhalten Jacob und Wilhelm Grimm eine Fassung der ,,Italienischen Märchen" Brentanos, verwenden sie aber nicht als Vorlage. Ihnen ist, wie auch schon das Werk Basiles zu unmoralisch und unverfroren, so sagt Wilhelm Grimm:
,,Das Original bleibt also unentbehrlich, und hier zeigt sichüberhaupt eine bedeutende Schwierigkeit des ganzen Unternehmens, welche vielleicht auch eine Ü bersetzung des Basile zurückhalten wird. Bei den freieren Sitten jener Zeit,überhaupt der jetzt noch oft bemerkten
Natürlichkeit der Italiener in gewissen Dingen konnte manches erzählt werden, was bei und mit Recht Anstoss macht, nicht einmal der wirklich unsittlichen, bei Straparola ,manchmal schamlosen Erzählungen und Räthsel zu gedenken. Sollten wir einen Rat geben, so wäre wohl das Beste, dergleichen Märchen im Anhang und nur im Auszug zu liefern, diesen aberüberhaupt als eine Zugabe besonders zu verkaufen." 8
Basiles Werk war nicht unbedingt für Kinder, sondern auch zur Belustigung bei Hofe gedacht, so daß sein Stil entsprechend freizügig ist.
Die Kinder- und Hausmärchen entstehen zu Beginn der Biedermeierzeit und werden den moralischen Maßstäben dieser Zeit getreu verfaßt, aber trotz dieser Diskrepant finden sich einige Werke aus dem Pentamerone auch in den Kinder- und Hausmärchen wieder: Der wilde Mann - Tischchen deck dich
Die Aschenkatze - Aschenputtel Petrosinella - Rapunzel
Die Küchenmagd - Schneewittchem Die beiden Kuchen - Frau Holle Sonn, Mond und Talia- Dornröschen
2. Giambattista Basile ,,Lo Cunto de'l'Uerco"
Das Märchen ,,Lo Cunto de'l'Uerco" von Basile entstand in den Jahren 1634-1636 und ist in zwei deutschen Übersetzungen bekannt:
- ,,Der wilde Mann" von Liebrecht
- ,,Der Zauberer" von Potthoff
Im Folgenden sollen diese beiden Fassungen miteinander und anschließend mit Brentanos ,,Das Märchen von dem Dilldapp" verglichen werden.
1.1. Der wilde Mann
Das Märchen ,,Der wilde Mann" handelt von dem Jungen Anton von Maregliano, der mit seiner Mutter Masella und sechs unverheirateten Schwestern lebt.
Er wird von Masella als Strafe für seine Dummheit aus dem Haus gejagt und trifft beim Fortlaufen auf einen wilden Mann.
Anton zeigt keine Furcht und so stellt ihn der Unhold in seine Dienste ein.
Nach zwei Jahren guten Lebens befällt Anton das Heimweh und der wilde Mann schickt ihn nach Hause, nicht ohne ihm einen Esel auf sein Reise mitzugeben. Er warnt ihn aber davor, die Worte ,,Arre Cacaure" zu ihm zu sprechen.
Anton jedoch widersetzt sich diesem und spricht kurz nach Antritt seiner Reise aus lauter Neugier die Worte aus. Sofort beginnt der Esel Edelsteine von sich zu geben. Anton reißt beglückt weiter und kehrt des nachts in einer Herberge ein. Hier teilt er dem Wirt mit, er solle sich um den Esel kümmern, sich aber hüten die Worte ,,Arre Cacaure" zu sagen. Neugierig geworden probiert es der Wirt aber sogleich aus und zufrieden über das Ergebnis vertauscht er den Wunderesel mit einem Normalen.
Als Anton am nächsten Tag zu Hause ankommt und seiner Mutter das Wunder vorführen möchte, kommt es zu einer Bescherung, die Masella dazu bringt, ihn erneut zu verjagen. Anton kehrt zum wilden Mann zurück, der ihn für seine Dummheit ausschimpft, trotzdem aber wieder aufnimmt.
Ein Jahr später packt ihn erneut das Heimweh und diesmal erhält er vom wilden Mann eine Serviette. Bis er bei seiner Mutter sei, solle er aber den Satz ,,Tu dich auf und tu dich zu, Serviette" nicht von sich geben.
Wiederum hält Anton sich nicht daran und probiert das Tuch aus, welches ihm in seinem Inneren Edelstein offenbart.
Abends rastet er im gleichen Gasthaus wie das Jahr zuvor und bittet den Wirt, seine Serviette aufzuheben ,aber nicht die wundersamen Worte zu sprechen.
Auch diesmal vertauscht der Wirt das ihm Anvertraute aus, nachdem er die durch den Spruch erschienen Reichtümer gesehen hat. Anton bringt so seiner Mutter eine völlig normale Serviette, begreift aber just in diesem Moment, als auch da zweite Kunststück nicht funktioniert, daß er vom Wirt betrogen worden ist. Als er den Zorn Masellas über das zweite mißlungen Wunder sieht, ergreift er die Flucht und eilt zurück zum wilden Mann. Wiederum erhält er von diesem die verdiente Schelte und lebt drei weiter Jahre bei ihm. Doch auch ein drittes mal ergreift ihn die Sehnsucht, so daß er sich erneut auf den Weg macht. Das dritte Geschenk, daß er vom wilden Mann erhält, ist ein Stock, zu dem er nicht sagen soll: ,,Steh auf, Prügel" oder ,,Leg dich nieder, Prügel".
Schon nach kurzem Wegstück spricht er aber die verbotene Worte. Kaum hat er ,,Steh auf, Prügel" ausgesprochen, beginnt der Stock ihm eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen. Erst als Anton sagen kann ,,Leg dich nieder, Prügel", hört diese auf.
Im Wirtshaus wird er freundlich empfangen und er übergibt den Stock mit der gleichen Warnung wie die beiden Male vorher dem Wirt, der seine dritte Gelegenheit auf Gold und Edelsteine wittert.
Als Anton schläft, spricht der Wirt ,,Steh auf, Prügel" und dieser beginnt auf ihn einzuschlagen. Laut schreiend bittet er Anton um Hilfe, dieser sagt ihm, er würde ihm nur zur Seite stehen, wenn er den Esel und die Serviette zurückerhalte. Der Wirt tut wie geheißen und als Anton ,,Leg dich nieder, Prügel" spricht, läßt dieser vom Betrüger ab und Anton kann beruhigt und guter Dinge nach Hause reiten. Dort verheiratet er seine Schwestern und macht sein Mutter zu seiner reichen Frau.
2.2. Der Zauberer
In der Übersetzung ,,Der Zauberer" ist dieselbe Handlung wie in ,,Der wilde Mann" zu
verfolgen. Geringfügige Abweichungen finden sich zum Beispiel in der Namensgebung der Protagonisten, der Lokalisation und ein wenig im Sprachstil, was im Folgenden erläutert werden soll.
2.3. Vergleich der beiden Übersetzungen
Es fällt auf, daß in dem Märchen ,,Der wilde Mann" immer wieder Aufzählungen zufinden sind:
,,Statt eines Kindchens, Püppchens, Täubchens ist mir ein solcher Dummerjan, ein solcher Einfaltspinsel hingegeben worden " (Der wilde Mannn, S.24)
,,Pack dich, du Klotz; marschier, du Pinsel; fort mit dir, du Unruhestifter;
Charakteristisch ist zum Beispiel auch die metaphorisch Ausdrucksweise:
,,... da man anfing, in den Läden der Luna die Lichter anzuzünden."
Diese Stilmittel fehlen in der Übersetzung ,,Der Zauberer". Auch fällt auf, dass in dieses Werk insgesamt derber und anzüglicher geschrieben scheint, als ,,Der wilde Mann". Potthoff beschreibt die Stelle, an welcher den Dummling das Heimweh packt folgendermaßen:
,,Der Zauberer, der ihm bis auf den Grund seines Herzens sah und erkannte, daßes ihn juckte wie eine junge Frau, die nicht auf ihre Kosten gekommen ist(...)" (S.14)
Liebknecht übersetzt die gleiche Stelle:
,,Der wilde Mann, der ihm ins Herz schaute, sah ihm an der Nase die Unruhe seines Hintern an, indem Anton sich hin- und herdrehte, als wenn er mit dem Allerwertesten auf Nadeln gesessen hätte (...)" (S.26)
Ein weiteres Beispiel dafür ist die Beschreibung der Szene, in welcher der Esel auf den
Zauberspruch reagiert. Im wilden Mann gibt er Edelsteine von hinten von sich, während beim Zauberer von prächtiger Entladung und kostbarem Durchfall die Rede ist. Beide Märchen beginnen mit einer kurzen Zusammenfassung des Inhalts und einem einleitenden Satz, vor der eigentlichen Geschichte. Das Ende ist bei beiden identisch: eine Binsenweisheit, die sich in der Geschichte bewahrheitet hat.
2.3.1. Tabellarischer Vergleich
Der wilde Mann Der Zauberer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In dieser Gegenüberstellung ist gut zu erkennen, daß bei den Grunfiguren und Rahmenbedingungen kaum Abweichungen bestehen. In den kommenden Vergleichen mit den Märchen anderer Schriftsteller werde ich mich deshalb auf die Arbeit mit der Übersetzung Felix Liebknechts beschränken.
3. Clemens Brentano ,,Das Märchen von dem Dilldapp
,,Das Märchen von dem Dilldapp" erzählt die Geschichte eines Jungen, der Dilldapp genannt wird und mit seiner Mutter, Frau Schlender, und seinen drei Schwestern Andrienne, Saloppe und Kontusche zusammenlebt.
Eines Tages jagt die Mutter Dilldapp aufgrund seiner Dummheit aus dem Haus und als er fortläuft, trifft er auf einen Esel, auf dem er weiter reitet. Kurze Zeit später begegnet ihm ein Knüppel, der ihn in eine Höhle bringt. Darin lebt ein Ungeheuer, mit dem Dilldapp sich gleich gut versteht und so in dessen Dienste tritt.
Nachdem er vier Jahre ein angenehmes Leben geführt hat, träumt er eines nachts von der Krankheit seiner ältesten Schwester Saloppe und bittet das Ungeheuer, ihn nach Hause ziehen zu lassen. Sein Bitte wird ihm gewährt und er erhält den Esel als Begleitung mit auf den Weg, gemeinsam mit den Worten:
,, Daßdein Glück recht lange daure, Sag zum Esel nie Auregakaure!"
Nach einem längeren Ritt rastet er und unterhält sich dabei mit dem Esel. Während dieses
Gesprächs fällt das Wort ,,Auregakaure" und kaum hat er es ausgesprochen, beginnt das Tier Gold und Edelsteine von sich zu geben.
Abends gelangt das Paar in ein Wirtshaus, in welchem Dilldapp dem Wirt den Rat gibt beim versorgen des Esels nicht ,,Auragakaure" zu sprechen. Der Wirt neugierig geworden, probiert, als Dilldapp schläft, das Untersagte aus und als er die Reichtümer sieht, tauscht er den Goldesel gegen einen einfachen Esel aus.
Am nächsten Tag erreicht der Dummling sein Elternhaus, findet seine älteste Schwester abwesend und als er seiner Mutter das Wundertier vorführen möchte, beginnt dieses seinen Unrat statt Gold uns Edelsteinen im Haus zu verteilen. Daraufhin jagt ihn Frau Schlender erneut aus dem Haus und der Betrogene rennt geradewegs zurück zu dem Ungeheuer. Dieses weiß bereits aus einem Zauberspiegel um das Geschehene und schimpft Dilldapp ordentlich aus, bevor er ihn wieder in seine Dienste aufnimmt.
Weiter vier Jahre vergehen und wieder wird der Junge von einem Traum gequält, der ihm diesmal schlimmes über sein zweite Schwester Saloppe zeigt. Sofort macht er sich auf den Weg und erhält bei seinem Aufbruch eine Serviette, zu welcher er, bis er das Haus seiner Mutter erreicht hat, nicht sagen soll:
,,Tüchlein, Tüchlein tu dich auf!"
Er beginnt sein Reise und rastet an der gleichen Stelle wie das letzte Mal, um sich laut zu versichern, die Worte nicht zu sprechen. Als er dies tut, öffnet sich die Serviette und zeigt ihm wundervolle Schätze. Beglückt eilt Dilldapp weiter und um zu nächtigen, kehrt er im gleichen Wirtshaus ein.
Wieder bittet er den Wirt um sein Schweigen und wieder hintergeht dieser ihn und vertauscht das zweite Zaubergeschenk ebenfalls.
Heimgekehrt, findet er nur noch seine Mutter und seine jüngste Schwester vor. Um sie zu trösten beeilt er sich, den Zauber der Serviette vorzuführen, der natürlich mißlingt und dazu führt, daß er begreift, vom Wirt betrogen zu sein. Seine Mutter schert das wenig und bevor sie ihn ein weiteres Mal verprügeln kann, läuft Dilldapp schnurstracks zu dem vertrauten Ungeheuer, um diesem sein Leid zu klagen. Nach reichlichem Schelten hat es ein Einsehen und stellt den Dummling erneut ein.
Drei Jahre vergehen und er träumt vom Verschwinden seiner Schwester Kontusche und seiner Mutter, die nun alleine lebt. Umgehend macht er sich auf den Weg, im Gepäck einen Knüppel. Das Ungeheuer warnt ihn davor den Knüppel mit den Worten:
,,Knüppel auf!" oder ,,Knüppel ab!"
anzusprechen und läßt ihn ziehen. Um aber nicht wieder dem Wirt in die Falle zu gehen, probiert er den Knüppel aus, um vorbereitet zu sein. Er spricht ,,Knüppel auf!" und sofort beginnt dieser auf seinem Rücken zu tanzen, bis Dilldapp es schafft ,,Knüppel ab!" zu rufen. Im Wirtshaus angelang, beginnt das gleich Spiel wie die beiden Male davor. Allerdings verrät der Junge dem Wirt ihm nur den ersten Teil des Zauberspruchs. Auch trifft er diesmal auf seine älteste Schwester Kontusche, die ihm erzählt, das die Franzosen, inzwischen in der Stadt, Schuld an ihrem Unglück seien.
Kaum hat sich Dilldapp schlafen gelegt, schon kommt der Wirt zu seinem Einsatz und erlebt diesmal eine böse Überraschung. Wie auch Dilldapp erhält er eine gehörige Tracht Prügel, kann den Knüppel aber nicht zum Aufhören bringen. Laut schreiend bittet er dessen Besitzer um Hilfe, der nur gegen Herausgabe seines Eselsund der Serviette bereit ist, den Wirt zu erlösen.
Dilldapp reitet mit seiner Schwester nach Hause und trifft unterwegs seine beiden anderen Schwestern bei einer Gruppe Komödianten, löst sie mit Hilfe des Knüppels aus und gemeinsam erreichen sie ihre Heimatstadt.
Auch hier hilft ihm das dritte Zaubergeschenk, die Franzosen aus der Stadt zu vertreiben. Seine Schwestern und auch Frau Schlender heiraten und sie leben glücklich und zufrieden.
3.1. Vergleichende Analyse I
Brentanos ,,das Märchen von dem Dilldapp" unterscheidet sich von der Rahmenhandlung nicht wesentlich von der Vorlage, Basiles ,,Der wilde Mann". Betrachtet man das Märchen aber genauer lassen sich deutliche Unterschiede im Stil und in Details erkennen. Brentanos Schreibweise ist charakterisiert durch einen sehr ironischen Stil, der einen manchmal an der Ernsthaftigkeit des Schriftstellers zweifeln lässt. Besonders deutlich tritt dies in den Reime hervor, die die Erzählung durchziehen.
Hier kommt hier die lyrische Ader Brentanos zum Ausdruck. So erzählt er von den anfänglichen Mißverständnissen zwischen Mutter und Sohn, die zum Rauswurf Dilldapps führen, in Reimform:
,,Die Mutter sprach: ,,Dilldapp, bring Wachs!" Da brachte ihr der Dilldapp Flachs. Die Mutter sprach: ,,Dilldapp, bring Zwirn!" Da brachte ihr der Dilldapp Birn`n.(...)" (S.292)
Auch die Beschimpfungen und die Prügel, die Dilldapp für sein Dummheit erleiden muß, beschreibt Brentano über deutlich und ausgiebig:
,,Er schrie: ,,O weh, o weh, mein Kopf!"
Sie sprach: ,,Ich hechle den Flachs, du Tropf."
Sie schlug er schrie: ,,Weh, meine Stirn!"
Sie sprach: ,,Ich schüttle nur die Birn.(...)" (S.292)
Am Ende legt er dem Bräutigam Frau Schlenders einen Spruch in den Mund, der seine
vorhergehende Reime, die zunächst nicht ironisch erscheinen, an Ernsthaftigkeit mangeln läßt:
,,Ich Herr Hildebrandt,
Stell den Spießan die Mauer.
Schier hätte er gesagt: ,,Wand"." (S.306)
Auch im Text sind Stellen zu finden, in denen man Ironie findet:
,,Nun gab ihm seine Mutter zwar allerlei Näschereien, (...), zum Beispiel Ohrfeigen, Kopfnüsse und wohl manchen Nasenstüber obendrein(...)." (S. 291)
Man kann den Eindruck gewinnen, das die metaphorischen Ansätze in Basiles Märchen, von Brentano mit Absicht überspitz dargestellt werden. Basile beschreibt in seinem Märchen das Fortlaufen des Dummlings mit den Worten:
,,(...) und lief so weit und so lange er konnte, bis er gegen Sonnenuntergang, um die Stunde, da man anfing, in den Läden der Luna die Lichter anzuzünden, am Fuße eines Berges anlangte, der so hoch war, daßer mit dem Himmel zusammenstieß." (Basile, S.24)
Man gewinnt den Eindruck einer sehr poetischen Umschreibung der Situation, Brentano hingegen beschreibt die selbe Stelle um einiges ausführlicher:
,,(...) bis er nichts mehr sah vor lauter Nacht, denn die Sonne hatte er schonübern Haufen gelaufen, und an der Abendröte hatte er die bunten Fensterscheiben eingerannt. Da hängten die Sterne ihre tausend Laternen zum Himmel heraus, und der Mond zog als Nachtwächter auf die Wache , um zu sehen, wer so erbärmlich laufe. Dilldapp aber bekümmerte sich um nichts, und da er an einem Berg stand, der mit dem Himmel den Kopf zusammenstieß, rannte er zu guter Letzt auch da hinauf." (Brentano, S. 293)
Zwar läßt sich die poetische Seite nicht leugnen, aber es hat den Eindruck, daß Brentano bewußt übertreibt, vielleicht um die phantastische Seite des Märchens zu unterstreichen.
Generell ist der deutsche Dichter in seine Beschreibungen genauer, so werden bei ihm die Schwestern, nur halb so viele wie bei Basile9, mit Namen benannt und spielen eine Schlüsselrolle, nämlich den Grund der drei Heimreisen Dilldapps. Auch benutzt er ihre Person, um seine Abneigung gegen Frankreich und seine Bewohner zum Ausdruck zu bringen. Mit diesem Thema möchte ich mich später noch genauer befassen.
Basile erwähnt sechs unverheiratet Schwestern, denen aber weiter keine Bedeutung zukommt. Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird genauer beschrieben als in Basiles Märchen. Einzig das Treffen mit dem wilden Mann, beziehungsweise dem Ungeheuer ist von den Ausführungen der Genauigkeit identisch:
,,Er war ein ganz kleiner Knirps und nicht gr öß er als ein Zwerg; er hatte aber einen Kopf, dicker als ein indischer Kürbis, eine blattrige Stirn, die Augenbrauen zusammengewachsen, verdrehte Augen, eine platte Nase mit zwei Nasenlöchern, die zwei Kloaken schienen, einen Mund so großwie eine Kelter, aus welchem zwei Hauer hervorragten, die ihm bis an die Fußspitzen gingen ( )" (Basile, S.25)
,,Das Ungeheuer sah aus wie ein andrer Mensch auch, außer daßes wohl dreimal so großund viermal so breit war. Es hatte eine sehr edle Gesichtsbildung, nur sein Kopf war so dick wie ein Pfefferballen; seine Nase so breit wie ein Blasebalg; seine Augen, deren es nur eines hatte, und zwar mitten auf der Stirn, waren lieblich spielend, wie das Rad an einem Schiebkarren; sein Mund war freundlich, aber so großals die Brieftasche eines Postmeisters(...)" (Brentano, S. 293)
Trotzdem scheint auch hier der Stil Brentanos spielerischer als die Übersetzung Basiles.
Weiter Unterschiede zwischen den beiden Märchen finden sich in der Zeitangabe, wie lange sich der Junge bei dem Unhold aufhält.
Auch die Person des Wirtes, seine betrügerische Seite, wird von Brentano ausführlicher beschrieben. Während bei Basile der Wirt Anton nur die Rechnung über geleistete Arbeit stellt, wird Dilldapp bei Brenano so bewußt und offensichtlich hintergangen, ohne das er zunächst Verdacht schöpft, das sich der Leser wundern kann:
,,So summieren sie denn zusammen, soviel für Brot, soviel für Wein, das für Suppe, das für Fleisch, fünf für Stallgeld, zehn für das Nachtlager und fünfzehn das Frühstück und Biergeld (...)." (Basile, S.28)
,,Ich hab ihnen Ehr und Respekt erwiesen für 50 Taler, 25mal nach ihrem Namen gefragt, macht 25 Taler, 25mal die Mütze abgezogen, macht wieder 25 Taler, weiter ein Hirsebrei, ein Bund Stroh, Stallung für den werten Esel, Haber und Heu, dann Dach und Fach, Schutz und Trutz, Putz und Nutz, Nachtmusik von Katzen und Mäusen, ein Adagio von den Grillen, ein Morgenlied von den Schwalben, (...)." (Brentano, S.297)
Der aber am deutlichsten hervorstechende Unterschied ist die Beschreibung der Person des Dummlings selbst. Basiles Anton scheint dem Leser von seiner Mutter ungerecht behandelt, da er allem Anschein nach nicht der dumme Junge ist, für den man ihn hält und er am Ende durch seine eigene List ein gutes Ende findet, er erkennt, daß seine Neugier und sein Ungehorsam ihn nicht weiterbringen.
Brentano hingegen verleiht seinem Dilldapp von Anfang bis Ende den Charakter eines Idioten, der ,,mehr Glück als Verstand hat". Schon in dem Untertitel zum Märchen ,,Kinder und Toren haben das Glück bei den Ohren" weißt er der Hauptperson seine Rolle zu. Der Ungang mit den drei Zaubergaben macht dies besonders deutlich:
,,Ja mein lieber Auregakaure, ich weißwohl, daßdu Auregakaure heißest, aber ich werde mich hüten, dich Auregakaure zu nennen, weil das gute Ungeheuer mir es angeraten hat." (Brentano, S.296)
,,(...)er war noch nicht hundert Schritte vorwärtsgekommen, als er auch schon von den Graue stieg und sogleich sagte: >Arre cacaure<;(...)" (Basile, S.26)
Gemeinsam ist beiden Märchen die Aufzählung in der Beschreibung von Dingen oder Situationen.
Eine wichtige Rolle in Brentanos Werk spielt der historisch politische Hintergrund. Brentano lebt zur Zeit der Neapolitanischen Herrschaft10, der mit seiner Politik unter anderem eine Auflösung des Deutschen Reiches anstrebte.
Clemens Brentano stand diesem Bestreben, wie auch der Person Napoleons abgeneigt gegenüber und dies läßt sich in ,,Das Märchen von dem Dilldapp" deutlich nachvollziehen. Zunächst beginnt er seine Geschichte mir dem Satz:
,,In einem deutschen Land, in der guten Stadt, welche sich in den Wellen des ehrlichen
Flusses spiegelt, lebte Frau Schlender,(...).Doch hatte sie drei fleißige Töchter,(...), dieälteste hießAndrienne, die zweite Saloppe und die jüngste Kontusche."
Alle positiven Eigenschaften und Tugenden sind hier seiner Heimat zugeschrieben.
Die drei Schwestern haben die Namen französischer Modeformen der damaligen Zeit, die im Laufe der Geschichte aus der Mode kommen und Unglück widerfährt. Auch werden sie nicht wie Menschen, sondern wie Kleidungsstücke beschrieben:
,,(...); ach, was Andrienne ausgestanden hat, ist nicht zu sagen, sie ist gestürzt und gewendet worden, gesteppt und gefüttert, endlich sind ihr gar Stücke aus dem Rücken geschnitten und an die Ärmel gesetzt worden."
Schuld an allem Übel tragen die Franzosen:
,,Wer anders", erwiderte Kontusche, ,,als die fatalen Franzosen, die bei uns regieren (...)" (Brentano, S. 304)
Diese werden von Dilldapp bei seiner letzten Heimkehr erfolgreich aus der Stadt verbannt:
,,Knüppel auf, Knüppel auf!
Bring mir die Franzosen in Lauf,
Prügel die Mamsellen und Madamen Wieder hin, woher sie kamen!" (Brentano, S. 305)
Seine Schwestern hatte er vorher mit Hilfe des Wundertüchleins in ,,schöne, ehrbare, züchtige Röcklein"11 gekleidet, sie erhalten neue deutsche Namen: Thusnelda, Sieglinde und Else und heiraten, wie ihre Mutter, die sich nun Uta nennt, ehrbare deutsche Männer und leben glücklich und zufrieden. Dilldapp selbst tauft sich um in ,,deutscher Michel". All diese Namen entspringen den deutschen Sagen, Uta als Mutter Brunhildes, so daß Brentanos Neigung zur deutschen Nationalität und der deutschen Tugend deutlich zum Ausdruck kommt.
3.1.1. Tabellarischer Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Die Brüder Grimm: ,,Tischchen deck dich, Goldesel streck dich und Knüppel aus dem Sack" KHM 36
In dem Märchen der Brüder Grimm wird die Geschichte eines Schneiders erzählt, welcher drei Söhne und eine Ziege als einzigen Besitz hat.
Aufgabe der Söhne ist es, die Ziege gut zu Pflegen, da sie alle ernährt. So führt sie der Älteste zum Weiden und als sich die Ziege satt gefressen hat, kehrt er nach Hause zurück. Dort beschwert sich die Ziege beim Vater, sie hätte sich nicht satt essen dürfen und der wütende Schneider jagt seinen ältesten Sohn aus dem Haus.
So geschieht es mit dem zweiten und dem jüngsten Sohn ebenfalls. erst scheint die Ziege zufrieden und dann beschwert sie sich beim Vater, so daß dieser alle seine Söhne aus dem Haus wirft.
Erst als er selbst die Ziege zum Weiden führt, erkennt er, daß sie alle belügt und wird so zornig, daß er die Ziege erst schert und dann zum Teufel jagt.
Die Söhne unterdessen haben eine Lehre angefangen. Der Älteste ist bei einem Tischler und am Ende seiner Lehrzeit bekommt er zum Abschied von diesem einen Tisch, der sich reich mit Essen füllt, wenn man ,,Tischchen, deck dich!" zu ihm sagt.
Mit diesem Geschenk macht sich der Sohn auf den Heimweg zu seinem Vater und kehrt am Abend in einer Herberge ein. Dort lädt er die Gäste zu einem Mahl an seinem Wundertisch ein. Der Wirt, von Neid erfüllt, möchte diesen haben und tauscht, als alles schläft einfach einen alten Tisch gegen den des Gastes ein. Als der Älteste zu seinem Vater zurückkehrt ist die Freude groß, aber leider versagt der Zaubertrick, so daß der Schneider weiter seiner Arbeit nachgehen muß.
Der zweite Sohn ist indes bei einem Müller in der Lehre gewesen und als der Tag des Abschieds naht, schenkt ihm sein Lehrmeister einen Esel, der Gold speit, wenn man das Wort ,,Bricklebritt" spricht. Mit diesem begibt er sich auf die Heimreise und kehrt wie sein Bruder in dem Wirtshaus ein, um zu übernachten. Dort widerfährt dem mittleren Sohn das gleiche Schicksal, denn als der Wirt herausbekommt, was es mit dem Esel auf sich hat, vertauscht er auch diesen mit einem gewöhnlichen Tier. Der Müller kehrt heim und seine Vorstellung mißlingt ebenso, wie die des ersten Sohnes. In einem Brief unterrichten sie den jüngsten Bruder von ihrem Mißgeschick Dieser beendet seine Lehre bei einem Drechsler, der ihm einen Sack mit einem Knüppel darin überreicht. Als Erklärung bekommt er gesagt, daß der Knüppel ihm helfe, falls ihm jemand etwas zuleide tun möchte. So reist er Richtung Heimat.
In dem bekannten Wirtshaus angekommen erzählt er von wundersamen Dingen die er erlebt habe und macht den Wirt neugierig auf seinen Sack. Dieser versucht dem Gast nachts sein Habe zu entwenden und wird dafür mit einer Tracht Prügel des Knüppels gestraft. Er gibt dem jüngsten Sohn den Besitz seiner beiden Brüder heraus und als er zu Hause ankommt, ist die Freude groß und der Vater braucht sich nicht mehr als Schneider verdingen. Am Ende wird die Frage nach der Ziege gestellt und es heißt, sie sei aus Scham über ihr Aussehen in eine Fuchshöhle gekrochen und weder der Fuchs, noch der Bär schaffen es, sie zu verjagen. Erst einer kleinen Biene gelingt es, die Ziege aus der Höhle zu vertreiben.
4.1. Vergleichende Analyse II
Obwohl Wilhelm und Jacob Grimm die Vorlage Brentanos nicht direkt umgearbeitet haben, sind deutliche Parallel zu dessen ,,Märchen vom Dilldapp" und somit auch zu Basiles ,,wilden Mann" zu erkennen.
Drei Zaubergaben werden an drei junge Männer verschenkt, die vorher von dem Vater aus dem Haus gejagt wurden. Im Gegensatz zu Brentano und Basile geben die Grimms ihren Figuren keine Namen und halten sich auch nicht mit der Beschreibung von Details auf. Statt der Mutter kommt die Figur des Vaters ins Spiel, der Reue darüber zeigt, daß er seine Kinder verjagt hat, bevor sie wieder zu ihm zurückkehren.
Auch gelangt nicht Einer drei mal in die gleiche Situation, sondern drei Personen geraten hinein, wobei bei den Brüdern Grimm der jüngste Sohn dafür sorgt, daß sich alles wieder zum Guten wendet. Seine beiden Brüder sind nicht in der Lage mit der Gabe ihrer geschenke umzugehen und prahlen in aller Öffentlichkeit, so daß es ihnen abhanden kommt Die Rolle des Dummling ist nicht klar abgegrenzt, denn sogar der Vater fällt auf die Ziege herein. Gerade die Figur der Ziege ist einzigartig und nur bei den Brüdern Grimm zu finden, die ihr Märchen mit einer Tierfabel beenden, deren moralischer Inhalt ist, daß der Größte nicht unbedingt der Stärkste und Klügste sein muß.
Ein weiterer Unterschied zu den Märchen Brentanos und Basiles ist der, daß die Rolle des Ungeheuers, beziehungsweise des wilden Mannes durch drei Figuren ersetzt wird. Sie werden nicht näher beschrieben und treten nur bei Übergabe der Zaubergeschenke im Geschehen auf. Hier ist es so, daß die Eigenschaften der Geschenke sofort erklärt und benutzt werden dürfen, ohne daß eine Warnung ausgesprochen wird, gegen welche die Beschenkten verstoßen. Man kann sagen, daß sich die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm zwar an der Rahmenhandlung Basiles, beziehungsweise Brentanos orientierten, aber aus schon genannten Gründen eine ganz eigene Form des Märchens verfaßt haben.
4.1.1. Tabellarischer Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Johann Karl August Musäus: ,,Rolands Knappen"
Das Märchen ,,Rolands Knappen" wurde von dem deutschen Schriftsteller Johann August Musäus (1735-1787) verfaßt und ist in der Sammlung ,,Volksmärchen der Deutschen" (1782- 1786) enthalten. Das Märchen erzählt die Geschichte dreier Knappen: Andiol, Amarin und Sarron, die in den Wirren eines Krieges in der Zeit des Frankenreiches unter der Herrschaft Karl des Großen, von ihrem Herrn Roland getrennt werden und nach dessen Tod vor den Feinden fliehen. Auf ihre Flucht treffen sie auf ein Höhle und durch Feuerschein und Hunger angelockt, klopfen sie an die Tür.
Nach längerem hin und her wird ihnen Einlaß gewährt und sie erblicken eine uralte Frau, eine Hexe, die ein Nachtlager für sie bereit hält. Einer von ihnen soll aber bei ihr im Bett schlafen und die Nacht mit ihr verbringen, da sie so 30 Jahre jünger wird.
So geschieht es allen dreien und als sie weiterziehen wollen, fordern sie den Lohn für ihre geleistete Arbeit.
Andriol erhält einen verrosteten Kupferpfennig, Amarin ein Tellertüchlein und Sarron einen Däumling. Zunächst sind sie erbost über den Geiz der alten Frau, bis sie feststellen, daß ihre Geschenke wundersame Fähigkeiten besitzen. Sarron stellt als erster fest, daß er mit Hilfe seine Däumlings unsichtbar wird. Das Tuch tischt ihnen von rechts die Speisen auf, die sie sich wünschen und von links guten Wein. Der Pfennig gibt jedes mal, wenn er umgedreht wird, ein Goldstück. Bei ihrer Weiterreise gelangen sie nach Astorga, wo sie beschließen, getrennt Wege zu gehen, da sich alle drei in die Frau des Königs verlieben. Sie versprechen sich aber, ihre Geheimnisse niemandem zu verraten.
Als die Knappen aber im Dienste der schönen aber bösen Königin stehen, schafft sie es, die drei Wundergaben in ihren Besitz zu bringen. Andriol, Amarin uns Sarron werden vom Hof gejagt. Sie treffen sich wieder und gemeinsam ziehen sie in den Krieg, um dort einen Heldentod zu sterben.
5.1. Vergleichende Analyse III
In dem Märchen ,,Rolands Knappen" von Musäus lassen sich deutliche Parallelen zu den vorangegangenen Märchen ziehen. Wie bei den Grimms erhalten drei junge Männer Zaubergaben, wobei es diesmal keine Brüder, sondern Freunde sind. Auch ist es wieder der jüngste, der am klügsten ist und die Fähigkeiten der Geschenke erkennt. Die Figur der Mutter oder des Vaters fehlt völlig, Musäus löst dies durch die Situation des Krieges, der die drei Knappen zur Flucht zwingt.
Seine Geschichte spielt zu einer konkreten Zeit, der Zeit Karl des Großen12.
Die Zauberin, die statt eines Ungeheuers oder wilden Mannes die Zauergaben überreicht, wird auch in einen historischen Rahmen gelegt, dem Glauben der Kelten an die Macht von Druiden, die zu ihrer Zeit große Macht besaßen:
,,Sie war der letzte Sproßaus dem Stamm der Druiden (...).In der Magie war sie Meisterin und die geheimnisvolle Mistel der Druiden verwandelte sich in ihrer Hand in einen Zauberstab." (Musäus, S.89)
Auch gibt sie die drei Zaubergeschenke nicht freiwillig, wie bei Basile, Brentano und den Grimms geschrieben, sondern wird vom jüngsten der drei Knappen darum gebeten:
,,Lieber Anton, ich weiß, daßdu großes Verlangen hast, die Deinigen zu sehen, und da ich dich so herzlich liebe wie mich selbst, so bin ich ´ s zufrieden, daßdu einmal zu ihnen reisest und deinen Wunsch befriedigst. Nimm also diesen Esel, der dir die Mühseligkeiten des Zufußgehens ersparen wird (...)." (Basile, S. 26)
,,Wohlan, mein lieber und getreuer Diener, folge dem tugendhaften Triebe deines Herzens und gehe zu deiner Mutter ! Aber mit so leeren Händen dürftest du nicht willkommen sein; ich will dir meinen Esel mitgeben (...)." (Brentano, S. 295)
,,Weil du brav und fleißig warst, schenke ich dir einen Esel von besonderer Art (...)." (Grimm, S.138)
,,(...) trat Sarron vor sie und sprach: ,,Es ist nicht Sitte im Lande, einen Gast unbeschenkt von sich zu lassen. Zudem haben wir einen Zehrpfennig von euch verdient (...)." ,,Laßt sehen", sprach sie, ,,ob ich euch mit einer Gabe bedenken kann, bei der sich jeder meiner erinnere." ( Musäus S.91)
Diese Geschenke werden am Ende der Geschichte nicht von der betrügerischen Königin, die hier anstatt der Figur des Wirtes steht, zurückgewonnen, trotzdem finden alle drei ihr Glück, vereint in ihrer Freundschaft.
Wie auch schon bei den Grimms hat das Ende eine moralische Botschaft für den Leser: Reichtum macht nicht glücklich, sondern einsam und sät Zwietracht.
Die Zaubergaben selbst unterscheiden sich von den Geschenken bei Basile, Brentano und den Grimms: statt des Esels ein verrosteter Pfennig, kein Knüppel, sondern ein Däumling der Unsichtbar macht, einzig die Serviette, das Mundtuch ist gleich.
In allen Märchen ist gleich: das die Geschichte einer Reise von Jünglingen, die als neue
Menschen nach Hause zurückkehren, erzähöt wird. Diese Änderung wird bewirkt durch das Zusammentreffen mit einer phantastischen Gestalt, die in Besitz von Zaubergegenständen ist und dies weiterschenkt. Der Verlust der Gaben durch eine betrügerische Person und das gute Ende, daß trotzdem folgt. Auch ist in jeder Geschichte der jüngste Sohn erst der Dummling, dann aber doch der Held.
5.1.1. Tabellarischer Vergleich
Abschließen möchte ich alle vier Märchen, Basiles ,,wilden Mann", Brentanos ,,Dilldapp", ,,Tischlein deck dich" der Brüder Grimm und ,,Rolands Knappen" von Musäus tabellarisch gegenüberstellen.
Literaturverzeichnis
Basile, Giambattista: Der wilde Mann in: Das Märchen aller Märchen ,,Der Pentameron", Erster Tag, Frankfurt, 1982
Bolte, Johannes / Polívka, Georg: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 4.Bd., Leipzig 1930
Bolte, Johannes / Polívka, Georg: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 1. Bd., Leipzig 1913
Brentano, Clemens: Das Märchen von dem Dilldapp in: Italienische Märchen, Frankfurt 1985
von Eichendorff, Joseph: Brentano und seine Märchen, in: Frühwald, Wolfgang / Kemp, Friedhelm (Hrsg.): Clemens Brentano, Mächen, München 1847
Grimm Jacob und Wilhelm: Tischchen deck dich, Goldesel streck dich und Knüppel aus dem Sack in: Kinder- und Hausmärchen, Nr. 36, Hanau, 1961
Klotz, Volker: Das europäische Volksmärchen, Stuttgart 1985
Musäus, Johann Karl August: Rolands Knappen in: Deutsche Volksmärchen, Raststatt 1996 Scherf, Walter: Lexikon der Zaubermärchen, Stuttgart 1982
[...]
1 von Eichendorff, Joseph: ,,Brentano und seine Märchen" S.629
2 Clemens Brentano, Briefe, hrsg. Von Friedrich Seebaß, Bd.II, Nürnberg 1951, S. 127 aus Richter, Dieter: ,,Brentano als Leser Basiles", S.236
3 Von Eichendorff, Joseph: ,,Brentano und seine Märchen", S. 636
4 Luise Hensel: 1798-1876, Pfarrerstochter, Erzieherin, konvertierte 1818 zum katholischen Glauben und trat 1874 in ein Kloster in Paderborn ein. Verfasserin gemütvoller geistlicher Lieder und Gedichte, die teilweise volkstümlich wurden ( u.a. ,Müde bin ich, geh zur Ruh` )
5 Anna Katharina Emmerick: 1774-1824, lebte als Nonne in Dülmen, stigmatisiert seit ihrem 33. Lebensjahr
6 von Eichendorff, Joseph: ,,Brentano und seine Märchen", S. 645
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht Märchen verschiedener Autoren mit ähnlichen oder identischen Handlungsrahmen. Sie untersucht Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Werken.
Welche Märchen werden verglichen?
Die Arbeit konzentriert sich auf Giambattista Basiles ,,Lo Cunto de'l'Uerco" (in den Übersetzungen ,,Der wilde Mann" und ,,Der Zauberer"), Clemens Brentanos ,,Das Märchen von dem Dilldapp", die Brüder Grimms ,,Tischchen deck dich, Goldesel streck dich und Knüppel aus dem Sack" und J. K. A. Musäus' ,,Rolands Knappen".
Welche Rolle spielt Giambattista Basile in dieser Arbeit?
Giambattista Basile und sein Werk ,,Il Pentamerone" (insbesondere ,,Lo Cunto de'l'Uerco") dienten als Inspiration für Clemens Brentano und dessen ,,italienische Märchen". Die Arbeit untersucht, wie Brentano Basiles Werk interpretierte und verarbeitete.
Wie ist die Beziehung zwischen Clemens Brentano und den Brüdern Grimm?
Die Brüder Grimm waren an Brentanos italienischer Märchensammlung interessiert und baten ihn um eine Abschrift von Basiles Pentamerone. Obwohl sie Brentanos Arbeiten erhielten, verwendeten sie diese nicht direkt als Vorlage für ihre Kinder- und Hausmärchen, da sie Basiles Werk als zu unmoralisch empfanden. Dennoch finden sich einige Motive aus dem Pentamerone in den Kinder- und Hausmärchen wieder.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen den Übersetzungen von Basiles ,,Lo Cunto de'l'Uerco"?
Die Übersetzungen ,,Der wilde Mann" (Liebrecht) und ,,Der Zauberer" (Potthoff) unterscheiden sich geringfügig in der Namensgebung der Protagonisten, der Lokalisation und dem Sprachstil. ,,Der wilde Mann" enthält mehr Aufzählungen und metaphorische Ausdrücke, während ,,Der Zauberer" insgesamt derber und anzüglicher wirkt.
Wie unterscheidet sich Brentanos ,,Das Märchen von dem Dilldapp" von Basiles ,,Lo Cunto de'l'Uerco"?
Brentanos Märchen zeichnet sich durch einen ironischen Stil, Reime und übertriebene Darstellungen aus. Er beschreibt die Charaktere und Situationen genauer und fügt historische und politische Bezüge hinzu, insbesondere seine Abneigung gegen Frankreich und Napoleon.
Welche Rolle spielt der historisch-politische Hintergrund in Brentanos ,,Das Märchen von dem Dilldapp"?
Brentano lebte zur Zeit der Neapolitanischen Herrschaft und stand den politischen Bestrebungen Napoleons ablehnend gegenüber. Dies spiegelt sich in seinem Märchen wider, in dem er positive Eigenschaften und Tugenden seiner Heimat zuschreibt und seine Abneigung gegen Frankreich durch die Darstellung der französischen Modeformen und die Verbannung der Franzosen aus der Stadt zum Ausdruck bringt.
Wie unterscheidet sich das Märchen der Brüder Grimm von den anderen?
Die Brüder Grimm orientierten sich an der Rahmenhandlung Basiles und Brentanos, schufen aber eine eigene Form des Märchens. Sie ersetzen die Figur der Mutter durch den Vater und geben ihren Figuren keine Namen. Anstelle eines einzelnen Protagonisten gibt es drei Söhne, wobei der jüngste alles zum Guten wendet. Sie fügen auch die einzigartige Figur der Ziege hinzu und beenden das Märchen mit einer Tierfabel.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen den Märchen und Musäus Werk?
Ähnlich wie bei den Grimms erhalten in Musäus' Werk drei junge Männer Zaubergaben, wobei der jüngste am klügsten ist. Die Geschichte spielt zu einer konkreten Zeit, der Zeit Karls des Großen, und die Zauberin wird in einen historischen Rahmen gelegt. Die Zaubergaben selbst unterscheiden sich von den Geschenken in den anderen Märchen. Anders als bei den anderen Märchen, werden die Wundergegenstände nicht zurückgestohlen.
Welche Hauptthemen werden in den verglichenen Märchen behandelt?
Zu den Hauptthemen gehören die Reise von Jünglingen, die als neue Menschen nach Hause zurückkehren, das Zusammentreffen mit phantastischen Gestalten, der Besitz und Verlust von Zaubergegenständen, die Rolle des Dummlings und die moralische Botschaft am Ende der Geschichte.
- Quote paper
- Sabine Mosbach (Author), 1999, Brentano, Basile, Grimm, Musäus-europäische Kunstmärchen im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95747