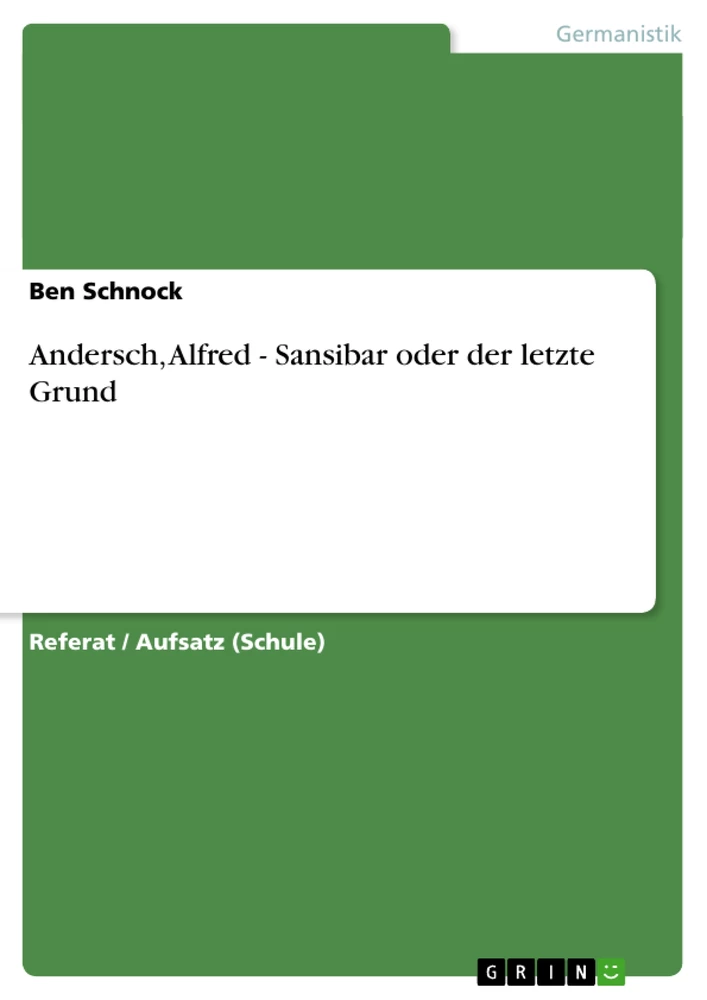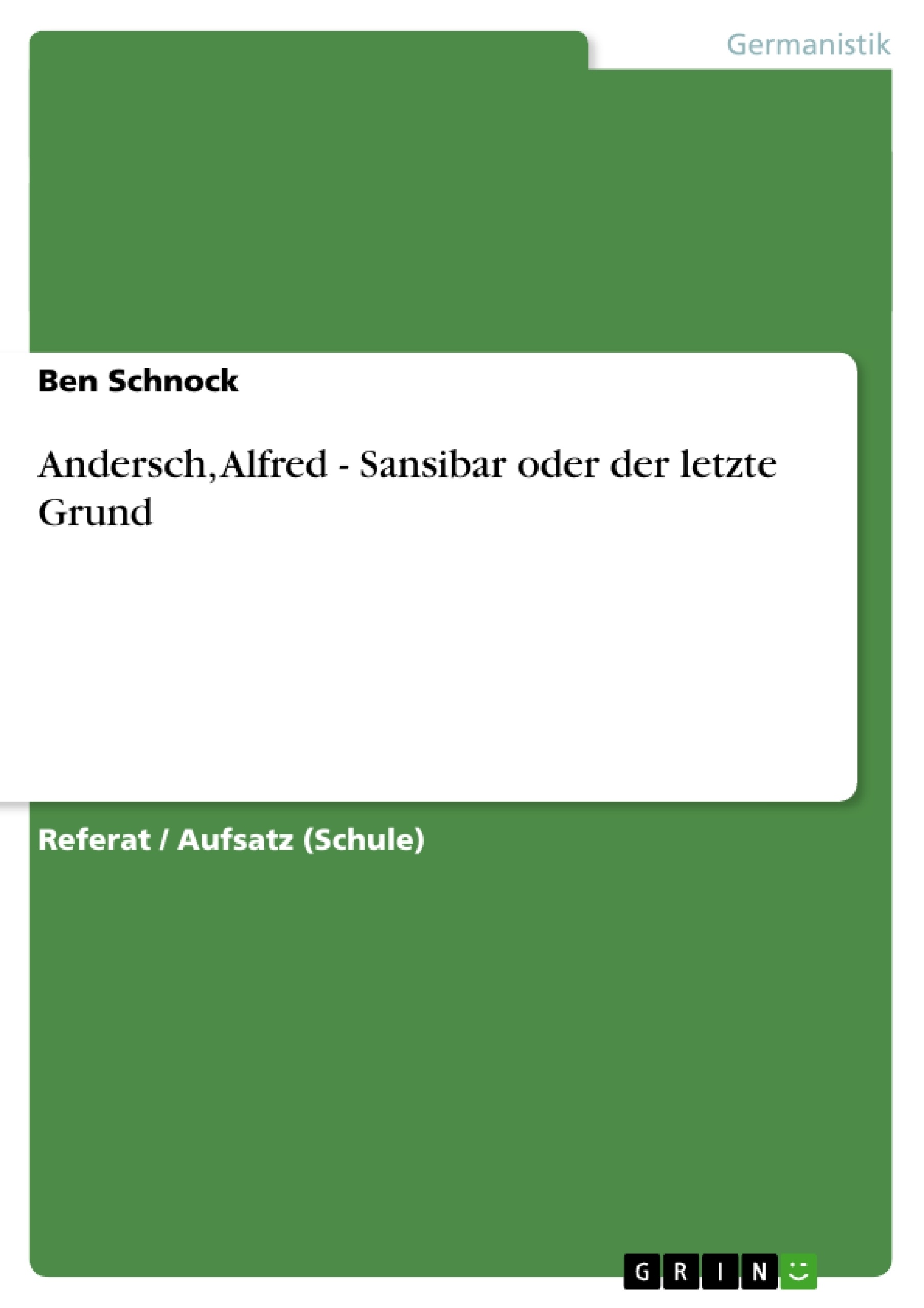Was bedeutet Freiheit wirklich, wenn das Echo des Krieges in den Herzen der Menschen widerhallt? Alfred Anderschs Roman „Sansibar oder der letzte Grund“, angesiedelt im Jahr 1937, entführt uns in das beschauliche Fischerdorf Rerik an der Ostsee, wo sechs unterschiedliche Schicksale auf ebenso schicksalhafte Weise miteinander verwoben werden. Im Zentrum steht Gregor, ein ehemaliger KPD-Instrukteur, der auf der Suche nach einem Ausweg aus den Fängen des Kommunismus ist und sich zusehends von seiner Partei entfremdet. Seine Begegnung mit dem „Lesenden Klosterschüler“, einer Holzplastik von Ernst Barlach, wird zum Schlüsselmoment einer tiefgreifenden Wandlung. Die Skulptur, Sinnbild für geistige Freiheit, konfrontiert Gregor mit seiner Vergangenheit und eröffnet ihm eine neue Perspektive auf sein Leben. Doch Gregor ist nicht der Einzige, der nach Freiheit strebt. Da ist auch Judith, die Jüdin auf der Flucht vor dem Nazi-Regime, und Pastor Helander, der versucht, den Glauben in einer Zeit der Dunkelheit zu bewahren. Sie alle suchen einen Weg aus ihrer persönlichen Gefangenschaft, und Gregor wird widerwillig zum Katalysator ihrer Befreiung. Andersch verwebt auf meisterhafte Weise die individuellen Schicksale seiner Protagonisten mit den politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen der Zeit. Der Roman ist ein Plädoyer für die Freiheit des Geistes, die Kraft der Menschlichkeit und die Bedeutung individueller Entscheidungen in einer Welt, die von Ideologien und Dogmen geprägt ist. Begleiten Sie Gregor auf seiner Reise der Selbstfindung, während er sich den Fragen nach Schuld, Verantwortung und der Möglichkeit eines Neuanfangs stellt. Erleben Sie, wie die Begegnung mit dem „Lesenden Klosterschüler“ sein Leben für immer verändert und ihn dazu inspiriert, für seine Überzeugungen einzustehen. „Sansibar oder der letzte Grund“ ist ein zeitloser Klassiker der deutschen Nachkriegsliteratur, der bis heute nichts von seiner Brisanz und Relevanz verloren hat. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung, Emotionen und philosophischer Fragen, die Sie noch lange nach dem Zuklappen des Buches beschäftigen werden. Entdecken Sie die verborgenen Schätze dieses literarischen Meisterwerks und lassen Sie sich von der Suche nach Freiheit und Menschlichkeit inspirieren. Ein Muss für alle Liebhaber anspruchsvoller Literatur und Geschichtsinteressierte, die sich mit den dunklen Kapiteln der deutschen Vergangenheit auseinandersetzen möchten. Eine Geschichte über Mut, Hoffnung und die unerschütterliche Kraft des menschlichen Geistes.
Gliederung:
A: Grundgedanke des Romans; Hinweis auf die Bedeutung Gregors
B: Charakteristik Gregors
I. Äußere Merkmale
1. Herkunft, Familie und Beruf
a) Absolvent der Lenin-Akademie
b) KPD-Instrukteur
c) Einfache Verhältnisse
2. körperliche Merkmale
a) jung
b) durchschnittlich
3. Erscheinungsbild
a) einfache Sprache
b) unauffällig
II. Persönlichkeitsmerkmale
1. Charaktereigenschaften
a) interpretierend
b) vorsichtig
c) selbstkritisch
d) ehrlich
e) Menschenkenntnis
f) Hilfsbereit
2. Geisteshaltung
a) atheistisch
b) kommunistisch
c) rationaldenkend
3. Verhältnis zum Lesenden Klosterschüler
C: Gregor durchläuft einen Wandlungsprozesss: Er erkennt ein Leben ohne Aufträge; Entfremdung von der Partei
Der 1957 erschienene Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ von Alfred Andersch spielt im Jahr 1937, in dem sechs Gestalten zufällig im kleinen Fischerdorf Rerik an der Ostsee zusammentreffen. Sie unterscheiden sich in ihrer Herkunft und sozialer Provenienz, haben aber das Streben und die Sehnsucht nach Freiheit, das jeder der Protagonisten individuell artikuliert, als oberste Priorität. Im Gegensatz zu vielen anderen Werken der Nachkriegsliteratur in Deutschland, bildet das nationalsozialistische Regime hier nur den Hintergrund. Im Vordergrund des psychologisch komplex gestalteten Romans steht die Art und Weise, wie jede Figur ihre Freiheit erlangt. Eine ausschlaggebende Bedeutung dabei hat Gregor, der die Isolation der übrigen Figuren aufhebt und ihnen zur individuellen Freiheit verhilft.
Der Mann, der Gregor genannt wird, da es so in seinem „falschen Pass“(127) steht, der aber eigentlich keinen Namen hat(54), hat die Lenin-Akademie in Moskau besucht, wo er zusammen mit seiner Freundin Franziska dialektischen Materialismus gelernt hat(113). Während dieser Zeit nimmt er an einem Manöver der kommunistischen Partei teil, bei den er sich zum ersten Mal von der Partei entfremdet. Gregor arbeitet als Instrukteur und möchte den Auftrag in Rerik als seinen letzten Instrukteurauftrag vollenden(22), bevor er desertiert(50). Er stammt aus einfachen Verhältnissen in Berlin, wo er „organisatorische Verdienste“(24) erlangte. Seine soziale Abstammung wird erst deutlich, als sich Judith mit dem evangelischen Pfarrer Helander in der Georgenkirche in der „Sprache ihrer Kreise“(116)unterhält. Gregor selbst „ gehöre jedenfalls nicht dazu, nicht zu diesem tadellosen Edelmann Gottes und nicht zu dieser süßen Bourgeoisen“(116). Seine körperlichen Merkmale erfährt der Leser durch Judiths Beschreibungen. Gregor besitzt ein „mageres, helles, unauffälliges Gesicht“(109), das sowohl einem Automonteur als auch einem Laboranten gehören könnte(108). Weiterhin beschreibt sie sein Gesicht als Gesicht mit einem „eingetragenen Leidenszug“(110), und als eines, das „Schläue, Tempo, Schnelligkeit und Intelligenz“(110) verkörpert. Der Fischer Knudsen beschreibt ihn mit Brägevoldts Worten: „grauer Anzug, jung, glatte schwarze Haare, ein bißchen unter mittelgroß, Fahrradklammern an den Hosen“(45).
Typisch für seine gesellschaftliche Herkunft spricht Gregor meistens einfache Sprache, obwohl Knudsen ihn als guten Redner einstuft(54). Über Knudsen denkt er, dass er einfach die „Schnauze“ voll habe(49). Auch beim Gespräch zwischen Judith und Helander benutzt er diesen Sprachstil: „Himmeldonnerwetter [...], warum mache ich die Drecksarbeit?“(116) Seine weitere Erscheinung beschreibt Judith als hauptsächlich unauffällig(110). Auf seinem Weg nach Rerik deutet er die Alleen, die er entlang fährt in interpretierender Sichtweise. Es war eine „offen sich darbietende Konstruktion aus hellen Stangen, von denen mattgrüne Fahnen unterm grauen Himmel regungslos wehten, bis sie sich in der Perspektive zu einer Wand aus flaschenglasigem Grün zusammenschlossen“(7f.). Außerdem ist Gregor ein Mensch, der erst dann eine Handlung durchführt, wenn er alles gut geplant hat. So möchte er sich von Knudsen vor der Aktion „Lesender Klosterschüler“ erst versichern lassen, ob der Junge, der dabei eine tragende Rolle spielt, zuverlässig sei (86), was dieser nicht sicher beweisen kann. Als er jedoch Knudsens Plan vollständig kennt, sagt er beruhigt zu ihm: „Das hast du gut geplant“(87). Da er alles genau hinterfragt, ist er auch sehr kritisch mit sich selbst. Gregor stellt daher seine ganze vom Kommunismus geprägte Vergangenheit in Frage. Judith gegenüber gesteht er sogar, dass er alles falsch gemacht habe(127). Typisch dafür ist auch seine Aussage am Schluss des Romans, nämlich dass alles nun geprüft werden müsse(144). Wegen seiner selbstkritischen Einstellung ist Gregor auch sehr ehrlich den anderen Protagonisten gegenüber. Im Gespräch mit Knudsen in der Kirche gibt er seine Absichten zu fliehen offen zu, da er zwischen sich und Knudsen keinen Unterschied findet(50). Beim Dialog mit Judith gesteht er, dass er es bedauert, sie nicht geküßt zu haben(127).
Eine weitere Eigenschaft Gregors ist seine Menschenkenntnis, für die er schon von den Genossen gelobt worden ist. Als er Judith das erste Mal sieht, merkt er sofort, dass sie eine Ausgestoßene sei mit einem fremdartigen Rassegesicht(63).
Weiterhin bemerkte er an ihr auch, dass sie ein Stadtmädchen sei, das etwas erleben wolle(83). Auch ist Gregor sehr hilfsbereit. Er beschließt, sowohl dem Pfarrer Helander zu helfen, den Lesenden Klosterschüler nach Skillingen in Schweden zu bringen, als auch der Jüdin Judith um ins Ausland zu gelangen, obwohl er in sich Zweifel hat, da er seiner Freundin Franziska nicht hatte helfen können(114). Gregor hilft dem Pfarrer selbst beim Gehen(118), da er aufgrund seiner entzündeten Wunde am Beinstumpf starke Schmerzen verspürt.
Gregor ist, obwohl er die Plastik des „Lesenden Klosterschülers“, das einzige Heiligtum der Kirche in Rerik, rettet, eigentlich atheistischer Gesinnung. Er beginnt mit Helander eine Diskussion über seine Einstellung zur Bibel, da er sich nur an sie erinnert, wenn er es brauchen kann(54). Er geht sogar soweit und beschreibt sich als Nihilist, da er an nichts glaubt(127), weder an die Partei, noch an Gott. Im Gegensatz dazu, betet er darum, dass Knudsen ihm helfe(68). Als jedoch bei der Überfahrt im Ruderboot das Licht des Polizeibootes erlischt und sie dadurch entkommen können, setzt er sich mit der Existenz Gottes auseinander, da ihm die Kausalität Gottes realistischer erscheint als die Kausalität der Natur, wie er sie von der Partei kennt(131). Gregor, der zunächst als KPD-Funktionär fungiert, entfremdet sich mit fortlaufender Handlung immer mehr von den Idealen der Partei, da die seine Freundin verschleppt haben(113) und weil die Partei kalt ist und man seine Liebe auslöschen muss(114). Außerdem ist er auf der Flucht vor den Anderen und vor deren Fahnen(40).
Gregor, der lernt, ohne Aufträge zu leben, ist außerdem ein sehr rationaldenkender Mensch, der seinen Geist über alles andere stellt. Er widersteht sogar der Verführung durch Judith, die ihn küssen möchte. Gregor ärgert es sogar, dass er sich beinahe darauf eingelassen hätte, da er glaubt, sich eines Vorteils beraubt zu haben(121). Außerdem gibt er sich nicht damit zufrieden, den Zwischenfall mit der Zollpolizei als Zufall zu bewerten. Er hinterfragt dies nach Gründen, da er aus seiner kommunistischen Vergangenheit Zufälle nicht kennt; denn im Dogma der Partei gibt es keine Zufälle(130f.).
Die entscheidendste Bedeutung bei Gregors Freiheitsstreben trägt die Holzplastik des „Lesenden Klosterschülers“ von Barlach. Als er ihn das erste Mal in der Georgenkirche sieht, deutet er die Körperhaltung als Spiegelbild seiner Zeit an der Lenin-Akademie in Moskau und identifiziert er mit ihm die Kommunisten, indem er sagt: „Er ist wir“(43). Daraufhin merkt er, dass die Plastik ganz anders ist, da er „einfach“ und „kritisch“ liest(43). Gregor empfindet auch dem Lesenden Klosterschüler gegenüber, da dieser aufstehen kann, um etwas anderes zu tun(43). Als er erfährt, dass die Statue vor den Anderen weggebracht werden muss und Knudsen die einzige Option dazu ist, gibt er dies als Parteibefehl aus, macht es aber zu seiner eigenen Sache, der Aktion „Lesender Klosterschüler“. Kurz vor der eigentlichen Rettungsaktion identifiziert sich Gregor selbst mit dem Klosterschüler, der ebenso wenig wie er zu Judith und Helander gehört(116). Als Knudsen ihm anbietet, ihn mit nach Schweden zu fahren, lehnt er ab, da er genauso wie der Klosterschüler alleine gehen möchte und „aufstehen und fortgehen“ will(137). Für die Rettung der Plastik würde Gregor aber alles geben. Im Notfall will er ihn ins Wasser werfen, damit die Anderen ihn nicht bekommen, da der „Genosse Klosterschüler ein politischer Fall“(129) ist, und er zwar nicht mehr Kommunist, aber weiterhin gegen die Anderen ist.
Während der Handlung durchläuft Gregor einen deutlichen Wandlungsprozess. Zu Beginn ist er ein einfacher KPD-Instrukteur, der vor den Anderen fliehen will. Durch die Begegnung mit dem Klosterschüler erfährt er von der Möglichkeit eines Lebens ohne Aufträge. Die Liebe zu Judith bewirkt, dass er eigenständig denkt und auch handelt, denn er befiehlt Knudsen aus eigenem Antrieb die Rettung beider Protagonisten. Um Judith zu retten, schlägt er sich sogar mit dem Dorschfischer(139). Dies alles ist ausschlaggebend für seine Entfremdung von der Partei. Somit findet Gregor seine individuelle Freiheit, ohne Deutschland zu verlassen.
(By Benjamin Schnock)
Bewertung:
„Benjamin, Du hast die Figur des Gregors eingehend analysiert! Mir gefällt vor allem die Textnähe Deiner Charakteristik, wobei Du stets die richtigen Textstellen zitierst bzw. paraphrasierst. Deine Interpretation zeugt von tiefem Textverständnis. Nur an einer Stelle hast du den Text missverstanden. Du schreibstäußerst flüssig, Unsicherheiten treten nur vereinzelt auf. Du drückst dich gewandt und präzise aus. Deshalbnoch sehr gut!“
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes über Alfred Anderschs Roman "Sansibar oder der letzte Grund"?
Der Text analysiert die Figur Gregor in Alfred Anderschs Roman "Sansibar oder der letzte Grund". Der Fokus liegt auf seiner Charakterisierung, seinem Wandlungsprozess und seiner Suche nach Freiheit, wobei er sich von den Idealen der kommunistischen Partei entfremdet.
Wer ist Gregor und was sind seine wichtigsten Eigenschaften?
Gregor ist ein ehemaliger KPD-Instrukteur, der die Lenin-Akademie besucht hat. Er ist vorsichtig, selbstkritisch, ehrlich und besitzt Menschenkenntnis. Ursprünglich atheistisch und kommunistisch, durchläuft er einen Wandlungsprozess und hinterfragt seine Vergangenheit. Seine äußeren Merkmale werden als unauffällig beschrieben, aber sein Gesicht zeigt Schläue und Intelligenz.
Welche Rolle spielt der "Lesende Klosterschüler" in Gregors Entwicklung?
Die Holzplastik des "Lesenden Klosterschülers" von Barlach ist für Gregor von entscheidender Bedeutung. Er identifiziert sich mit der Figur und sieht in ihr ein Spiegelbild seiner Zeit an der Lenin-Akademie. Die Statue symbolisiert für ihn die Möglichkeit eines Lebens ohne Aufträge und trägt wesentlich zu seiner Entfremdung von der Partei bei.
Wie verändert sich Gregor im Laufe der Handlung?
Gregor beginnt als KPD-Instrukteur, der vor den "Anderen" fliehen will. Durch die Begegnung mit dem "Lesenden Klosterschüler" und die Beziehung zu Judith entwickelt er ein eigenständiges Denken und Handeln. Er lernt, ohne Aufträge zu leben, und entfremdet sich von der Partei, wodurch er seine individuelle Freiheit findet.
Was sind Gregors soziale Herkunft und Sprache?
Gregor stammt aus einfachen Verhältnissen in Berlin und spricht meist einfache Sprache. Seine soziale Abstammung wird deutlich, als er sich von der "Sprache" der höheren Kreise (Judith und Helander) distanziert.
Was ist Gregors Verhältnis zur Religion?
Obwohl Gregor sich als Atheist und Nihilist bezeichnet, setzt er sich im Laufe der Handlung mit der Existenz Gottes auseinander, insbesondere nachdem er und die anderen Protagonisten einer gefährlichen Situation entkommen sind.
- Quote paper
- Ben Schnock (Author), 2000, Andersch, Alfred - Sansibar oder der letzte Grund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95718