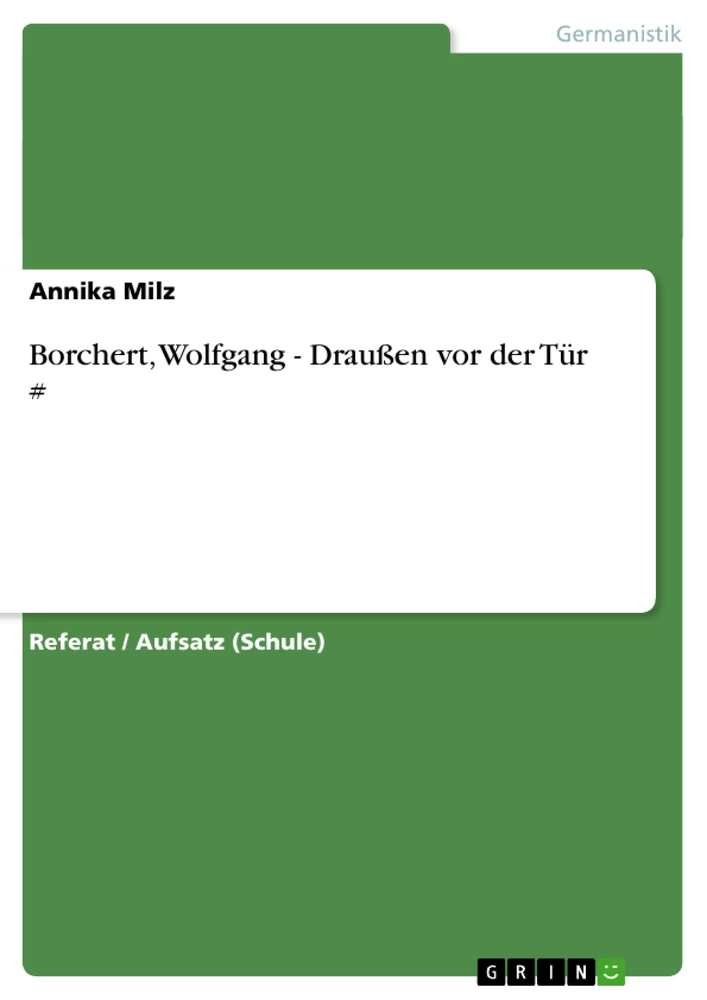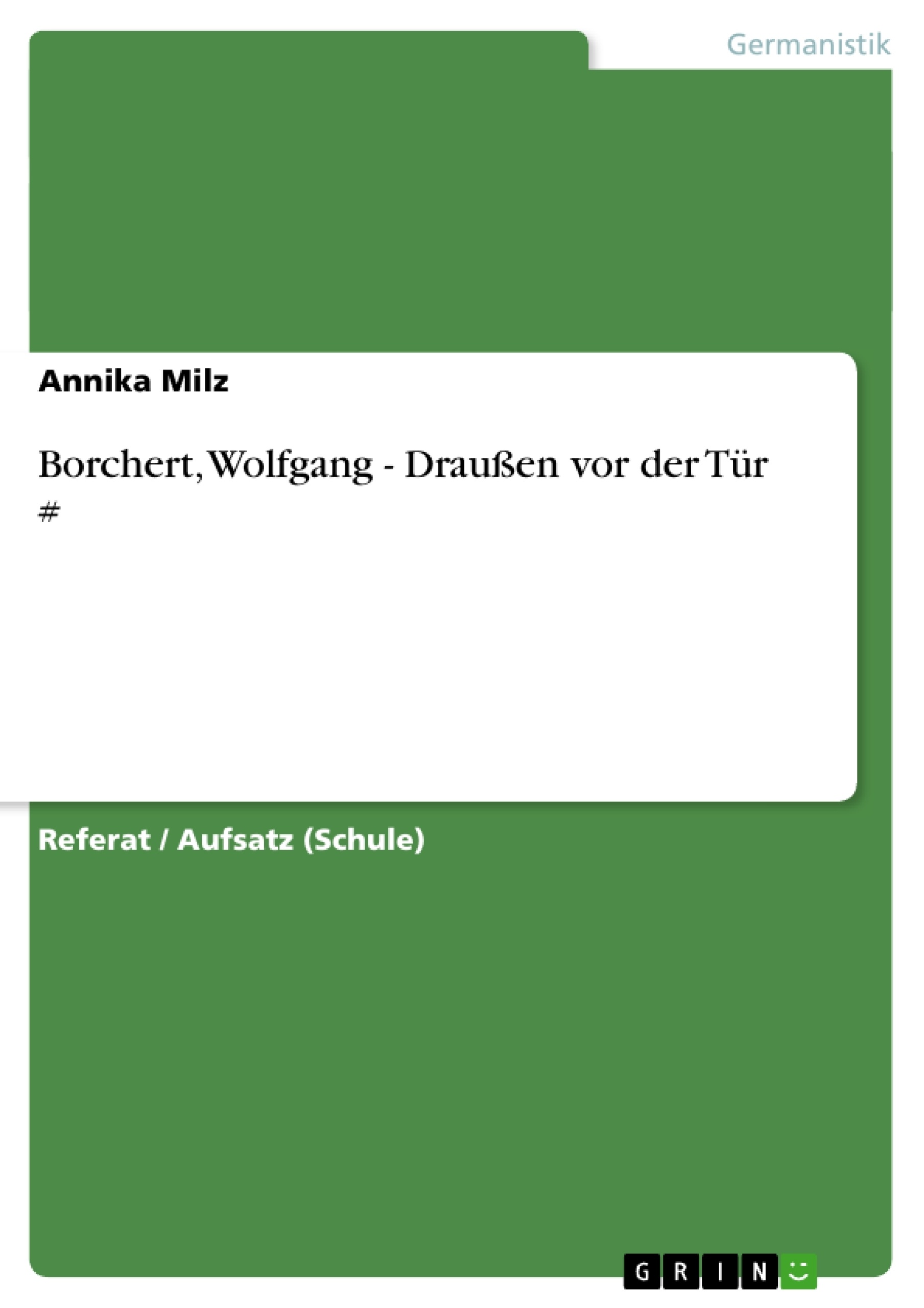Was bedeutet es, nach dem Krieg nach Hause zu kommen, nur um festzustellen, dass es kein Zuhause mehr gibt? Wolfgang Borcherts erschütterndes Drama Draußen vor der Tür katapultiert uns in das zerstörte Deutschland der Nachkriegszeit, wo Beckmann, ein aus sibirischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrter Soldat, sich in einer Welt wiederfindet, die ihn nicht mehr aufnehmen will. Seine Frau hat einen anderen Mann, seine Eltern sind tot, und die Gesellschaft ist taub für die Schrecken, die er erlebt hat. Verzweifelt sucht er nach Sinn und Verantwortlichkeit für das erlittene Trauma, konfrontiert seinen ehemaligen Oberst mit dem Tod seiner Kameraden und fleht einen Kabarettdirektor an, die Wahrheit des Krieges zu verbreiten, doch er stößt überall auf Ablehnung und Gleichgültigkeit. Begleitet von seinem Alter Ego, dem Anderen, kämpft Beckmann mit Schuldgefühlen, Hoffnungslosigkeit und der Frage nach der Existenz Gottes in einer Welt, die von Leid und Zerstörung gezeichnet ist. Draußen vor der Tür ist mehr als nur ein Antikriegsstück; es ist eine eindringliche Auseinandersetzung mit der menschlichen Psyche, der Last der Verantwortung und der Suche nach Identität in einer Welt, die sich im Umbruch befindet. Borchert fängt die Sprachlosigkeit und das Entsetzen einer ganzen Generation ein, die mit den Traumata des Zweiten Weltkriegs ringt, und stellt dabei unbequeme Fragen nach Schuld, Vergebung und der Möglichkeit eines Neuanfangs. Mit seiner eindringlichen Sprache und seinen unvergesslichen Charakteren ist dieses Werk der Trümmerliteratur ein zeitloses Mahnmal gegen die Grausamkeit des Krieges und eine ergreifende Darstellung der menschlichen Fähigkeit zu leiden und zu überleben. Erleben Sie Beckmanns verzweifelten Kampf, einen Platz in einer Welt zu finden, die ihn vergessen hat, und stellen Sie sich der Frage: Gibt es nach dem Krieg überhaupt noch eine Tür, die sich öffnet, oder bleiben wir für immer draußen vor der Tür stehen? Tauchen Sie ein in dieses erschütternde Drama über Kriegsheimkehrer, Schuld und die Suche nach Sinn in einer zerstörten Welt.
1. Genaue bibliographische Angaben des gewählten Titels
Borchert, Wolfgang
Draußen vor der Tür
und ausgewählte Erzählungen
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1956
2. Skizzierung des im Buch dargestellten Themas
Ein Soldat kehrt nach dem Krieg heim, findet dort aber kein Zuhause mehr vor.
3. Inhaltsangabe
Das Drama Draußen vor der Tür wurde von Wolfgang Borchert verfasst. Die Handlung ereignet sich unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Hamburg. Die Hauptfigur des Dramas ist der ehemalige Soldat Beckmann, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat.
Beckmann kehrt mit steifem Knie und grotesker Gasmaskenbrille aus sibirischer Kriegsgefangenschaft in seine Heimatstadt Hamburg zurück, findet bei seiner Frau aber kein Zuhause mehr, denn ein anderer Mann hat seinen Platz eingenommen. Daraufhin stürzt sich Beckmann in die Elbe, die ihn jedoch wieder ausspuckt.
Ein Mädchen (junge Frau) findet ihn und nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Doch plötzlich steht ihr verschollener Mann einbeinig und auf Krücken vor der Tür.
Beckmann verlässt das Mädchen überstürzt und besucht seinen ehemaligen Oberst. Er will ihm die Verantwortung für einen Spähtrupp zurückgeben, die der Oberst ihm im Krieg übertrug. Von diesem Spähtrupp starben elf Männer und Beckmann gibt sich die Schuld an ihrem Tod. Aber der Oberst hält ihn für verrückt und lacht ihn aus.
Ein Kabarettdirektor, bei dem sich Beckmann mit traurigen Liedern über den Krieg Arbeit suchen will, lehnt ihn ab, weil die Wahrheit über den Krieg keinen mehr interessiert.
Beckmann erinnert sich an seine Eltern und will sie besuchen. Es öffnet ihm jedoch eine Frau Kramer die Tür und erzählt ihm, dass seine Eltern sich umgebracht haben.
Beckmann verliert allen Lebenswillen und legt sich zum Sterben auf die Straße. Er schlä ft ein und begegnet im Traum Gott, dem Tod, dem Oberst, dem Direktor, Frau Kramer und dem Mädchen. Er beschuldigt sie als seine Mörder, denn alle außer dem Mädchen wollen ihn auf der Straße liegen und sterben lassen.
Schließlich kommt der Einbeinige und fordert von Beckmann Rechenschaft. Er ist in die Elbe gegangen, weil er sich durch Beckmann ersetzt sah. So ist der ermordete Beckmann ebenfalls zum Mörder geworden.
Beckmann wacht auf
4. Personenverzeichnis und Charakterisierung
Die Personen sind:
- BECKMANN, der Heimkehrer;
- die ELBE, die ihn ans Ufer zurück spuckt;
- der ANDERE, der Beckmann immer begleitet;
- das MÄDCHEN, das Beckmann aufnehmen will;
- der EINBEINIGE, der sich durch Beckmann ersetzt sieht;
- der OBERST, der Beckmann für einen Komiker hält;
- die MUTTER, die Frau des Oberst;
- die TOCHTER des Oberst;
- sein SCHWIEGERSOHN;
- der KABARETTDIREKTOR, der die Wahrheit über den Krieg nicht hören will;
- FRAU KRAMER, die neue Besitzerin der ehemaligen Wohnung von Beckmanns Eltern;
- GOTT alias der ALTE MANN, an den keiner mehr glaubt;
- der TOD alias der BEERDIGUNGSUNTERNEHMER und der STRAßENFEGER, der übersättigt von all den Toten ist.
Charakterisierung:
Nach drei Jahren Kriegsgefangenschaft in Sibirien kehrt der 25jährige Beckmann, die Hauptfigur des Dramas, in seinen Heimatort Hamburg zurück.
Er hat ein steifes Knie und bietet mit seiner Gasmaskenbrille, seinem alten Mantel und seiner „komischen Frisur“[1], diesen „kurzen kleinen Borsten“[1], einen grotesken Anblick. Er selbst bezeichnet sich als ein Gespenst, „Eins von gestern, das heute keiner mehr sehen will. Ein Gespenst aus dem Krieg, für den Frieden provisorisch repariert.“[1]. Das Mädchen, das ihn aufnehmen will, nennt seine Stimme „hoffnungslos traurig“[2], „So grau und vollkommen trostlos“[2].
So traurig wie sein Äußeres fühlt sich Beckmann auch im Inneren. Er hat sich selbst und seine Hoffnung aufgegeben und allen Lebensmut verloren. Er ist ein im Selbstmitleid versunkener Pessimist, der das Gefühl hat, dass es immer nur rückwärts und nicht vorwärts geht. Beckmann denkt, dass es für ihn keine offenen Türen mehr gibt. Nach jeder Enttäuschung will er sich in die Elbe stürzen, um seinem Leben ein Ende zu machen, denn er glaubt, dass nur der Tod eine letzte Tür für ihn offen hält.
Beckmann hat im Zweiten Weltkrieg als Unteroffizier gedient. Damals übertrug ihm der Oberst die Verantwortung für einen Spähtrupp, von dem elf Männer bei einem Erkundungsgang getötet wurden.
Beckmann sieht sich in verschiedenen Situationen mit verdrängten Schuldgefühlen konfrontiert. Er fühlt sich schuldig am Tod der elf Männer und will die Verantwortung, die er einst für sie übernahm, an den Oberst zurückgeben, damit er keine Alpträume mehr hat und endlich schlafen kann. Doch sein naiver Versuch, auf diesem Wege Seelenruhe zu finden, schlägt fehl, denn der Oberst hält alles für einen Witz. Am Ende beschuldigt Beckmann den Oberst, ihn in den Tod gelacht zu haben. Beckmann hat den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Er findet es unfassbar, dass niemand nach all den Toten des Krieges fragt, dass es niemanden zu kümmern scheint, nicht einmal Gott. Er kann die Vergangenheit und den Krieg nicht vergessen und stößt damit überall auf Unverständnis. Er fragt und klagt an, bekommt aber keine zufriedenstellende Antwort.
Beckmann repräsentiert nicht nur den Heimkehrer, sondern auch einen vereinsamten, isolierten Menschen, der auf der Suche nach Antworten und einem Sinn ist.
Begleitet auf den Stationen seines Lebens wird Beckmann von dem Anderen, der ihm in entscheidenden Phasen immer wieder neuen Lebensmut gibt. Der Andere treibt ihn an, er verkörpert Beckmanns lebensbejahende, aktivere Seite, sein optimistisches Alter Ego.
Der Andere beschreibt sich selbst als den, „der immer da ist“[3], den „Jasager“[3], den „Antworter. Der antreibt, wenn du müde bist.“[3]. Er sagt, er sei „der Optimist, der an den Bösen das Gute sieht und die Lampen in der finstersten Finsternis.“[3]. Aber selbst der Andere verschwindet am Schluss und lässt Beckmann einsam zurück.
5. Aufbau und Form des Werkes, Sprachliche Mittel
Das Drama Draußen vor der Tür ist in ein Vorspiel, einen Traum und fünf Szenen gegliedert. Das Vorspiel, in dem Gott, in der Gestalt eines alten Mannes, und der Tod, dargestellt als Beerdigungsunternehmer, ein Gespräch führen, ähnelt einem Prolog. Auf das Vorspiel folgt ein Traum, in dem sich Beckmann in die Elbe stürzt, sie ihn aber ans Ufer zurückwirft. In dem Stück ist kein klarer Handlungsvorgang zu erkennen. Die fünf Szenen treiben keine Handlung vorwärts. In jeder Szene findet sich die Hauptfigur draußen vor der Tür wieder, so dass das Draußen mit jeder Szene gesteigert und verstärkt wird.
Draußen vor der Tür besitzt keinen dramatischen Aufbau im alten Sinne des Wortes Drama. Borchert selbst nannte es ein „Stück“.
Ein wichtiges sprachliches Mittel dieses Dramas ist der Monolog der Hauptfigur. Er ermöglicht es den Zuschauern bzw. dem Leser ins Innere der Person hineinzuschauen und die Gefühle Beckmanns zu verstehen. Außerdem werden zwischen Beckmann und dem Anderen häufig lange Dialoge geführt, die man als inneren Monolog bezeichnen kann, wenn man den Anderen als einen Teil der Hauptfigur deutet.
Borchert benutzt in seinem Drama das Mittel der Fragestellung, um die Hilflosigkeit und das Nichtbegreifen der Hauptperson darzustellen. Er bedient sich häufiger Wiederholungen ganzer Sätze und einzelner Wörter, z.B. „Gibt denn keiner eine Antwort? Gibt keiner Antwort??? Gibt denn keiner,keiner Anwort???"[4], „Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Sohn, wo ist mein Bruder, Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Verlobter, Unteroffizier Beckmann? Unteroffizier Beckmann, wo? wo? wo?“[5]. Durch den Gebrauch einfacher Sprache und vieler kurzer Sätze anstelle eines langen schafft der Autor Lebendigkeit.
6. Historischer Hintergrund und Epoche
Nach dem Krieg wurde Deutschland 1945 von den Siegermächten in vier Besatzungszonen geteilt. Weite Teile des Landes waren zerstört und Millionen Menschen umgekommen. Schwer waren vor allem die materiellen Verluste durch den Boden- und Luftkrieg: Viele Wohngebiete, Produktionsanlagen und Verkehrswege waren zerstört. In Deutschland herrschte Armut und Arbeitslosigkeit.
Nach dem Krieg gab es eine ganze Generation von Heimkehrern, Flüchtlingen und Nichtsesshaften, die es schwierig hatten, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden.
Viele Männer, die als Soldaten gekämpft hatten, gerieten in Kriegsgefangenschaft. Wenn sie nach Jahren nach Hause zurückkehrten, war es oftmals so, dass sie ihre Frauen in den Armen anderer Männer wiederfanden.
Wolfgang Borchert schrieb sein Drama Draußen vor der Tür im Jahre 1947. Es ist ein Werk der Epoche der Nachkriegsliteratur bzw. der Trümmerliteratur. Diese Epoche dauerte bis in die 60er Jahre. Sie war geprägt durch die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit. Merkmale der Nachkriegsliteratur, die auch in diesem Drama deutlich werden, sind zum einen die dargestellte Isolation der Hauptfigur und zum anderen die Tatsache, dass die Personen des Stückes keine Helden sind. Die Hauptfigur Beckmann kann man sogar einen Antihelden nennen.
Borchert verarbeitet in seinem Drama die unmittelbaren Probleme der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart, von denen er ebenfalls betroffen ist. Draußen vor der Tür ist ein sogenanntes Zeit- und Gegenwartsstück. Es ist eine heftige Anklage gegen den Krieg und beschäftigt sich mit dem Leid, der Trauer und dem Ausgestoßensein einer Generation, die sich durch den Krieg verraten fühlt. Borcherts Drama bot den Menschen dieser Generation Identifikationsmöglichkeiten. Die Resonanz auf das Stück war sowohl positiv als auch negativ. Viele Menschen hatten die Hoffnung, dass Draußen vor der Tür nur das erste Stück sei, das dieses Thema problematisierte, und dass noch weitere folgen würden. Aber Wolfgang Borcherts Stück, das zum meistgespielten deutschen Nachkriegsdrama wurde, blieb ein Einzelfall.
7. Der Autor
Wolfgang Borchert wurde am 20. Mai 1921 in Hamburg als Sohn eines Lehrers und einer Schriftstellerin geboren.
Nach dem Besuch einer Oberrealschule wurde er erst Buchhändler, dann Schauspieler an der Landesbühne Ost-Hannover in Lüneburg.
1941 wurde er zum Militärdienst eingezogen und war vom Juni 1941 bis zum April 1945 Soldat. Borcherts Militärzeit war gekennzeichnet durch Einsätze an der Ostfront, Gefängnisaufenthalte und Krankheit. Er verbüßte als Soldat zwei Freiheitsstrafen von zusammen siebzehn Monaten, „wegen Zersetzung der Wehrkraft und wegen Angriffen auf Partei, Staat und Wehrmacht“[6]. 1942 wurde er zum Tode verurteilt, dann aber „zwecks Bewährung“ wieder an die Front geschickt. Während seiner Zeit als Soldat wurde Borchert verwundet und bekam eine Art Gelbsucht, von der er sich nie wieder erholte.
1945 floh er aus französischer Kriegsgefangenschaft und kehrte zurück nach Hamburg. Dort war er vorübergehend als Kabarettist und Regieassistent tätig, bis sich seine Krankheit zu sehr verschlimmerte.
In den nun folgenden zwei Jahren schrieb Borchert ungefähr 29 Geschichten (Erzählungen, Prosastücke etc.), u.a. Die Hundeblume, Die traurigen Geranien, Das ist unser Manifest, Nachts schlafen die Ratten doch, Die Küchenuhr, An diesem Dienstag.
Sein größter Erfolg aber war das Drama Draußen vor der Tür, das Wolfgang Borchert auf seinem Krankenlager innerhalb von acht Tagen im Januar 1947 schrieb. Am 13. Februar 1947 wurde das Drama als Hörspiel im Radio gesendet und machte Borchert praktisch über Nacht berühmt. Im Herbst 1947 wollten ihm Freunde einen Sanatoriumsaufenthalt in der Schweiz ermöglichen, aber der kaum noch transportfähige Borchert musste gleich hinter der Grenze in ein Spital in Basel gebracht werden, wo er am 20. November 1947, einen Tag vor der Uraufführung von Draußen vor der Tür als Bühnenstück, starb.
8. Eigene Wertung des Textes
Wolfgang Borcherts Drama Draußen vor der Tür löste 1947 ein außerordentliches Interesse aus. Die Eindrücke, die dieses Stück hinterließ, waren sehr unterschiedlich.
Die einen behaupteten, dass es „kein Drama“[7], „kein Theaterstück“[7] und „eine Dichtung ohne Hoffnung“[7] sei. Das Stück sei „eine Mischung von sehr starken Szenen und theatralisch hoffnungslosen Wiederholungen“[7], „ein Geschrei von einer Jugend, die in die Arme des Nihilismus getrieben worden ist“[7], „ein autobiographischer Monolog“[7].
Andere sagten: „Borchert schrieb expressiv und mit hemmungsloser Ehrlichkeit“[7]. Er habe mit einer „seltenen Sprachkraft ein Bild der Erlebnisse nicht nur eines einzigen, sondern einer ganzen Generation“[8] geschaffen. Sie waren der Meinung, dass das Stück „der meist triumphierende Theatererfolg dieses Jahres“[7] war, „ein brutal-ergreifendes Stück“[7].
Ich schließe mich dieser positiven Wertung an. Borcherts Stück schildert den Schrecken des Krieges und der Nachkriegszeit sehr treffend und eindringlich. Es macht deutlich, was der Krieg angerichtet hatte und wie seine Folgen noch Jahre danach andauerten. Das Drama hat bei mir eine tiefe Betroffenheit hinterlassen.
Durch die klare Sprache und die ergreifenden, geradezu schreienden Monologe der Hauptfigur kann man gut die Hilflosigkeit und die Hoffnungslosigkeit des Heimkehrers Beckmann nachempfinden. Auch wird der Leser bzw. der Zuschauer durch den nach Anworten suchenden Protagonisten, dazu angeregt, selbst über die gestellten Fragen nachzudenken und sich mit der Nachkriegsthematik auseinanderzusetzen.
Draußen vor der Tür sprach in der Nachkriegszeit Menschen an, denen es ebenso oder ähnlich ergangen war wie der Hauptfigur. Sie konnten sich mit dem Kriegsheimkehrer Beckmann identifizieren.
Ich denke, dass das Stück auch heute noch aktuell ist, denn es werden immer noch Kriege auf dieser Welt geführt. Und wo Krieg herrscht, gibt es auch Menschen, die Schreckliches erlebt und/oder ihre Familie und ihr Zuhause verloren haben. Diese Menschen stehen zum Teil wie Beckmann draußen vor der Tür und suchen nach Antworten.
Ich würde Wolfgang Borcherts Drama allen empfehlen, die sich mit dem Thema Nachkriegszeit auseinandersetzen und die Situation eines Kriegsheimkehrers nachempfinden wollen.
9. Begründete Nennung eines Textauszuges
In dem von mir gewählten Auszug trifft Beckmann in einem Traum den lieben Gott. Dieser ist dargestellt als alter Mann, der um seine Menschenkinder weint, die nicht mehr an ihn glauben. Er behauptet, dass nicht er sich von den Menschen abgewandt habe, sondern sie von ihm. Niemand kümmere sich mehr um ihn.
Beckmann kann nicht verstehen, warum irgend jemand diesen hilflosen Mann, der die Not der Menschen nicht ändert, einen lieben Gott nennt. Er bezeichnet ihn als einen unmodernen Gott, einen Märchenbuchliebergott, der mit den langen Listen der Toten nicht mehr mitkommt. Beckmann ist der Meinung, dass die Menschen einen neuen Gott brauchen, einen Gott für ihre Angst und ihre Not. Dieser Textauszug schildert nachvollziehbar die Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit der Hauptfigur, durch die das gesamte Stück geprägt ist. Auch in der Religion, also bei Gott, findet Beckmann keine Hilfe mehr. Im Gegenteil, er klagt Gott an, fragt wo er war, als sein Sohn und die elf Männer seines Spähtrupps starben. Aber selbst von Gott erhält er keine (zufriedenstellende) Antwort, denn auch dieser steht draußen. „Wir stehen alle draußen. Auch Gott steht draußen, und keiner macht ihm mehr eine Tür auf.“[9]
10. Literaturverzeichnis
BONDY, F. / FRENZEL, I. / KAISER, J. / KOPELEW, L. / SPIEL, H.: Harenberg, Lexikon der Weltliteratur, Autoren - Werke - Begriffe, Bd. 1 u. 2, Dortmund 1994.
BORCHERT, W.: Draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen, Auflage von 1991, Hamburg 1956.
BRAUNECK, M. (HRSG.): Weltliteratur im 20. Jahrhundert, Autorenlexikon, Bd. 1, Hamburg 1981.
BURGESS, G. / TÖTENBERG, M. (HRSG.): Wolfgang Borchert, Allein mit meinem Schatten und dem Mond, Briefe, Gedichte und Dokumente, Originalausgabe, Reinbek 1996.
BURGESS, G. / WINTER, H.-G. (HRSG.): Pack das Leben bei den Haaren, Wolfgang Borchert in neuer Sicht, 1. Auflage, Hamburg 1996.
GULLVAG, K. E.: Der Mann aus den Trümmern, Wolfgang Borchert und seine Dichtung, Originalausgabe, 1. Auflage, Aachen 1997.
KLUGE, M. / RADLER, R. (HRSG.): Hauptwerke der deutschen Literatur, Einzeldarstellungen und Interpretationen, 7. Auflage, München 1974.
KUSENBERG, K. (HRSG.): Wolfgang Borchert in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek 1961.
JENS, W. (HRSG.): Kindlers neues Literatur Lexikon, Studienausgabe, Bd. 2, München 1996.
[...]
[1] Borchert, W., Draußen vor der Tür, Auflage von 1991, Hamburg 1956, S. 17.
[2] Borchert, W., Draußen vor der Tür, Auflage von 1991, Hamburg 1956, S. 15.
[3] Borchert, W., Draußen vor der Tür, Auflage von 1991, Hamburg 1956, S. 13.
[4] Borchert, W., Draußen vor der Tür, Auflage von 1991, Hamburg 1956, S. 54.
[5] Borchert, W., Draußen vor der Tür, Auflage von 1991, Hamburg 1956, S. 26.
[6] Burgess, G., Tötenberg, M., Wolfgang Borchert - Allein mit meinem Schatten und dem Mond, Originalausgabe, Reinbek 1996, S. 19.
[7] Gullvag, K. E., Der Mann aus den Trümmern, Wolfgang Borchert und seine Dichtung, 1. Auflage, Aachen 1997, S. 49.
[8] Gullvag, K. E., Der Mann aus den Trümmern, Wolfgang Borchert und seine Dichtung, 1. Auflage, Aachen 1997, S. 50.
Häufig gestellte Fragen zu Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür"
Was ist der Titel und Autor des Werkes, das in diesem Dokument analysiert wird?
Der Titel des Werkes ist "Draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen" von Wolfgang Borchert. Es wurde 1956 vom Rowohlt Taschenbuch Verlag in Hamburg veröffentlicht.
Was ist das Hauptthema von "Draußen vor der Tür"?
Das Hauptthema des Buches ist die Geschichte eines Soldaten, der nach dem Krieg nach Hause zurückkehrt, aber dort kein Zuhause mehr findet.
Können Sie eine kurze Inhaltsangabe von "Draußen vor der Tür" geben?
Das Drama handelt von Beckmann, einem ehemaligen Soldaten, der aus sibirischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrt. Er findet seine Frau mit einem anderen Mann vor und fühlt sich nirgends mehr zu Hause. Er unternimmt mehrere Versuche, sich wieder in die Gesellschaft einzufügen, scheitert aber an allen Ecken und Enden und begegnet im Traum verschiedenen Personen, die ihn anklagen. Am Ende wacht er auf und bleibt mit seiner Verzweiflung allein zurück.
Wer sind die Hauptfiguren in "Draußen vor der Tür" und wie werden sie charakterisiert?
Zu den Hauptfiguren gehören Beckmann (der Heimkehrer), die Elbe, der Andere, das Mädchen, der Einbeinige, der Oberst, die Mutter des Obersts, die Tochter des Obersts, der Schwiegersohn des Obersts, der Kabarettdirektor, Frau Kramer, Gott (alias der alte Mann) und der Tod (alias der Beerdigungsunternehmer und der Straßenfeger). Beckmann wird als ein verzweifelter und hoffnungsloser Mann dargestellt, der durch den Krieg traumatisiert ist und keinen Platz mehr in der Gesellschaft findet.
Wie ist das Werk "Draußen vor der Tür" aufgebaut und welche sprachlichen Mittel werden verwendet?
Das Drama ist in ein Vorspiel, einen Traum und fünf Szenen gegliedert. Zu den verwendeten sprachlichen Mitteln gehören Monologe, Dialoge, Fragestellungen, Wiederholungen und eine einfache, lebendige Sprache.
In welchen historischen Kontext und in welcher Epoche ist "Draußen vor der Tür" einzuordnen?
"Draußen vor der Tür" ist ein Werk der Nachkriegsliteratur bzw. Trümmerliteratur, entstanden im Jahr 1947. Es spiegelt die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, die Isolation der Hauptfigur und das Fehlen von Helden wider. Es ist ein Zeit- und Gegenwartsstück, das die Probleme der Nachkriegszeit und das Leid der Kriegsheimkehrer thematisiert.
Wer war Wolfgang Borchert?
Wolfgang Borchert war ein deutscher Schriftsteller, der 1921 in Hamburg geboren wurde und 1947 starb. Er erlebte den Zweiten Weltkrieg als Soldat und verarbeitete seine Erfahrungen in seinen Werken, insbesondere in "Draußen vor der Tür".
Wie wird "Draußen vor der Tür" bewertet?
Das Werk löste bei seiner Veröffentlichung unterschiedliche Reaktionen aus. Einige kritisierten es als hoffnungslos und theatralisch, während andere es für seine Ehrlichkeit und Sprachkraft lobten. Die Kritik hebt besonders die schrecklichen Erfahrungen des Krieges und die Nachkriegszeit sehr treffend und eindringlich hervor.
Welchen Textauszug aus "Draußen vor der Tür" wird besonders hervorgehoben und warum?
Hervorgehoben wird der Auszug, in dem Beckmann im Traum Gott begegnet. Dieser wird als alter Mann dargestellt, der um seine verlorenen Menschen weint. Dieser Auszug verdeutlicht die Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit Beckmanns, da er selbst in der Religion keine Hilfe mehr findet.
Welche Literatur wird im Zusammenhang mit "Draußen vor der Tür" erwähnt?
Das Literaturverzeichnis enthält eine Auswahl an Werken über Wolfgang Borchert und "Draußen vor der Tür", darunter Lexika, Briefsammlungen, Interpretationen und Selbstzeugnisse.
- Citar trabajo
- Annika Milz (Autor), 2000, Borchert, Wolfgang - Draußen vor der Tür #, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95701