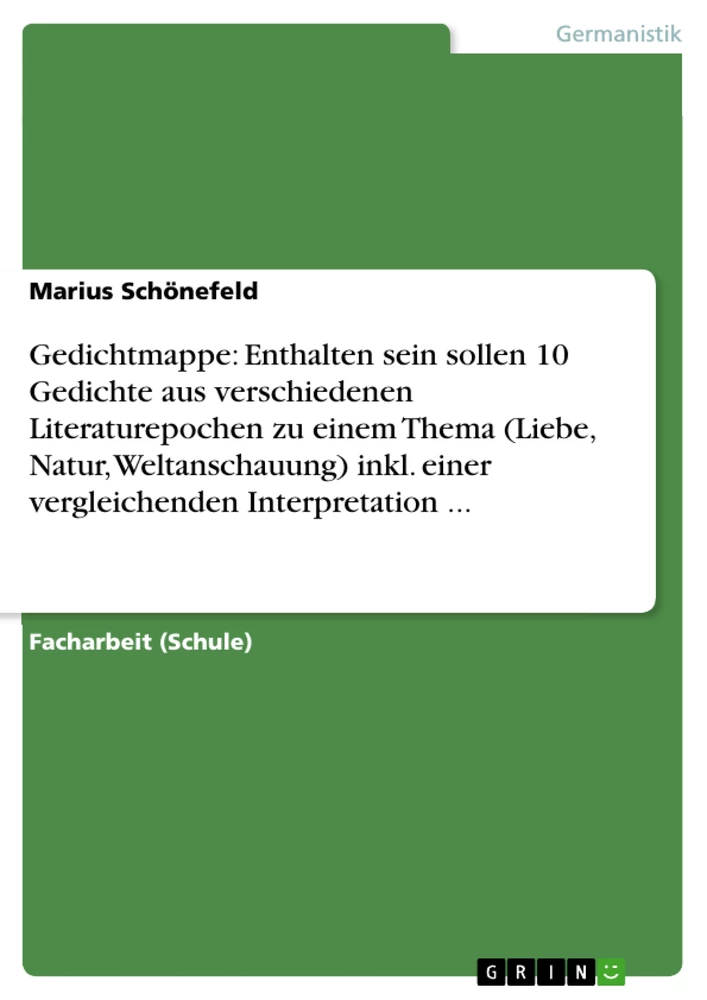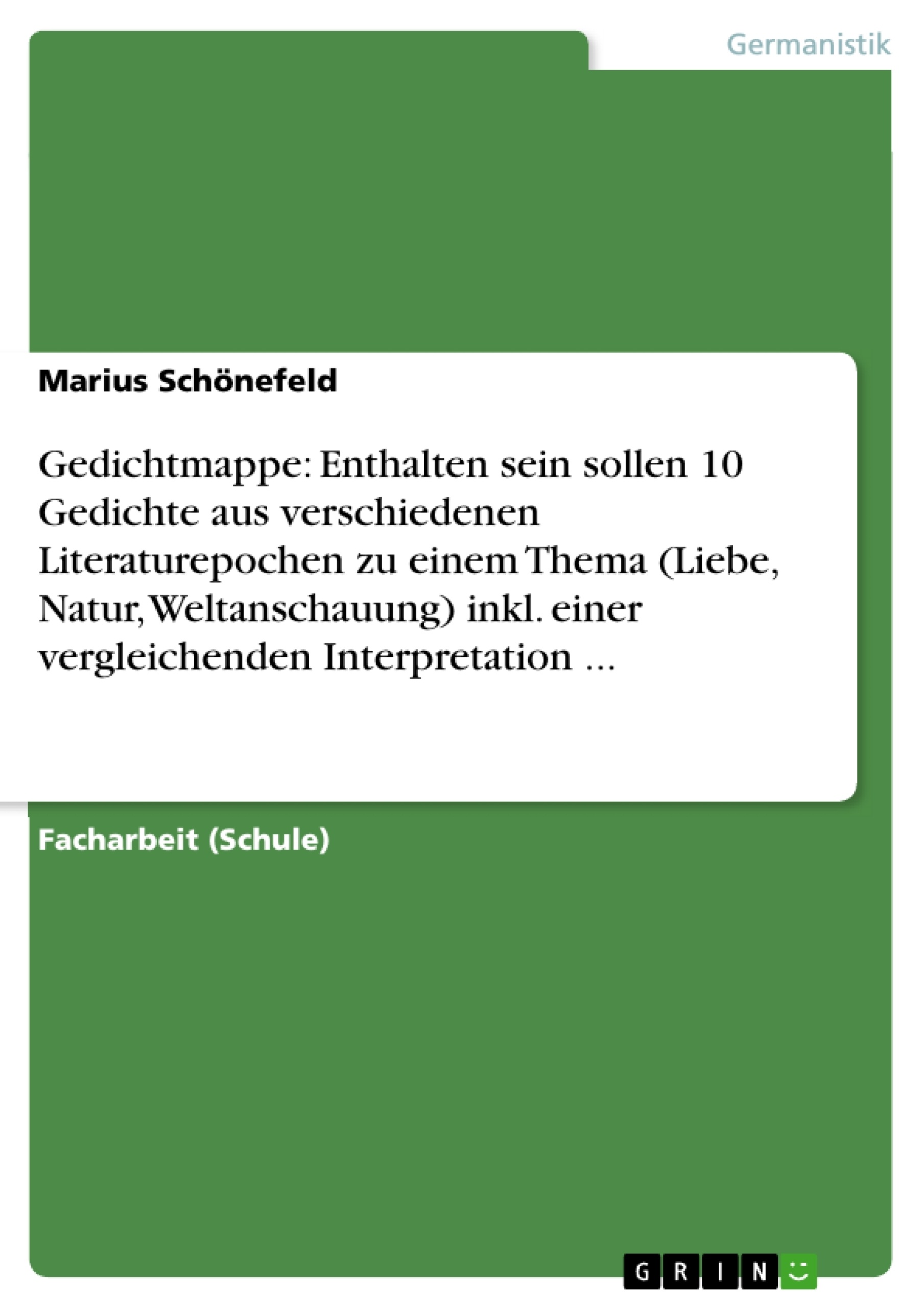Was bedeutet es, wenn die Liebe selbst zum Spiegel einer Epoche wird? Diese einzigartige Sammlung von Gedichten, entstanden aus der Aufgabe, lyrische Werke aus verschiedenen Literaturepochen zu vereinen, entführt den Leser auf eine faszinierende Reise durch die deutsche Geistesgeschichte. Vom prunkvollen Barock, in dem die Dichter noch im Dienste der Fürsten standen und die Welt von religiösen Spannungen und wissenschaftlichen Entdeckungen geprägt war, bis hin zur modernen Literatur nach 1970, die sich mit Familiengeschichten und der Wiedervereinigung auseinandersetzt, offenbart diese Anthologie die vielfältigen Facetten der Liebe im Wandel der Zeit. Entdecken Sie die rationale Auseinandersetzung mit der Liebe in der Aufklärung, die leidenschaftliche Gefühlswelt des Sturm und Drang, die idealisierte Form der Klassik und die sehnsuchtsvolle Verklärung der Romantik. Erleben Sie den Realismus, der die Liebe inmitten gesellschaftlicher Umbrüche verortet, den expressiven Aufschrei gegen Konventionen und die ethischen Ansprüche der Zwischenkriegszeit. Eine vergleichende Interpretation, die die Jahrhunderte in einen spannungsvollen Dialog treten lässt, erhellt nicht nur die Entwicklung der Liebeslyrik, sondern auch die tiefgreifenden Veränderungen in Weltanschauung, Gesellschaft und Kunst. Tauchen Sie ein in die Gefühlswelten von Christian Hofmann von Hofmannswaldau und anderen bedeutenden Dichtern und erleben Sie, wie die Liebe zur Projektionsfläche der jeweiligen Epoche wird. Diese Gedichtmappe ist mehr als nur eine Sammlung; sie ist eine Zeitreise durch die deutsche Literaturgeschichte, die den Leser dazu einlädt, die ewige Kraft der Liebe in all ihren schillernden Facetten neu zu entdecken und zu interpretieren. Lassen Sie sich von der Schönheit und Vielfalt der deutschen Lyrik verzaubern und finden Sie neue Perspektiven auf das vielleicht wichtigste Gefühl der Menschheit – die Liebe. Diese Sammlung bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über verschiedene Literaturepochen, sondern regt auch dazu an, die eigene Vorstellung von Liebe zu hinterfragen und neu zu definieren. Ein Muss für jeden Liebhaber der deutschen Literatur und für alle, die sich von der Kraft der Poesie berühren lassen wollen.
Aufgabe:
- Stellen Sie eine Gedichtmappe zusammen!
Enthalten sein sollen 10 Gedichte aus verschiedenen Literaturepochen zu einem Thema (Liebe, Natur, Weltanschauung)!
- Erstellen Sie eine vergleichende Interpretation unter Bezugnahme der Jahrhunderte!
Barock (1600 - 1720)
Die Umwälzungen im politischen Bereich, die religiösen Spannungen, die Entdeckungen, vor allem in Medizin und Astronomie, wirken sich auch auf das literarische Leben aus. Dichterische Werke werden bis zu dieser Zeit von einer relativ kleinen Gruppe hervorgebracht und aufgenommen, von den städtischen Humanisten und von den Gebildeten aus der Geistlichkeit und dem höheren Adel. Die Autoren leben als Geistliche, Universitätsprofessoren, Ärzte oder Verwaltungsbeamte im Dienst der Fürsten. Sie sind keine freien Schriftsteller, sondern abhängige Lohnempfänger. Nur die Adeligen und sehr vermögende Bürger können sich Bücher leisten. Ein Roman kostet zirka einen Monatslohn eines niedrigen Beamten.
Aufklärung (1720 - 1785)
Die Aufklärung ist eine gesamteuropäische Bewegung, die von Frankreich und England ausgeht, in Mitteleuropa aber erst verspätet aufgenommen wird. Das zentrale Motiv Vernunft meint, dass das ganze menschliche Verhalten geplant und begründet sein soll und als Endzweck das vollkommene Glück der Menschen, das Wohl der Gesellschaft und des Staates garantieren wird. Die menschliche Vernunft könne durch logische Schlüsse (rational) und die Erfahrung der Sinne (empirisch) alle Probleme des Lebens lösen. Die Literatur wird als Instrument eingesetzt, den bürgerlichen Leser aufzuklären und ihn, besonders in der Zeit der Frühaufklärung, zu erziehen. Viele bekannte Dichter schreiben Fabeln, die unterhalten und belehren sollen. Kinder- und Jugendliteratur als eigenständige Literatur entsteht im 18. Jahrhundert deshalb, weil man die Menschen (Kinder) erziehen möchte. In den Jahre 1730/40 zeichnet sich auf dem Buchmarkt ein grundlegender Strukturwandel ab. Das Lesebedürfnis wächst stark an. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entstehen die ersten kommerziellen Leihbibliotheken, die Personen aus dem Bürgertum und aus dem Adel zu ihren Kunden zählen.
Sturm und Drang (1767 - 1785)
Unter dem Begriff „Sturm und Drang“ versteht man eine kurze literarische Bewegung, die ihren Höhepunkt zwischen 1770 und 1785 hat, also in der Zeit kurz vor der Französischen Revolution. Der Name dieser Epoche ist ursprünglich der Titel eines Schauspieles von Friedrich Klinger (1752 - 1831), das zuerst Wirrwarr heißt. Im Mittelpunkt der Sturm-und-Drang-Poetik standen Emotionalität und Spontaneität des – vor allem lyrischen – Ausdrucks. Viele Dichter nutzten die Lied- und Balladenform als Medium einer Ästhetik des Sinnlichen sowie zur Darstellung eines dezidiert subjektiv geprägten, am Pantheismus orientierten Naturgefühls.
Klassik (1786 - 1832)
Bestimmte Epochen bezeichnen man in einzelnen Ländern als „klassisch“ ; meist stehen sie in engem Zusammenhang mit historischen Vorgängen oder in Verbindung mit einer historisch - politischen Persönlichkeit. Eine klassische Periode ist fast immer 2eine Antwort, eine Reaktion auf historisch-politische Zustände: Auf eine chaotische, ungeordnete Zeit folgt eine des relativen Friedens und der Hochblüte der Kultur. Die Weimarer Klassik ist eine Reaktion auf die Französische Revolution, die Goethe und Schiller als chaotisch und unordentlich empfinden. Während andere europäische Nationen schon längst klassische Autoren haben, ist die österreichische und deutsche Klassik erst relativ spät angesiedelt. Die klassischen Autoren in England, Italien, Spanien und Frankreich sind zugleich auch Nationaldichter. In Mitteleuropa kann sich jedoch keine Nationalliteratur herausbilden, weil es eine deutsche Nation erst ab 1871 gibt.
Romantik (1795 - 1830)
Das Adjektiv „romantisch“ wird vieldeutig verwendet. Es heißt vorerst: wie im Roman, im Roman vorkommend, erfunden, wunderbar, phantastisch, irreal, unwahr, lebensfern. Die Vertreter der Spätaufklärung und die Klassiker verwenden es abwertend, für den alten Goethe bedeutet es soviel wie „krank“. Während sich Goethe und Schiller selbst nie als Klassiker verstehen, fühlen sich die Romantiker als Verehrer ihrer Strömung. Sie beginnt parallel zur Klassik und setzt sich mit deren Vorstellungen auseinander. Die Romantik sieht sich aber nicht als Gegenströmung, sondern als Ergänzung. Die Philosophie hat großen Einfluss auf die Dichtung der Romantik. Die Dichter wählen aus den philosophischen Erkenntnissen, was in ihr literarisches und Lebenskonzept passt. Die Romantik schafft einen Freiraum, der es den Frauen ermöglicht, am literarischen Leben teilzunehmen. Das ist zwar bereits in der Zeit der Aufklärung möglich, allerdings müssen die Frauen ihren emanzipatorischen und ästhetischen Anspruch aufgeben.
Realismus (1850 - 1890)
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die Voraussetzungen für ein Masselesepublikum und damit für einen enormen Aufschwung der Literaturproduktion geschaffen: starker Bevölkerungszuwachs, Entstehung industrieller Zentren und Großstädte, drucktechnische Fortschritte, bessere Schulbildung, Lockerung der Zensur. Gegen Ende des Jahrhunderts entwickelt sich die Illustrierte, ein Zeitschriftentyp mit aktueller Bildberichterstattung. Viele Autoren müssen sich, wenn sie von ihren literarischen Arbeiten leben wollen, den Zwängen der Massenproduktion und des literarischen Marktes anpassen und sich dem Geschmack eines breiten Leserpublikums unterwerfen.
Expressionismus (1910 - 1925)
Um etwa 1910 versteht man unter Expressionismus die Art, wie Vincent van Gogh, Henri Matisse und Paul Cezanne ihre Bilder malen. Eine Seite des Expressionismus richtet sich gegen alle Errungenschaften des Naturalismus und Positivismus, eine andere Seite hingegen sieht den Entfremdungsprozess durch arbeitsteilige Produktionsweise auch durchaus positiv. Man hat den Expressionismus manchmal mit dem Sturm und Drang verglichen. Beiden gehen große, historische Umwälzungen voran, ohne direkte politische Wirkung zu erreichen. Die expressionistischen Autoren wachsen in einer Umbruchsituation auf, eine Nation wandelt sich aus agrarischen dominierten zur Industrienation. Sie stammen zumeist aus bürgerlich-intellektuellen Kreisen, sie besuchen Gymnasien und Universitäten. Während der Nazizeit sind die Werke der Expressionisten verboten sie gelten als entartet. Im Mai 1933 werden die Bücher fast aller bedeutenden deutschsprachigen Expressionisten öffentlich verbrannt.
Zwischen den Weltkriegen (1918 - 1933)
In der ersten Republik gibt es wenige politische Dichter, sondern eher Schriftsteller mit einem radikal ethischen Anspruch. Ab 1927 werden Werke geschrieben , die aus verschiedenen Positionen eine „Rückschau“ auf Österreich - Ungarn bieten. Der Ständestaat (1933/34-38) bringt keine eigenständige Literatur hervor. Die Dichtung, die in dieser Zeit gefördert wird, unterscheidet sich von der faschistischen Literatur dadurch, dass sie nicht antisemitisch ist und katholische Standpunkte forciert. Gemeinsam haben die faschistische Literatur und die Literatur des Ständestaates die Feindbilder (Stadt, Intellektualismus, Wurzellosigkeit...) und Vorbilder (ländliches Leben, Bauerntum, Bodenständigkeit..)
Literatur nach 1945
Das literarische Leben unmittelbar nach dem Krieg ist bestimmt durch eher unproblematisches Neben- und Miteinander von Schriftstellern verschiedener Generationen und unterschiedlicher Vergangenheit.
Literatur ab 1970
Die deutsche Literatur stand den frühen achtziger Jahre unter dem Eindruck einer Aufarbeitung von Familiengeschichte. Ein noch früheres Zeugnis dieser Tendenz war Weiss’ Abschied von den Eltern (1961) gewesen. Es ging weiterhin um eine Darstellung der gutbürgerlichen Midlife-Crisis. Man versuchte die Wiederbelebung des Prosagedichts. 1990 erschien der provozierende, im Feuilleton stark rezipierte, Erzählband über Erfahrungen als Jude in Deutschland. Anfang der neunziger Jahre setzte sich auch die deutsche Literatur mit der Wiedervereinigung auseinander.
DU kennst mein treues hertze...
Christian Hofmann von Hofmannswaldau
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kurzanalyse zum Werk:
DU kennst mein treues hertze...
Christian Hofmann von Hofmannswaldau
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
-immer Wechsel von umarmender Reim und Kreuzreim (reine Reime)
-immer Kleinschreibung; außer die Versanfänge
-2 Personen -lyrisches „ich“ (ich, mein, mich, mir)
-andere Person (du, dein, dich, dir)
-Versfuss: Jambus (4-hebig, immer Wechsel von unbetontem und betontem Versende)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument enthält eine Übersicht über verschiedene Literaturepochen, darunter Barock, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Romantik, Realismus, Expressionismus und die Zeit zwischen den Weltkriegen. Es behandelt auch die Literatur nach 1945 und ab 1970. Darüber hinaus enthält es eine kurze Analyse des Gedichts "DU kennst mein treues hertze..." von Christian Hofmann von Hofmannswaldau.
Welche Literaturepochen werden in diesem Dokument behandelt?
Die behandelten Literaturepochen sind Barock (1600-1720), Aufklärung (1720-1785), Sturm und Drang (1767-1785), Klassik (1786-1832), Romantik (1795-1830), Realismus (1850-1890), Expressionismus (1910-1925), die Zeit zwischen den Weltkriegen (1918-1933), Literatur nach 1945 und Literatur ab 1970.
Was sind die Merkmale des Barock (1600-1720)?
Die Umwälzungen im politischen Bereich, religiöse Spannungen und Entdeckungen in Medizin und Astronomie beeinflussen das literarische Leben. Dichter leben oft als Geistliche, Universitätsprofessoren oder Beamte im Dienst der Fürsten und sind keine freien Schriftsteller.
Was sind die Kernthemen der Aufklärung (1720-1785)?
Das zentrale Motiv ist die Vernunft, die menschliches Verhalten planen und begründen soll, um Glück, das Wohl der Gesellschaft und des Staates zu garantieren. Die Literatur wird als Instrument zur Aufklärung und Erziehung des bürgerlichen Lesers eingesetzt.
Was zeichnet den Sturm und Drang (1767-1785) aus?
Emotionalität und Spontaneität des Ausdrucks, besonders in der Lyrik, stehen im Mittelpunkt. Viele Dichter nutzen Lied- und Balladenformen zur Darstellung eines subjektiven Naturgefühls.
Was ist die Weimarer Klassik (1786-1832)?
Die Weimarer Klassik ist eine Reaktion auf die Französische Revolution. Die Autoren suchten nach Harmonie und Ordnung.
Welche Rolle spielt die Romantik (1795-1830)?
Die Romantik sieht sich als Ergänzung zur Klassik und räumt Frauen mehr Möglichkeiten zur Teilnahme am literarischen Leben ein. Philosophie beeinflusst die Dichtung stark.
Wie wird der Realismus (1850-1890) charakterisiert?
Das Lesebedürfnis wächst, und viele Autoren müssen sich den Zwängen des Massenmarktes anpassen. Illustrierte Zeitschriften entstehen.
Was sind die Merkmale des Expressionismus (1910-1925)?
Der Expressionismus richtet sich gegen den Naturalismus und Positivismus, betrachtet aber auch den Entfremdungsprozess positiv. Werke der Expressionisten werden während der Nazizeit verboten.
Wie war die Literatur zwischen den Weltkriegen (1918-1933)?
Es gab wenige politische Dichter, sondern eher Schriftsteller mit radikal ethischem Anspruch. Ab 1927 entstanden Werke, die eine "Rückschau" auf Österreich-Ungarn boten.
Was prägte die Literatur nach 1945?
Das literarische Leben war geprägt von einem Neben- und Miteinander verschiedener Generationen und unterschiedlicher Vergangenheit.
Was sind die Tendenzen der Literatur ab 1970?
Die deutsche Literatur stand unter dem Eindruck einer Aufarbeitung von Familiengeschichte und versuchte die Wiederbelebung des Prosagedichts. Die deutsche Literatur setzte sich auch mit der Wiedervereinigung auseinander.
Welche Analyse wird von dem Gedicht „DU kennst mein treues hertze…“ präsentiert?
Die Analyse beschäftigt sich mit dem Reimschema (Wechsel von umarmendem Reim und Kreuzreim), der Kleinschreibung (außer bei Versanfängen), den beteiligten Personen (lyrisches "ich" und eine angesprochene Person), dem Versfuß (Jambus) und der Falschschreibung von Wörtern.
- Quote paper
- Marius Schönefeld (Author), 1999, Gedichtmappe: Enthalten sein sollen 10 Gedichte aus verschiedenen Literaturepochen zu einem Thema (Liebe, Natur, Weltanschauung) inkl. einer vergleichenden Interpretation ..., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95700