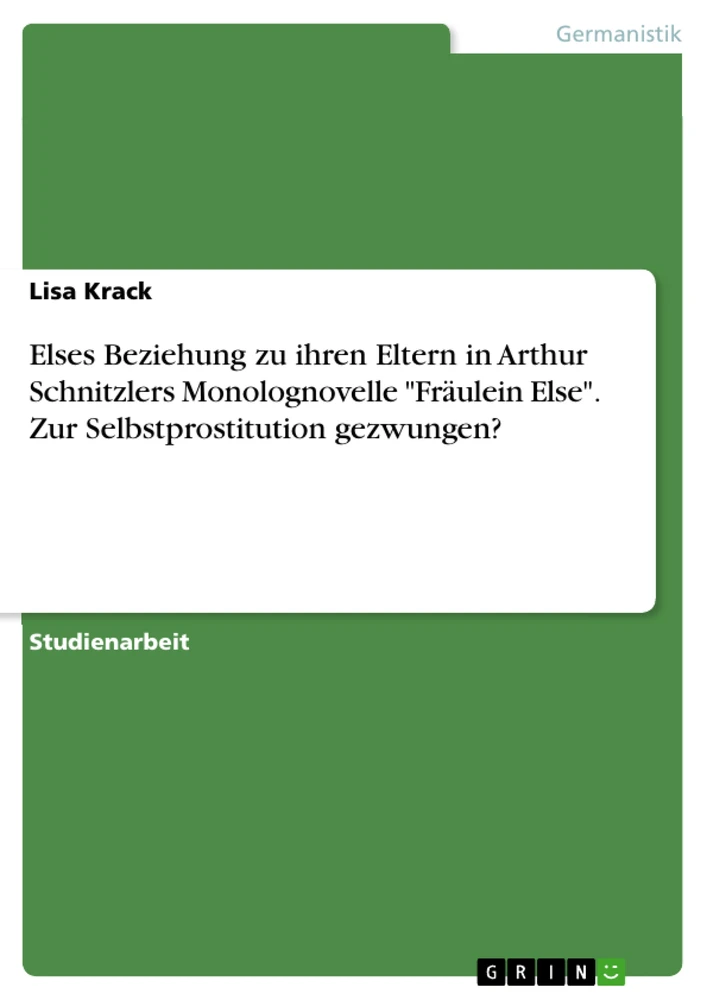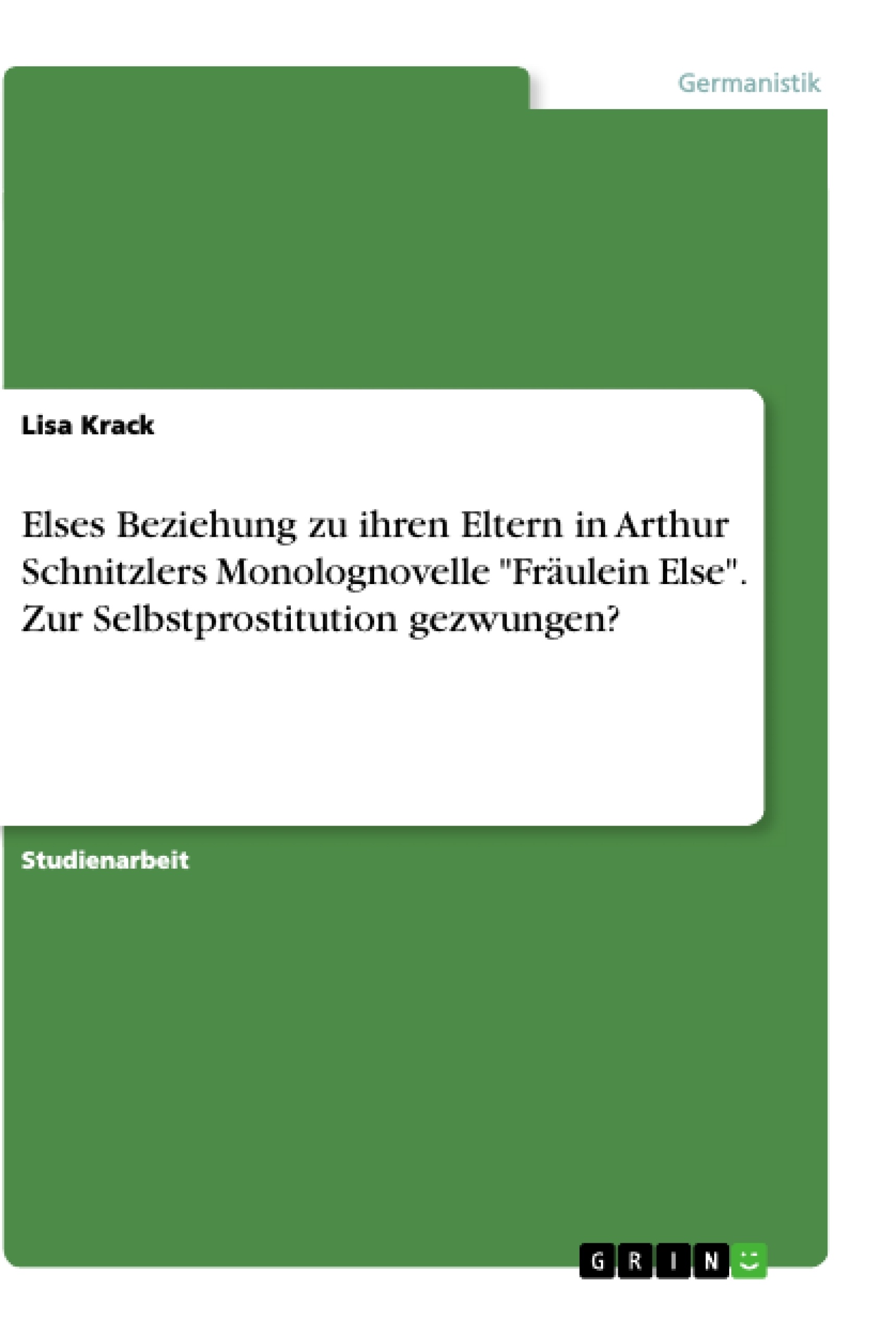Diese Arbeit beschäftigt sich mit Arthur Schnitzlers Monolognovelle "Fräulein Else". Die Untersuchung fokussiert sich auf Elses Beziehung zu ihren Eltern. Aufgrund der Erzählform des inneren Monologs liegt allerdings nur Elses Sicht vor, die für die Interpretation genutzt werden kann. Eine textnahe Ausarbeitung der Erzählung soll Aufschluss über die Ursachen für Elses Identitätsprobleme geben, sowie eine Antwort auf die Frage, ob ihre Eltern sie bewusst zur Selbstprostitution angestiftet haben, ermöglichen. Hierfür sollen einzelne Textstellen zur Unterstützung der Argumente dienen. Der Fokus wird jedoch auf der Vater-Tochter-Beziehung liegen, da diese einerseits tiefgründiger ist als das Verhältnis zur Mutter und ihr andererseits auch in der Forschung bisher eine weitaus größere Beachtung zukam.
In seinen nach der Jahrhundertwende entstandenen Werken beginnt Arthur Schnitzler, sich intensiv mit der Problematik der Frauenrolle in der Gesellschaft und in der Familie auseinanderzusetzen. Hierbei bemüht er sich, indem er die Frau in den Mittelpunkt seiner Erzählung stellt, ohne Euphemismen, die Bedingungen ihres Daseins darzustellen. Die Frauengestalten zeigen die Ungerechtigkeit der patriarchalischen Ordnung auf und entlocken Schnitzler eine menschliche - statt einer rein männlichen - Einschätzung der Frau.
Mit "Fräulein Else" entwirft der Vertreter der Wiener Moderne schließlich das Bild einer jungen Frau, die den Konventionen ihrer Zeit ausgeliefert ist. Anhand ihrer Situation prangert er die Geschlechterordnung der patriarchal-bürgerlichen Wiener Gesellschaft an. Else lebt in einer Zeit, in der eine schöne äußerliche Erscheinung und die Zugehörigkeit zur Gesellschaft die Wichtigkeit eines Menschen definieren. Schnitzler enthüllt in dieser Erzählung, indem er Elses Erziehung zur Ware und den Handel mit ihrem Körper darstellt, den Warencharakter der weiblichen Körperlichkeit sowie die Oberflächlichkeit der höheren Gesellschaftsschichten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung
- Wirkung
- Der innere Monolog
- Die Rolle der Frau in der Wiener Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts
- Elses Rolle in der Gesellschaft
- Die Institution der Ehe im ausgehenden 19. Jahrhundert und in Schnitzlers Fräulein Else
- Elses Beziehung zu ihren Eltern
- Elses Beziehung zu ihrem Vater
- Die These der ödipalen Vater-Tochter-Beziehung
- Die Funktion des inneren Monologs
- Elses Beziehung zu ihrer Mutter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung analysiert die Beziehung zwischen Else und ihren Eltern in Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“. Durch die narrative Form des inneren Monologs liegt ausschließlich Elses Perspektive vor, die zur Interpretation genutzt wird. Die Untersuchung soll die Ursachen für Elses Identitätsprobleme ergründen und die Frage beantworten, ob ihre Eltern sie bewusst zur Selbstprostitution angestiftet haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vater-Tochter-Beziehung, die tiefergründiger ist als das Verhältnis zur Mutter und in der Forschung eine größere Aufmerksamkeit erfuhr.
- Analyse der Vater-Tochter-Beziehung in "Fräulein Else"
- Erforschung der Ursachen für Elses Identitätsprobleme
- Bewertung der Rolle der Eltern bei Elses Selbstprostitution
- Untersuchung der Funktion des inneren Monologs
- Betrachtung der gesellschaftlichen Normen und Geschlechterrollen im ausgehenden 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Schnitzlers Beschäftigung mit der Frauenrolle in der Gesellschaft und Familie im Kontext seiner Werke nach der Jahrhundertwende dar. Sie beleuchtet die Ungerechtigkeit der patriarchalischen Ordnung und Schnitzlers humanistische Sichtweise auf die Frau. Zudem wird der Fokus der Untersuchung auf Elses Beziehung zu ihren Eltern gelegt, wobei insbesondere die Vater-Tochter-Beziehung im Vordergrund steht. Die Bedeutung des inneren Monologs und seine Funktion werden ebenfalls hervorgehoben.
- Entstehung: Dieses Kapitel beleuchtet den Entstehungsprozess der Novelle "Fräulein Else", angefangen von Schnitzlers persönlicher und schriftstellerischer Krise über die Inspiration durch seine Tochter bis hin zur Entwicklung der Kernidee. Es wird außerdem auf Schnitzlers Sicht auf die Novelle und seine Unsicherheit hinsichtlich des Schluss eingegangen.
- Wirkung: Dieses Kapitel widmet sich der Rezeption der Novelle durch die Kritik und das breite Publikum. Es wird die positive Resonanz und die Verbreitung des Werkes hervorgehoben. Auch Schnitzlers Reaktion auf den Vorwurf, eine „versunkene Welt“ aufleben zu lassen, wird behandelt.
- Der innere Monolog: Dieses Kapitel präsentiert die Entwicklung des inneren Monologs als narrative Technik in Schnitzlers Werk, insbesondere im Vergleich zwischen "Lieutenant Gustl" und "Fräulein Else". Die Bedeutung der Technik für den Einblick in Elses Bewusstsein und das Leserlebnis wird erklärt.
- Die Rolle der Frau in der Wiener Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beschreibt die gesellschaftliche Situation in Wien im ausgehenden 19. Jahrhundert, geprägt von einer durch die Börsenkonjunktur bedingten Spekulationssucht. Schnitzlers Positionierung der Novelle im Kontext des spekulativen Börsengeschäfts und die Kritik an den repressiven Moralansprüchen der Gesellschaft gegenüber Frauen werden beleuchtet.
- Elses Rolle in der Gesellschaft: Dieses Kapitel betrachtet Elses Rolle als Tauschobjekt und die Reduktion auf ihre körperliche Erscheinung. Es wird die Bedeutung der Schönheit als gesellschaftliche Tugend und die Selbstvergewisserung Elses hinsichtlich ihrer körperlichen Vorzüge beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Untersuchung sind: Arthur Schnitzler, "Fräulein Else", innerer Monolog, Vater-Tochter-Beziehung, Selbstprostitution, gesellschaftliche Normen, Geschlechterrollen, Wiener Gesellschaft, ausgehendes 19. Jahrhundert, Identität, Erziehung, Bildung, Ödipuskomplex, Sexualität.
- Quote paper
- Lisa Krack (Author), 2020, Elses Beziehung zu ihren Eltern in Arthur Schnitzlers Monolognovelle "Fräulein Else". Zur Selbstprostitution gezwungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957009