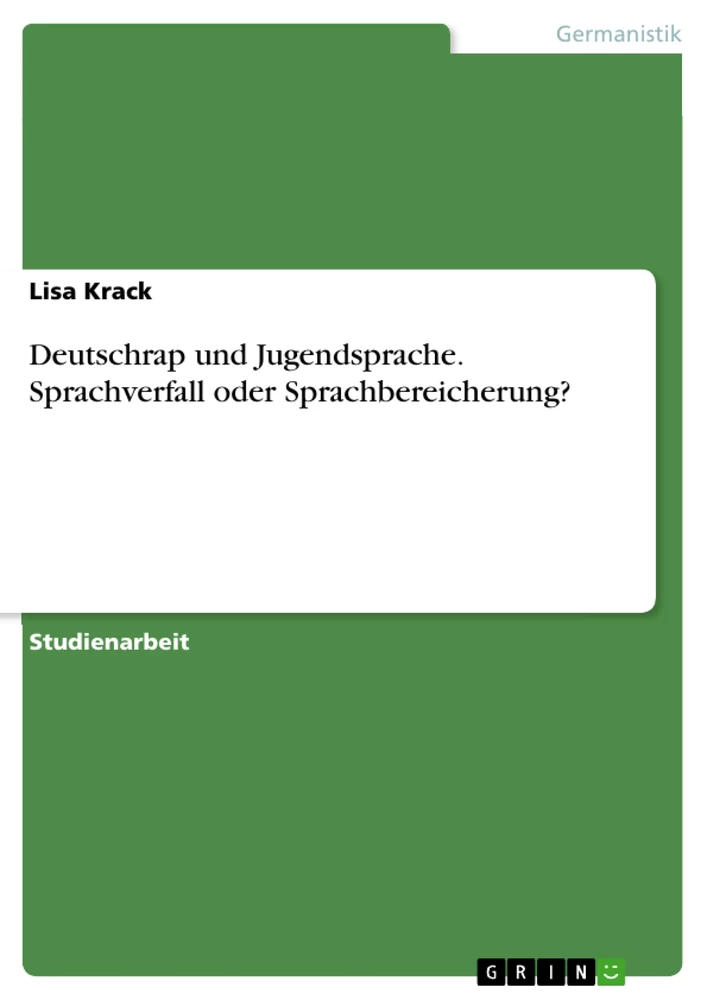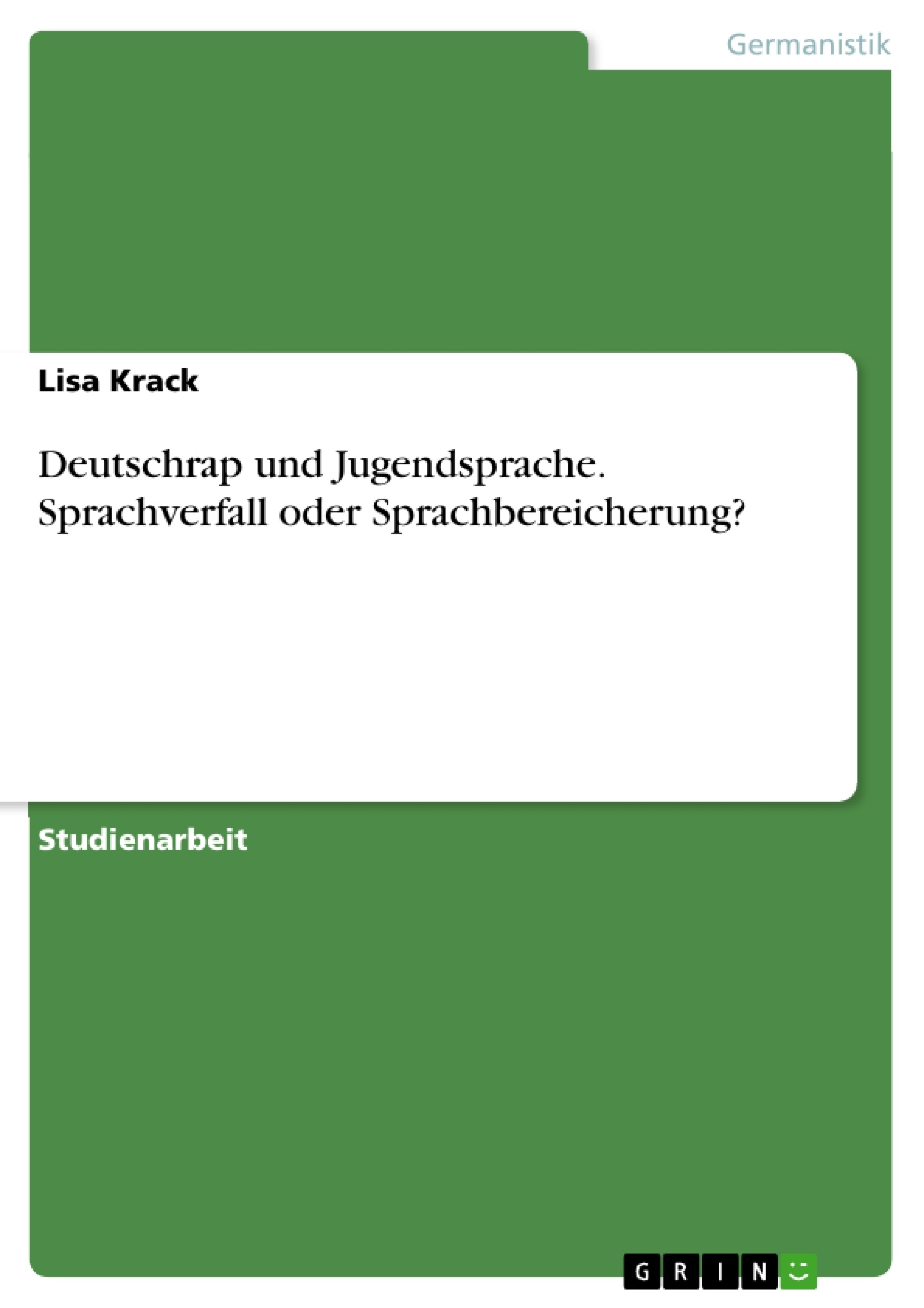In dieser Arbeit wird der Sprachgebrauch im deutschsprachigen Gangsta-Rap analysiert. Untersucht werden einzelne Merkmale auf den Ebenen der Lexik, Grammatik und Syntax, die im Zentrum der aktuellen Sprachkritik stehen. Diese sprachlichen Phänomene wurden anhand ihrer Gebrauchsfrequenz in den Rap-Texten und ihrer Erwähnung in sprachkritischen und sprachpuristischen Kontexten ausgesucht. Einen abgetrennten Analyseteil wird es in dieser Untersuchung nicht geben, da die Nennung und theoretische Erläuterung der sprachlichen Merkmale mit illustrierenden Beispielen aus den Rap-Texten einhergehen werden.
Da Rap als Teil der Hiphop-Kultur eine der weltweit einflussreichsten Jugendkulturen darstellt, wird auch die Jugendsprache und ihre Verbindung zur Sprache im Rap näher betrachtet. Das Ziel dieser Arbeit ist zu überprüfen, ob die Negativurteile über den Sprachgebrauch im Deutschrap berechtigt sind und ob in diesem Zusammenhang von einem negativen Einfluss auf die Standardsprache die Rede sein kann.
In der Rap-Musik steht die Sprache im Vordergrund, während die Musik eher als Begleitung fungiert. Im Gegensatz zu anderen Musikgenres ist Rap-Musik Text-zentrierter und unterscheidet sich vor allem durch die Komplexität der Artikulation von anderen Musikrichtungen wie zum Beispiel der Popmusik. Aufgrund ihrer umgangssprachlichen Orientierung wird die Sprache im Rap oft als Sprache der Straße bezeichnet.
Gerade diese Nähe zu der gesprochenen Alltagssprache macht die sprachlichen Äußerungsformen deutscher Rapper zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen. Doch nicht allein die normfernen Sprechweisen im Rap, sondern auch die Songthemen sind bis heute Auslöser von Kontroversen. Im Mittelpunkt solcher Diskussionen steht der sogenannte Gangsta-Rap, bei dem kriminelles, gewalttätiges oder sexuell anstößiges Verhalten propagiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textsorte
- 3. Die Sprache im Rap
- 4. Jugendsprache und Deutschrap
- 5. Die Lexik des deutschsprachigen Rap
- 5.1. Anglizismen
- 5.2. Anglizismen in deutschen Rap-Texten
- 5.3. Ethnolekte
- 5.4. Ethnolekte im Deutschrap
- 5.5. Vulgärsprache
- 6. Verkürzungen und Auslassungen
- 7. Weil-Verbzweitstellung
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Sprachgebrauch im deutschsprachigen Gangsta-Rap und überprüft, ob die Negativurteile über diesen gerechtfertigt sind und ob ein negativer Einfluss auf die Standardsprache besteht. Es werden lexikalische, grammatikalische und syntaktische Merkmale analysiert, die in der Sprachkritik im Mittelpunkt stehen. Die Jugendsprache und ihre Verbindung zum Rap werden ebenfalls beleuchtet.
- Analyse des Sprachgebrauchs im deutschsprachigen Gangsta-Rap
- Bewertung der Kritik am Sprachgebrauch im Deutschrap
- Untersuchung des Einflusses von Jugendsprache auf den Rap
- Behandlung lexikalischer Besonderheiten (Anglizismen, Ethnolekte, Vulgärsprache)
- Analyse grammatikalischer und syntaktischer Merkmale
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachgebrauchs im deutschsprachigen Gangsta-Rap ein. Sie hebt die textzentrierte Natur des Rap im Vergleich zu anderen Musikgenres hervor und betont die kontroversen Diskussionen um die Sprache und die Themen im Gangsta-Rap. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse sprachlicher Merkmale auf den Ebenen der Lexik, Grammatik und Syntax, die in der aktuellen Sprachkritik im Vordergrund stehen. Die Verbindung zum Phänomen der Jugendsprache wird ebenfalls angesprochen, da Rap als Teil der HipHop-Kultur eine weltweit einflussreiche Jugendkultur darstellt. Der Mangel an wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema im Vergleich zur Fülle populärwissenschaftlicher und journalistischer Publikationen wird ebenfalls erwähnt.
2. Textsorte: Dieses Kapitel definiert Rap als Textsorte, indem es formale Merkmale wie orale Realisation, basale Einstimmigkeit, rhythmische Bindung und Reimgebundenheit hervorhebt. Inhaltlich existieren keine Einschränkungen. Die Einordnung von Rap-Texten im Nähe-Distanz-Modell von Koch/Österreicher wird diskutiert, wobei die Dualität von Schriftlichkeit und Mündlichkeit betont wird. Das Kapitel diskutiert auch die Einordnung von Rap als Gattung – hier als Lyrikform.
3. Die Sprache im Rap: Dieser Abschnitt untersucht die Sprache als das zentrale Zeichensystem des Rap und betont den etymologischen Bezug zur „spoken-word poetry“ sowie die afroamerikanische Herkunft des Begriffs „to rap“. Die unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen des Verbs „to rap“ (z.B. „quatschen“ oder „lebhaftes Daherreden/prahlen“) werden diskutiert, um die inhärente Sprachbezogenheit des Musikgenres zu verdeutlichen.
4. Jugendsprache und Deutschrap: Das Kapitel definiert Jugendsprache und diskutiert die wissenschaftlichen Kontroversen um diesen Begriff. Es wird die Problematik der Homogenität der Jugendgruppe und der schwer bestimmbaren Dauer der Jugendphase angesprochen. Der Einfluss der „Jugendrevolten“ der späten 70er Jahre auf die Verbreitung der Jugendsprache wird behandelt, sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen Vorurteile und Kritikpunkte.
5. Die Lexik des deutschsprachigen Rap: Dieses Kapitel beschreibt die lexikalische Variabilität des deutschsprachigen Rap, die durch die Orientierung an der gesprochenen Alltagssprache, Jugendsprache und Slang bedingt ist. Es werden kritische Auseinandersetzungen mit dem vermeintlich begrenzten Wortschatz und der Verwendung von Schimpf- und Vulgärausdrücken sowie Slang-Elementen (wie „Kanak Sprak“) behandelt, die oft als Ausdruck eines „antiintellektuellen Habitus“ interpretiert werden.
Schlüsselwörter
Deutschrap, Gangsta-Rap, Jugendsprache, Sprachkritik, Lexik, Grammatik, Syntax, Anglizismen, Ethnolekte, Vulgärsprache, Standardsprache, Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sprachwissenschaftlichen Analyse von Deutschrap
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Sprachgebrauch im deutschsprachigen Gangsta-Rap. Sie untersucht, ob die Kritik an der Sprache im Deutschrap gerechtfertigt ist und ob ein negativer Einfluss auf die Standardsprache besteht. Die Analyse umfasst lexikalische, grammatikalische und syntaktische Merkmale.
Welche Aspekte des Sprachgebrauchs werden untersucht?
Die Analyse betrachtet lexikalische Besonderheiten wie Anglizismen, Ethnolekte und Vulgärsprache. Zusätzlich werden grammatikalische und syntaktische Merkmale untersucht, insbesondere im Hinblick auf Jugendsprache und deren Einfluss auf den Rap.
Wie wird der Rap als Textsorte eingeordnet?
Der Rap wird als Textsorte mit oralen Merkmalen wie rhythmischer Bindung und Reimgebundenheit definiert. Seine Einordnung im Nähe-Distanz-Modell von Koch/Österreicher wird diskutiert, wobei die Dualität von Schriftlichkeit und Mündlichkeit betont wird. Der Rap wird als Lyrikform eingeordnet.
Welche Rolle spielt die Jugendsprache?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Jugendsprache auf den Deutschrap und die damit verbundenen wissenschaftlichen Kontroversen. Sie diskutiert die Problematik der Homogenität von Jugendgruppen und die schwer bestimmbare Dauer der Jugendphase. Der Einfluss der „Jugendrevolten“ der 70er Jahre auf die Verbreitung der Jugendsprache und die damit verbundenen gesellschaftlichen Vorurteile werden behandelt.
Welche lexikalischen Besonderheiten werden analysiert?
Die Analyse umfasst Anglizismen, Ethnolekte und Vulgärsprache im Deutschrap. Die Arbeit befasst sich kritisch mit dem vermeintlich begrenzten Wortschatz und der Verwendung von Schimpf- und Vulgärausdrücken, die oft als Ausdruck eines „antiintellektuellen Habitus“ interpretiert werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Textsorte Rap, Sprache im Rap, Jugendsprache und Deutschrap, Lexik des deutschsprachigen Rap (mit Unterkapiteln zu Anglizismen, Ethnolekten und Vulgärsprache), Verkürzungen und Auslassungen, Weil-Verbzweitstellung und Fazit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Das Fazit wird in der Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit genannt, die genaue Schlussfolgerung der Arbeit kann nur durch das Lesen der vollständigen Arbeit erfahren werden.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Deutschrap, Gangsta-Rap, Jugendsprache, Sprachkritik, Lexik, Grammatik, Syntax, Anglizismen, Ethnolekte, Vulgärsprache, Standardsprache, Sprachwandel.
- Quote paper
- Lisa Krack (Author), 2020, Deutschrap und Jugendsprache. Sprachverfall oder Sprachbereicherung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956956