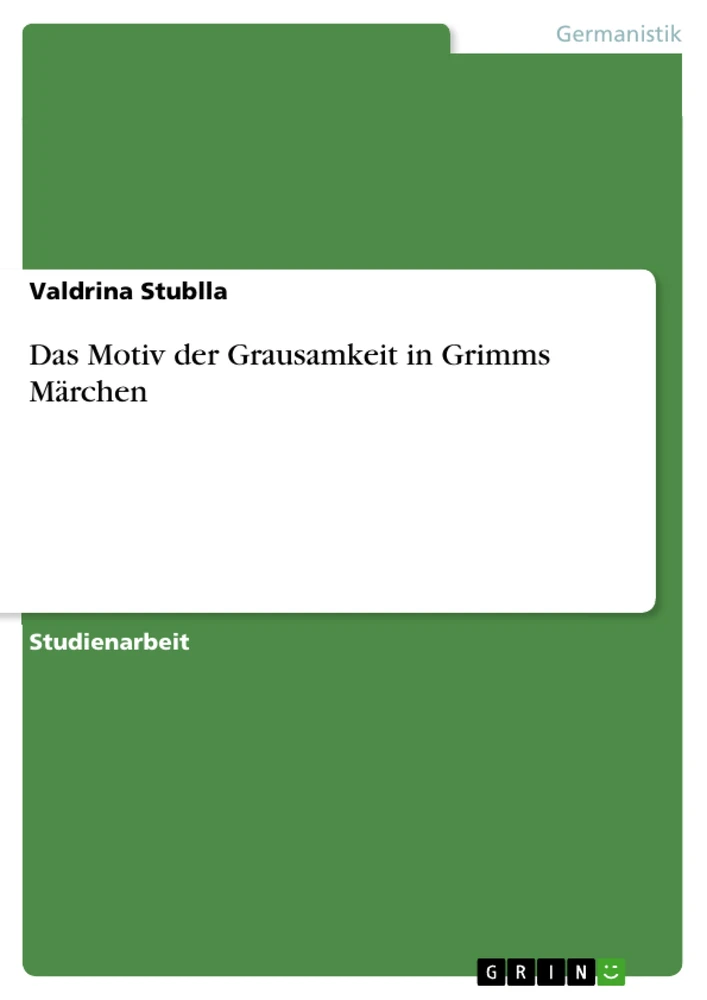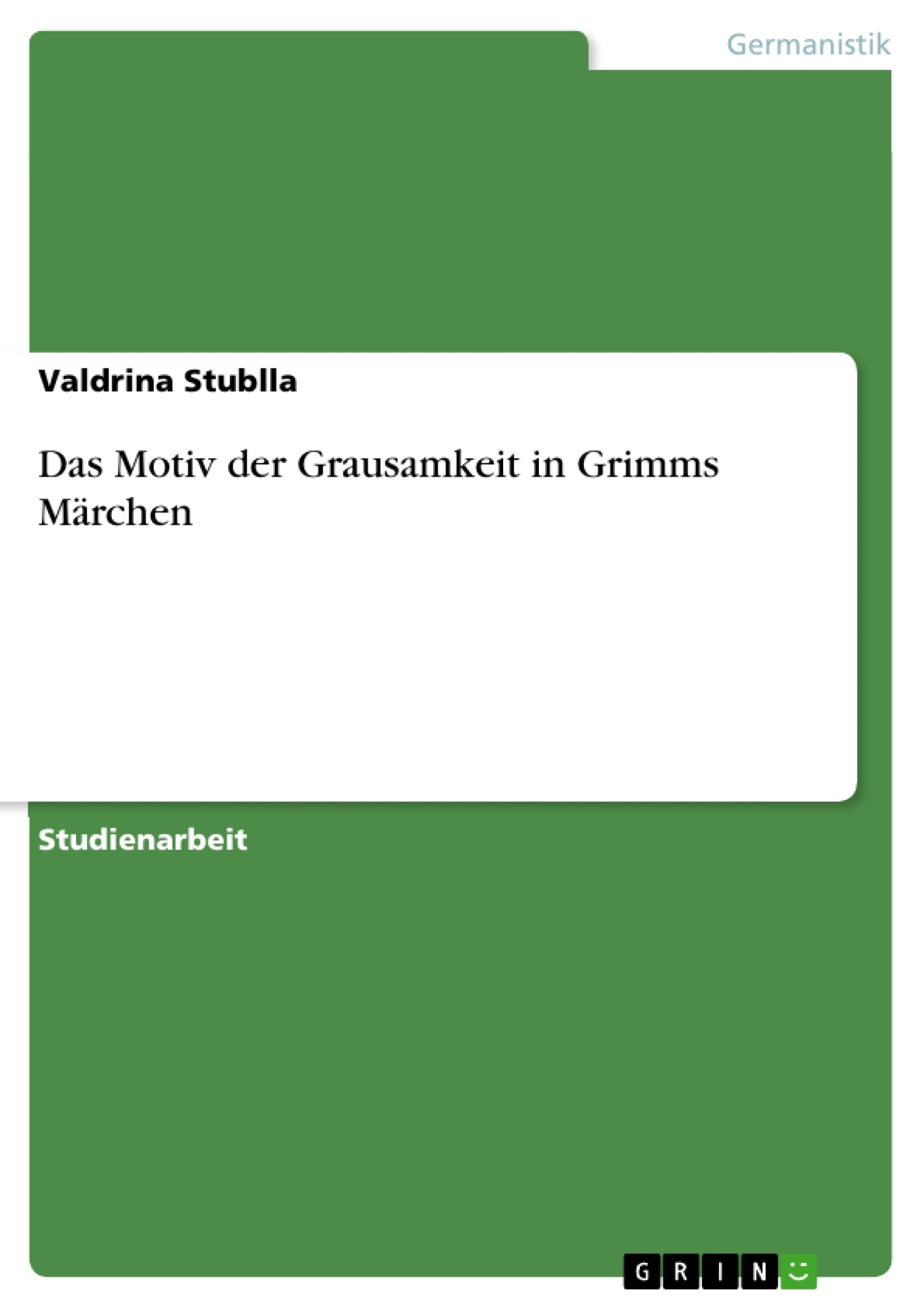Beginnend mit einem Einblick in den theoretischen Hintergrund der Märchen, werde ich zunächst das Märchen aus literaturwissenschaftlicher und literaturpädagogischer Sicht beleuchten, um einen groben Überblick über das Volks- und Kunstmärchen zu schaffen. Darauf folgt eine Einführung in die Entwicklung und Rezeption der Grimm’schen Märchen. Hauptsächlich soll sich diese Seminararbeit mit den grausamen Elementen in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm beschäftigen. Dabei soll vor allem auf folgende Fragen eingegangen werden: Wie veränderte sich das Motiv der Grausamkeit im Laufe der Jahre? Haben die Gebrüder Grimm besonders grausame Stellen gestrichen oder verändert? Wo genau findet sich das Motiv der Grausamkeit in den Grimm’schen Märchen wieder? Sind es die Kinder, die besonders grausam sind/handeln? Und weshalb wird diese dunkle Seite der Märchen oft übersehen, manchmal gar nicht wahrgenommen?
Grimms Märchen – bewundert und vielfach kritisiert! Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm gelten, mit ihrer 180 Jahre währenden Rezeptions- und Wirkungsgeschichte, als die Klassiker der deutschsprachigen Kinderliteratur. Nach der Erstveröffentlichung ihrer Bände in den Jahren 1812 bzw. 1815 erhielten sie neben begeisterter Zustimmung auch deutliche Kritik. Allein die Sammlung Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm bietet eine Vielzahl grausamer Handlungen. Zwar haben die Gebrüder Grimm einige der grausamen Elemente später rausgestrichen, um die Sammlung kindgerechter zu gestalten, doch das meiste ist stehen geblieben. Die Frage nach der Grausamkeit im Märchen führt heute noch zu einer kontroversen Diskussion. Einerseits tragen die grausamen Elemente zu einer Anti-Märchen-Stimmung bei ("Böses kommt aus Kinderbüchern"), andererseits führen sie auch zu neuen Rechtfertigungen des Märchens ("Kinder brauchen Märchen").
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Definition von Märchen aus literaturwissenschaftlicher und literaturpädagogischer Sicht
- Volksmärchen
- Kunstmärchen
- Bedeutung und Funktion des Märchens
- Märchen in der Erziehung
- Definition von Märchen aus literaturwissenschaftlicher und literaturpädagogischer Sicht
- Entwicklung und Rezeption der Grimm'schen Märchen
- Grausamkeiten in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm
- Das böse Kind im Märchen
- Konkrete Beispiele physischer und psychischer Grausamkeiten im Volksmärchen
- Zwecke der Grausamkeit
- Die Volksmärchen in der literaturpädagogischen und literaturdidaktischen Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Motiv der Grausamkeit in den Grimm'schen Märchen und untersucht die Entstehung, Entwicklung und Rezeption dieser Thematik. Sie analysiert, wie das Motiv der Grausamkeit in den Märchen der Gebrüder Grimm in verschiedenen Kontexten und Epochen interpretiert wurde und welche Auswirkungen es auf die Literaturpädagogik und -didaktik hatte.
- Definition und Abgrenzung von Volks- und Kunstmärchen
- Entwicklung und Rezeption der Grimm'schen Märchen
- Analyse der Grausamkeiten in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm
- Die literaturpädagogische und literaturdidaktische Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts
- Die Frage nach der Bedeutung und Funktion der Grausamkeit im Märchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Grausamkeit in den Grimm'schen Märchen vor. Sie beleuchtet die Rezeption der Märchen und die Kontroversen, die mit der Darstellung von Gewalt in Kinderliteratur verbunden sind.
Der theoretische Hintergrund beschäftigt sich mit der Definition von Märchen aus literaturwissenschaftlicher und literaturpädagogischer Sicht. Er analysiert die Unterscheidung zwischen Volks- und Kunstmärchen und erläutert die Bedeutung und Funktion des Märchens in der Gesellschaft und in der Erziehung.
Das Kapitel über die Entwicklung und Rezeption der Grimm'schen Märchen beschreibt den Entstehungsprozess der Sammlung Kinder- und Hausmärchen und beleuchtet die unterschiedlichen Reaktionen auf die Märchen im Laufe der Geschichte.
Im Kapitel "Grausamkeiten in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm" werden konkrete Beispiele für physische und psychische Grausamkeiten im Volksmärchen analysiert. Die Arbeit untersucht die Rolle des bösen Kindes im Märchen und hinterfragt die Zwecke der Grausamkeit in den Erzählungen.
Die Volksmärchen in der literaturpädagogischen und literaturdidaktischen Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts beleuchtet, wie die Grausamkeit in den Märchen im Laufe der Zeit interpretiert und pädagogisch genutzt wurde.
Schlüsselwörter
Grimms Märchen, Kinderliteratur, Volksmärchen, Kunstmärchen, Grausamkeit, Gewalt, Rezeption, Literaturpädagogik, Literaturdidaktik, Erziehungsliteratur, Moral, Pädagogik, Kinderentwicklung, Kind, Familie, Märchenforschung, Märcheninterpretation, Mythologie, Folklore.
- Quote paper
- Valdrina Stublla (Author), 2019, Das Motiv der Grausamkeit in Grimms Märchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956873