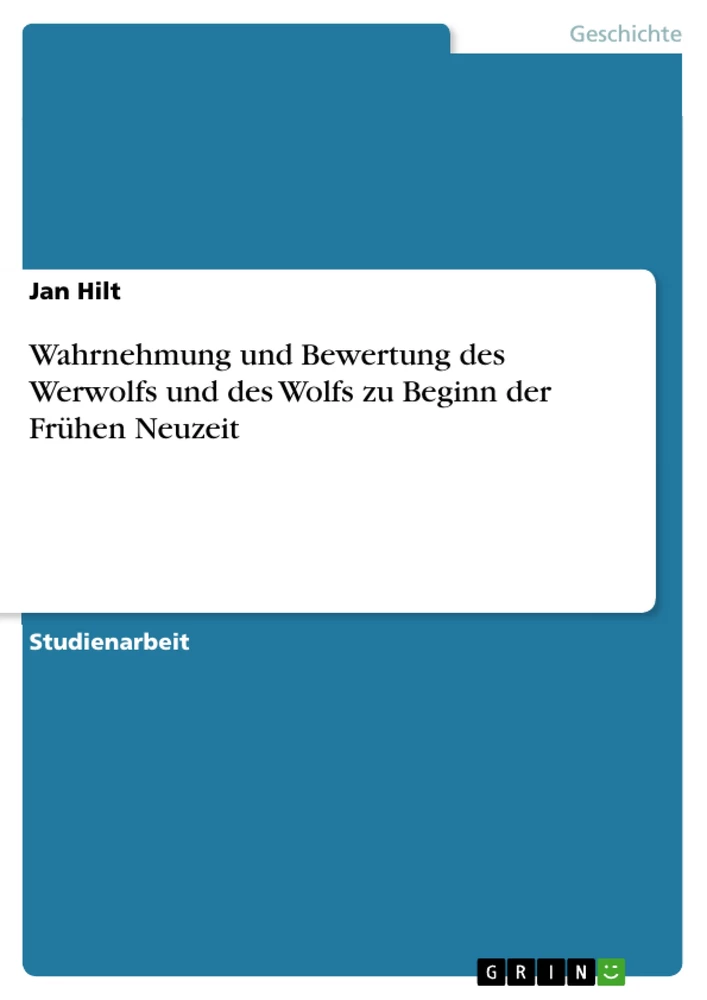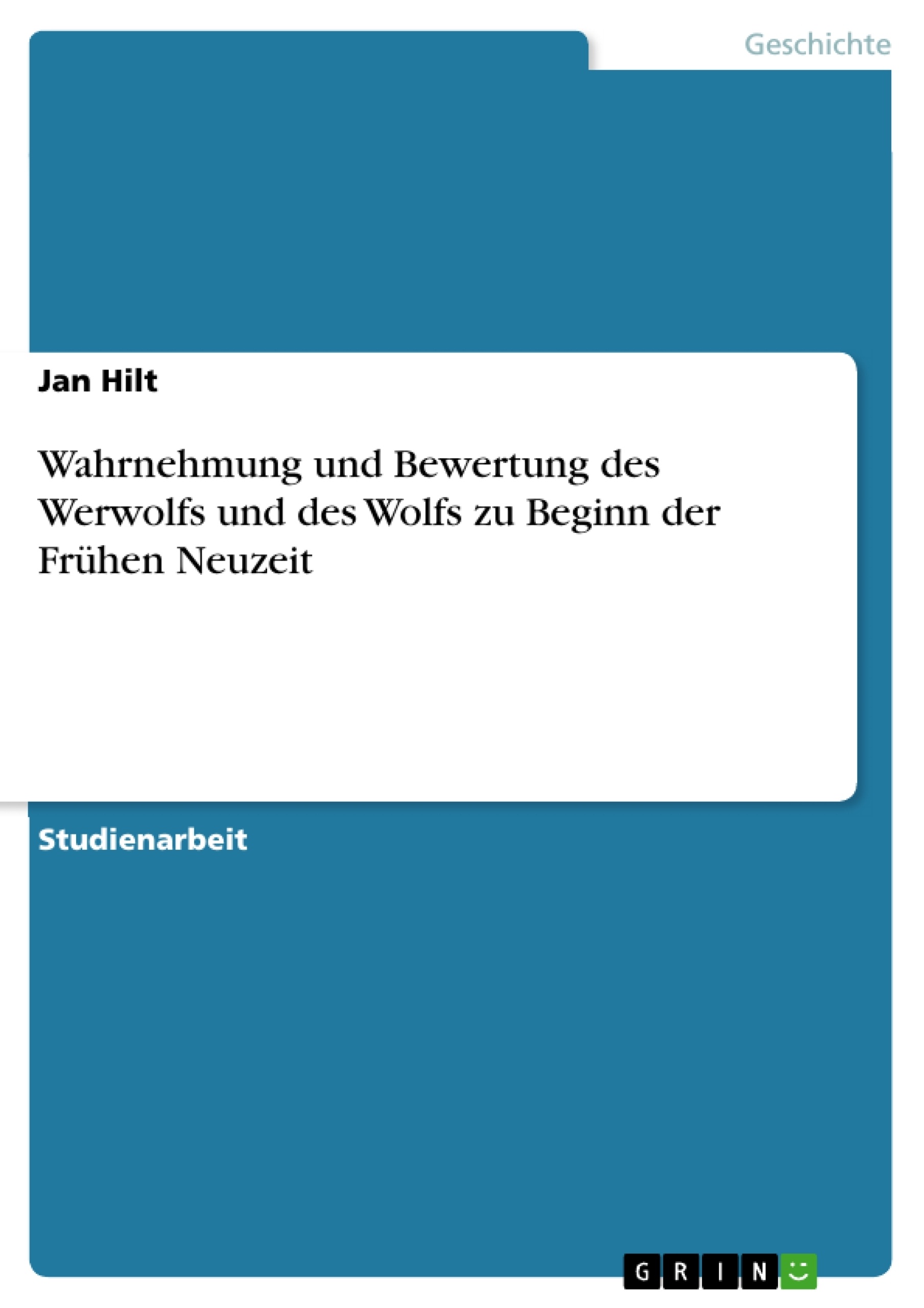Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage wie der Wolf zu Beginn der Frühen Neuzeit wahrgenommen wurde, insbesondere im Zusammenhang mit der Figur des Werwolfs und den Werwolfsprozessen.
Der Werwolf ist heute eine Figur, die in vielen Filmen, Serien und Büchern auftaucht. Kaum ein Werk, dass sich mit Horror oder Fantasy beschäftigt kommt ohne diese Bestie aus. Der Wolf findet sich dagegen, bis auf einige wenige Ausnahmen, nur noch in Tierparks als lebendes Tier in Deutschland. Während der Frühen Neuzeit war dies anders. Der Werwolf wurde als eine echte Bedrohung angesehen, die es zu bekämpfen galt, und auch der Wolf war im deutschen Raum verbreitet und wurde gejagt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Werwolf
- Der Werwolf in Antike und Mittelalter
- Der frühneuzeitliche Werwolf
- Wolf, Mensch und Werwolf
- Der Wolf
- Echte Wölfe, magische Wölfe und Werwölfe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahrnehmung und Bewertung des Wolfs und des Werwolfs zu Beginn der Frühen Neuzeit. Der Fokus liegt dabei auf dem "animal turn" und betrachtet die Bestie, nicht den Menschen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Werwolf-Figur bis in die Frühe Neuzeit und setzt diese in Beziehung zur gleichzeitigen Wahrnehmung des Wolfs. Es wird die Unterscheidung zwischen realen Wölfen, magischen Wölfen und Werwölfen beleuchtet.
- Entwicklung des Werwolf-Mythos von der Antike bis zur Frühen Neuzeit
- Wahrnehmung des Wolfs in der Frühen Neuzeit
- Unterscheidung zwischen Wolf, magischem Wolf und Werwolf
- Einfluss des Werwolfglaubens auf die Wolfsjagd
- Analyse relevanter theologischer und wissenschaftlicher Texte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Wandel der Wahrnehmung von Werwölfen und Wölfen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Sie hebt den Unterschied in der heutigen und damaligen Betrachtungsweise hervor und kündigt den Fokus der Arbeit auf den Wolf und den Werwolf mit Blick auf den „animal turn“ an. Die methodische Vorgehensweise wird skizziert: Zuerst wird die Figur des Werwolfs und deren Entwicklung bis zur Frühen Neuzeit behandelt, gefolgt von einem Überblick über den Wolf in diesem Zeitraum. Schließlich wird die Unterscheidung zwischen Wolf, magischem Wolf und Werwolf im Detail analysiert, wobei das Werk „Malleus Maleficarum“ von Heinrich Kramer eine wichtige Rolle spielt. Die Einleitung nennt auch relevante Werke anderer Autoren, die sich mit dem Thema Werwolf und dem Verhältnis von Wolf und Mensch auseinandersetzen.
2. Der Werwolf: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff „Werwolf“ und dessen vielschichtiger Bedeutung in Mythologie, Sage, Theologie und Rechtsprechung bis zur Frühen Neuzeit. Es definiert den Werwolf als eine mythologische Bestie, die entweder eine Mischung aus Mensch und Wolf ist oder die Verwandlung eines Menschen in einen Wolf beschreibt. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Unterscheidung zwischen Wolf und Werwolf.
2.1 Der Werwolf in Antike und Mittelalter: Dieser Abschnitt untersucht die Darstellung von Werwölfen in der Antike und im Mittelalter, beginnend mit Beispielen aus dem Gilgamesch-Epos und den Metamorphosen des Ovid. Er analysiert die verschiedenen Perspektiven auf die Werwolfgestalt, von der Darstellung als reale Verwandlung bis hin zur Deutung als teuflische Täuschung. Der Abschnitt beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen von Wissenschaft und Theologie bezüglich der Möglichkeit der Verwandlung und zeigt die Entwicklung des Werwolfglaubens über die Jahrhunderte auf, wobei der Glaube an eine tatsächliche Verwandlung im Mittelalter eher eine untergeordnete Rolle spielte, im Gegensatz zu der Vorstellung, dass der Teufel dem Menschen die Verwandlung vorspielt.
2.2 Der frühneuzeitliche Werwolf: Dieses Unterkapitel fokussiert sich auf die Veränderungen im Werwolfglauben während der frühen Neuzeit, insbesondere die zunehmende Akzeptanz der Möglichkeit einer tatsächlichen Verwandlung. Es hebt die Rolle von Gelehrten wie Olaus Magnus hervor, der sich gegen Plinius stellt und die reale Verwandlung in der „Historia de gentibus septentrionalibus“ beschreibt. Der Wandel in der Wahrnehmung wird im Kontext der Hexenverfolgung erläutert, in der Werwölfe als reale Bedrohung betrachtet wurden.
3. Wolf, Mensch und Werwolf: Dieses Kapitel behandelt den Wolf im Kontext des Werwolfglaubens. Es soll die Unterschiede zwischen realen Wölfen, magischen Wölfen und den Werwölfen der Mythologie aufzeigen.
Schlüsselwörter
Werwolf, Wolf, Frühe Neuzeit, Lykanthropie, Mythologie, Sagen, Wahrnehmung, Bewertung, "animal turn", Heinrich Kramer, Malleus Maleficarum, Hexenverfolgung, Wölfe im Mittelalter, Tierverwandlung.
Häufig gestellte Fragen: Wahrnehmung und Bewertung des Wolfs und des Werwolfs in der Frühen Neuzeit
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Wahrnehmung und Bewertung des Wolfs und des Werwolfs zu Beginn der Frühen Neuzeit. Der Fokus liegt dabei auf dem "animal turn" und betrachtet die Bestie, nicht den Menschen. Analysiert wird die Entwicklung der Werwolf-Figur bis in die Frühe Neuzeit und deren Beziehung zur gleichzeitigen Wahrnehmung des Wolfs. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen realen Wölfen, magischen Wölfen und Werwölfen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Werwolf-Mythos von der Antike bis zur Frühen Neuzeit, die Wahrnehmung des Wolfs in der Frühen Neuzeit, die Unterscheidung zwischen Wolf, magischem Wolf und Werwolf, den Einfluss des Werwolfglaubens auf die Wolfsjagd und analysiert relevante theologische und wissenschaftliche Texte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und den Fokus auf den Wolf und den Werwolf im Kontext des "animal turn" erläutert. Kapitel 2 befasst sich mit dem Werwolf und dessen Bedeutung in Mythologie, Sage, Theologie und Rechtsprechung bis zur Frühen Neuzeit. Kapitel 2.1 untersucht den Werwolf in Antike und Mittelalter, während Kapitel 2.2 den frühneuzeitlichen Werwolf und den Wandel im Werwolfglauben beleuchtet. Kapitel 3 behandelt den Wolf im Kontext des Werwolfglaubens und die Unterscheidung zwischen realen Wölfen, magischen Wölfen und Werwölfen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Rolle spielt das Werk „Malleus Maleficarum“?
Das Werk „Malleus Maleficarum“ von Heinrich Kramer spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse der Unterscheidung zwischen Wolf, magischem Wolf und Werwolf. Es wird im Kontext der damaligen Wahrnehmung und Bewertung dieser Wesen betrachtet.
Welche weiteren Autoren werden erwähnt?
Die Einleitung nennt weitere relevante Werke anderer Autoren, die sich mit dem Thema Werwolf und dem Verhältnis von Wolf und Mensch auseinandersetzen. Konkrete Namen werden in der Zusammenfassung nicht genannt, jedoch wird die Relevanz dieser Werke hervorgehoben.
Wie wird die Unterscheidung zwischen Wolf, magischem Wolf und Werwolf behandelt?
Die Arbeit untersucht detailliert die Unterscheidung zwischen realen Wölfen, magischen Wölfen (mit übernatürlichen Fähigkeiten) und den Werwölfen der Mythologie. Dieser Unterschied ist ein zentrales Thema der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Werwolf, Wolf, Frühe Neuzeit, Lykanthropie, Mythologie, Sagen, Wahrnehmung, Bewertung, "animal turn", Heinrich Kramer, Malleus Maleficarum, Hexenverfolgung, Wölfe im Mittelalter, Tierverwandlung.
- Quote paper
- Jan Hilt (Author), 2016, Wahrnehmung und Bewertung des Werwolfs und des Wolfs zu Beginn der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956760