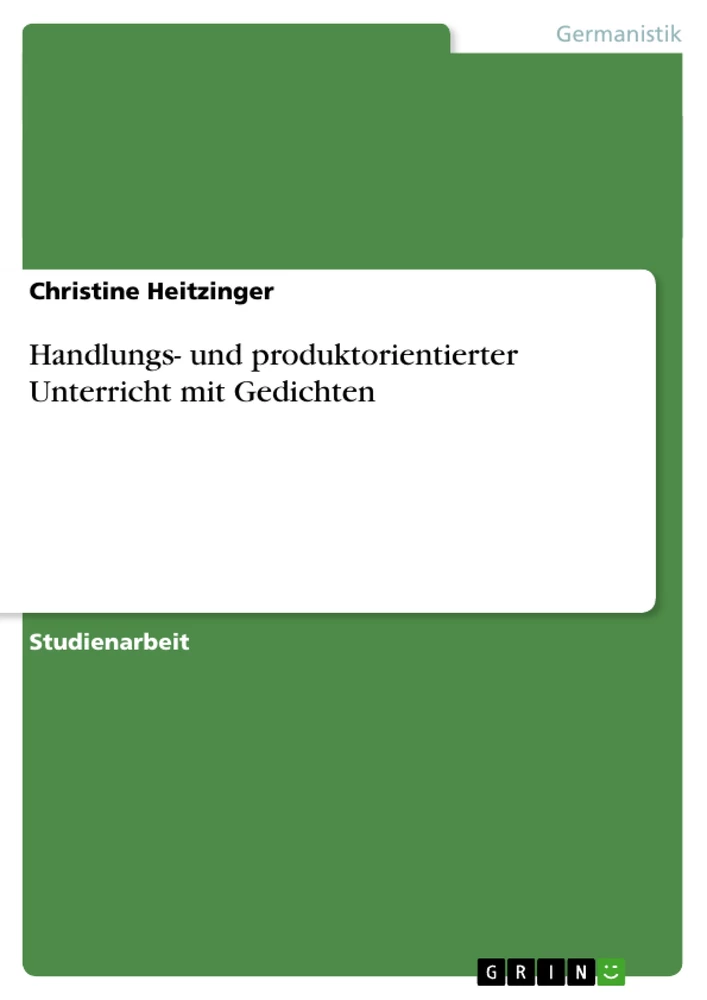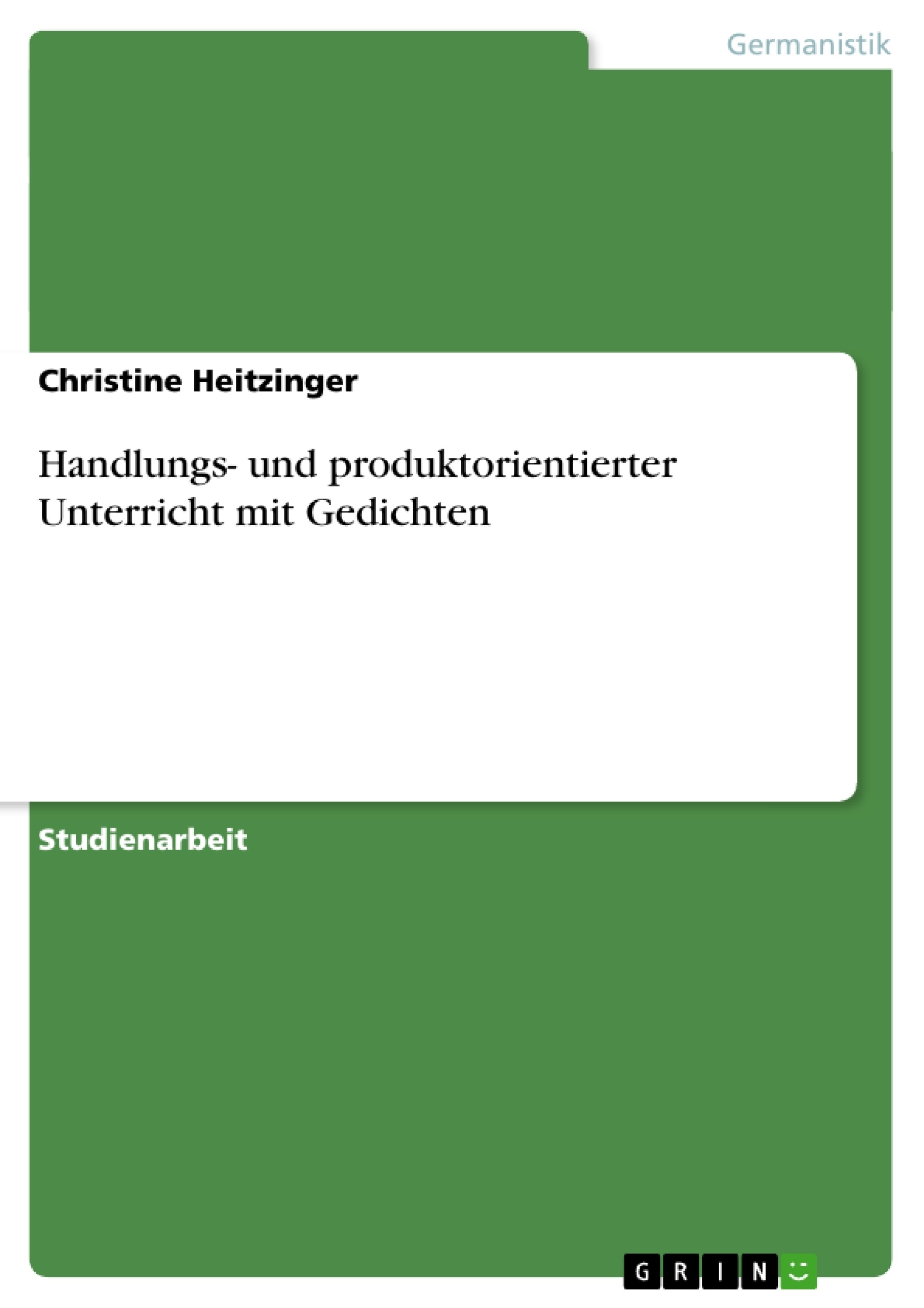Entdecken Sie die zauberhafte Welt der Kinderlyrik, ein Universum voller Klang, Rhythmus und Fantasie, das weit mehr ist als nur ein Übergangsstadium zur Dichtung für Erwachsene. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise durch die vielfältigen Formen und Funktionen von Kinderreimen, Kindergedichten und Kinderliedern, von den ersten Nachahmungsversen bis hin zu komplexen Reflexionslyriken, die bereits kritische Gedanken anstoßen. Tauchen Sie ein in die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Kinderlyrik, lernen Sie die prägenden Elemente wie Reim, Rhythmus und Metaphern kennen und verstehen Sie, wie diese auf den kindlichen Erfahrungshorizont zugeschnitten sind. Erfahren Sie, welche Themen Kinder bewegen – Familie, Freunde, Natur, aber auch soziale Fragen – und wie diese in altersgerechter Sprache und Form verarbeitet werden. Das Werk bietet nicht nur eine umfassende Typologie der Kinderlyrik, sondern auch eine fundierte Auseinandersetzung mit didaktischen und methodischen Fragen der Vermittlung im Unterricht. Es werden praktische Möglichkeiten der Umsetzung vorgestellt, von produktiven Rezeptionstechniken über spielerische Verfahren bis hin zu kreativen Schreibaufgaben, die Kinder zum eigenen Dichten anregen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Sie Kinder für die Poesie begeistern und ihre sprachliche Kreativität fördern können, indem Sie Gedichte als Schreibimpulse nutzen, Bearbeitungsaufgaben stellen oder Präsentationsformen entwickeln. Ob Eltern, Erzieher oder Lehrer – dieses Buch ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die Kindern die Freude an der Sprache und die Schönheit der Lyrik näherbringen möchten. Es erschließt ein tiefes Verständnis für die Bedeutung von Kindergedichten als Spiegel der kindlichen Seele und als wertvolles Werkzeug zur Förderung von Fantasie, Sprachgefühl und Weltverständnis, und präsentiert eine Fülle an Beispielen, die sofort im pädagogischen Alltag eingesetzt werden können. Werden Sie zum Entdecker kindlicher Sprachwelten und wecken Sie die Begeisterung für Poesie in den Herzen junger Leser und Zuhörer.
Inhaltsverzeichnis:
1 Typologie der Kinderlyrik
1.1 Zu den einzelnen Begriffen
1.2 Entstehung und Entwicklung
1.3 Elemente und Merkmale der Kindergedichte
1.4 Themen
1.5 Einteilung der Kindergedichte
1.5.1 Gebrauchsverse
1.5.1.1 Nachahme- und Deutreime
1.5.1.2 Brauchtumslieder
1.5.1.3 Kindergebete
1.5.1.4 Abzählreime Albumverse
1.5.1.6 Kinderstubenreime
1.5.1.7 Neckreime
1.5.1.8 Spottreime
1.5.1.9 Ulkreime
1.5.1.10 Trotzreime
1.5.1.11 Lieder zu Spielen und Tänzen
1.5.2 Erlebnis- und Stimmungslyrik
1.5.2.1 Naturgedichte
1.5.2.2 Tiergedichte
1.5.2.3 Dinggedichte
1.5.2.4 Gedichte, die durchgängig problemfrei Kindsein thematisieren
1.5.3 Reflexionslyrik (Gedankenlyrik)
1.5.4 Geschehnislyrik
1.5.4.1 Balladen
1.5.4.2 Erzählgedichte
1.5.4.3 Versfabeln
1.5.5 Sprachspiele
2 Formen der Vermittlung , Didaktik und Methodik
2.1 Medien
2.2 Didaktik und Methodik
2.2.1 Didaktische Grunds ä tze f ü r die Grundschule - Lehrplan
2.2.2 Didaktische Grunds ä tze im Deutschunterricht
2.2.3 Didaktische Ü berlegungen und Begr ü ndungen
2.2.4 Hinweise zur Methode
2.2.4.1 Methoden des Erlebens
2.2.4.2 Methoden der sprechgestaltenden Interpretation
2.2.4.3 Methoden der Erfassung von Form und Inhalt
2.2.4.4 Methoden des Mit-, Vor- und Nachgestaltens
2.2.4.5 Methoden des eigenen Verfassens von lyrischen Vorformen
3 Möglichkeiten der Umsetzung
3.1 Produktive Rezeptionstechniken
3.2 Spielerische Verfahren
3.3 Bearbeitungsaufgaben
3.4 Präsentationsformen
3.5 Gedichte als Schreibimpuls - Schreibaufgaben
4 Literaturverzeichnis
4.1 Didaktische Literatur zur Kinderlyrik und andere Behelfe
4.2 Kinderlyrik - Einzelwerke, Anthologien, in Sammelbänden zur Kinderliteratur
"Poesie ist die Muttersprache des Menschengeschlechts"
(Johann Georg Hamann)
Typologie der Kinderlyrik
Zu den einzelnen Begriffen
Kinderlyrik ist Bestandteil der Kinder- und Jugendliteratur. Diese wiederum ist Gegenstand der Literaturwissenschaft und beschäftigt sich somit mit Texten. Man spricht auch von der Textwissenschaft. Und ein Text ist laut KLEIN (1972) "das Gesamt der in einem Kommunikationsakt verwendeten Zeichen."
Wenn Kinder und/oder Jugendliche zu Texten greifen, werden sie von verschiedenen Lesemotivationen angetrieben. Man unterscheidet drei Grundantriebe (GIEHRL 1972, S. 27 ff.) des Lesens:
- Das Verlangen nach Erfassung und Durchdringung des innerweltlich Begegnenden, im Streben nach Weltorientierung und Welt- und Daseinserhellung.
- Das Streben nach Überwindung oder zumindest Lockerung der menschlichen Gebundenheiten.
- Das Suchen nach Ordnung und Gestalt, nach Sinndeutung der Welt und des menschlichen Lebens.
Doch nun zur Kinderlyrik:
Sie hat zwar, den Aufbau betreffend, ähnliche Komponenten wie die Erwachsenenlyrik (Elemente, Formen, Themen, Funktion und Intention), ist aber ein selbständiger Bereich der Lyrik. Die Aussage, Kinderlyrik sei nur ein Übergangsstadium zur Vollform der Erwachsenenlyrik, ist hiermit also widerlegt (REGER 1990, S. 33).
Einige Unterschiede zwischen der Kinder- und der Erwachsenenlyrik werde ich zum besseren Verständnis hier kurz anführen (FORYTTA/HANKE 1991, S. 19 ff.):
- Die Präsentation von Kindergedichten ist dem Entwicklungsstand der Kinder angepaßt (kindgemäß).
- Die Themen und Motive sind dem Lebens- und Umweltbereich der Kinder entnommen.
- Kindergedichte weisen eine überschaubare Gliederung, ein einfaches Metrum, ständige Wiederholungen, deutliche Kontraste,... auf.
- Die Abweichungen vom umgangssprachlichen Sprachgebrauch halten sich sehr in Grenzen. Als häufige Stilmittel wäre die Umschreibung des Gemeinten durch Verrätselung zu nennen.
- In Kindergedichten ist fast immer ein optimistischer Grundtenor zu finden, der Welt und dem Leben wird zugestimmt.
- Kindergedichte besitzen einen niedrigen Abstraktionsgrad.
In den meisten Fällen treffen mehrere der genannten Kriterien aufeinander.
"Das Kindergedicht ist eine eigene Form von Literatur wie das Kind eine eigene Form von Mensch ist, beide sind ein bißchen klein."
(HACKS; zit. in FORYTTA/HANKE 1991, S. 68)
Die Kinderlyrik wird, offensichtlicher als bei anderen literarischen Gattungen, hauptsächlich durch ihre Funktion bestimmt.
Unter Funktion versteht man in diesem Zusammenhang die Wirksamkeit oder Leistungsmöglichkeit verschiedener Gattungen von Lyrik, man spricht auch vom Gebrauchswert (FRANZ 1979, S. 45). GERSTNER-HIRZEL (1973, S. 942) drückt dies mit anderen Worten aus: "Die Funktionsbezogenheit ist ein Grundzug des Kinderreims." Unter Intention ist der Zweck, die Absicht einzelner Texte zu verstehen.
Zunächst jedoch will ich etwas genauer auf den Begriff der Kinderlyrik und ihre Zusammensetzung eingehen. "Kinderlyrik" - der Begriff läßt sich unterteilen in drei verschiedene Gattungen: den Kinderreim, das Kindergedicht und das Kinderlied. In einer kurzen Tabelle will ich kurz die Unterschiede offensichtlich machen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Informationen für die Tabelle habe ich aus FRANZ/MEIER (1983, S. 65 ff.) entnommen und in eine Tabelle eingebaut.
Entstehung und Entwicklung
Kindergedichte können auf zwei verschiedene Arten entstehen (FRANZ/MEIER 1983, S. 68):
- aus der Erwachsenenwelt übernommen:
Erwachsenenkunstlied è Erwachsenenvolkslied è Kinderlied
Erwachsenenkunstlied è è Kinderlied
Erwachsenenvolksliedè Kinderlied
- in der Kinderschicht entstanden
Elemente und Merkmale der Kindergedichte
FORYTTA/HANKE (1991, S. 68 ff.) haben sich eingehend mit den Elementen eines Kindergedichtes beschäftigt, wobei sie nicht nur Elemente der Sprache, sondern auch Formelemente als entscheidenden Beitrag zur Bedeutungsbildung erkannt haben:
- Klang der Wörter (ihre Lautgestalt)
- Reim (erleichtert die Einprägung, sorgt für Harmonie)
- Rhythmus (Betonungen, Pausen, Verzögerungen)
- Bilder (oft eher mit Sinnen als mit Logik zu erfassen)
- geschlossene Form (Anordnung in Versen und Strophen), die eigentlich das Gedicht ausmacht.
REGER (1990, S. 149 ff.) unterscheidet zwischen fünf verschiedenen Merkmalen der Kinderlyrik, ich werde sie alle nennen, die genaueren Unterteilungen aber weglassen, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen.
- Rhythmus und Rhythmuswechsel
Abzählreime zum Beispiel laufen nach einem typischen Rhythmus ab:
Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel das bist du.
Ä u ß erer Aufbau
Dazu zählen der Reim und die Strophen. Der Reim (= Endreim) ist der Gleichklang von Wörtern ab dem letzten betonten Vokal. Man unterscheidet zwischen dem Kreuzreim, Paarreim, Binnenreim, Kehrreim und Schüttelreim. Strophen sind zwei- oder mehrzeilig, oft wechselt auch die Zeilenanzahl in einem Text.
Klang
Die Lautung (= Klang) ist ein Grundelement der gesprochenen Sprache. Im Bereich der Lyrik ist sie daher besonders für klanggestaltendes Sprechen unbedingt notwendig. Zum Bereich des Klanges gibt es viele Klangspiele, die "irgendwie komisch" klingen, weil sie vom üblichen Sprachgebrauch abweichen. Für Kinder ist die Arbeit mit Klängen und Lauten also besonders interessant, weil sie zu eigenem Gestalten anregt.
Sprachbild (Metapher)
Metapher: sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort, eine Wortgruppe aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird, ohne daß ein direkter Vergleich zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem vorliegt; bildhafte Übertragung (DUDEN).
Metaphern sind in jedem schriftlichen oder mündlichen Text zu finden. Es gibt allerdings drei verschiedene Arten von Metaphern (linguistisch gesehen), je nachdem wie gebräuchlich die Verbildlichungen im alltäglichen Sprachgebrauch sind. Die kreativste Stufe der Metaphern ist auch jene, die man am ehesten in lyrischen Texten anfinden kann.
Die Übertragungen, die in diversen Texten angewendet werden, müssen natürlich auch verstanden werden. Die Auflösung ist allerdings nur möglich, wenn sich der Erfahrungs- oder auch Erkenntnis- und Empfindungshorizont des Senders und des Empfängers (Autor - Leser) gleichen.
In den lyrischen Texten, die für Kinder geschrieben wurden, sind vor allem zwei Arten von Metaphern besonders bedeutsam:
- die konkretisierende Metapher und die
- personifizierende Metapher
Die konkretisierende Metapher hat alle Naturphänomene und Gegenstände, die der Mensch produziert hat, zum Inhalt.
Die Macht ist ein zweischneidiges Schwert - die Talsohle der Arbeitslosigkeit ist noch nicht durchschritten.
Die personifizierende Metapher nutzt den Menschen, seine Seele, seine Gebräuche, seinen Geist,... Es werden zum Beispiel Personen in andere Personen umgewandelt ("Rockoma" = Tina Turner,...). Oder es werden menschliche Gefühle, Handlungen, Eigenschaften personifiziert (Wut und Schmerz schnürten ihr die Kehle zu).
Innerer Aufbau
Der innere Aufbau kann natürlich, wie auch der äußere Aufbau, verschiedenartig ablaufen. In der Grundschule sollten einige seiner speziellen Merkmale schon behandelt werden.
Darstellungsweisen und Zeitperspektiven
Dazu habe ich die Informationen in eine kleine Tabelle "verpackt", erstens um mir, zweitens, um dem Leser die Tatsachen verständlicher und übersichtlicher zu machen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gegensatz, Pointe, Anrede
Ungefähr ab der dritten Schulstufe sollten diese Begriffe auch für die Schüler verständlich sein, weil sie fast unerläßlich für eigene Textproduktionen sind. Gegensatz: Das ist ein Gestaltungsprinzip vieler lyrischer Texte, durch das der Inhalt intensiver verständlich wird.
Pointe: Sie ist ein überraschender, zugespitzter Schluß.
Anrede: Sie kann direkt ("seltsam rührt es dich an,...") oder indirekt ("hörst du, wie die Flammen flüstern?") erfolgen. Die Leser werden dadurch unmittelbar in den Text mit einbezogen.
Themen
Die Themen will ich nur kurz aufzählen, jeder soll selber entscheiden, welche Themen er in der Grundschule bearbeiten möchte und vor allem mit welchen Mitteln (Methoden). Ich werde allerdings verschieden Vorschläge verschiedener Autoren einbringen.
REGER (1990, S. 134 ff.) spricht von folgenden Themenbereichen:
- Kommunikationsbereich Familie
- Kommunikationsbereich Kinder und ihre Alterspartner
- Kommunikationsbereich Kinder und Erwachsene
- Kommunikationsbereich Kinder und Natur
- Kommunikationsbereich Arbeitswelt
- Kommunikationsbereich Erwachsene unter sich - in der Perspektive realitätskritischer Öffentlichkeit
- Kommunikationsbereich Kinder und Sprache - eingegrenzt auf Spielen mit Sprache
"Das Thema der Kinderlyrik ist die Welt. In den Gedichten und Liedern begegnet das Kind der Welt."
(LORBE 1974; zit. in FRANZ 1979, S. 55).
FRANZ (1979, S. 54 ff.) hat folgende Themen für relevant befunden:
- zuerst engste, später erweiterte Umgebung des Kindes
- lehrhafte Verse (ABC-Gedichte)
- Erscheinungen der Natur, Tiere und Pflanzen
- Sozialisation (Familie, Spielkameraden, Lehrer, Vertreter von Berufen,...)
- Brauchtum
- technische Errungenschaften (Raumfahrt, Eisenbahn, Roboter,...)
- Gleichheit der Menschen - Rassenprobleme, Krieg, Hunger
- Sozialkritik (Reichtum, Werte,...)
Einteilung der Kindergedichte
Eine Einteilung, das heißt eine sinnvolle Kategorisierung läßt sich unter dem Aspekt der Funktion eines Kinderreimes relativ gut durchführen. Denn andere Einteilungskriterien wie Thematik oder Motivik lassen zu viele Überschneidungen zu. Natürlich gibt es auch hier Probleme, eine eindeutige Gliederung zu schaffen: Im Laufe der Zeit kommt es oft zu Funktionsverlusten oder Verstümmelungen bzw. Umformungen (FRANZ, S. 45 ff.).
Die einzelnen Funktionen und Intentionen von Textsequenzen oder Textbeispielen können sich natürlich überschneiden: Viele kurze Verse zum Beispiel zählen nicht bloß als Auszählverse, sie fungieren auch oft als Neckreim. Eine eindeutige Einteilung in Bezug auf die Funktionalität ist also nicht möglich, aber auch nicht nötig. Bisher haben verschiedene Autoren, Sammler oder Liebhaber versucht, Kinderlyrik in verschiedene Kategorien zu unterteilen. Zu nennen wären: Karl Simrock, Franz Magnus B ö hmes, Riedl/Klier, Hermann Bausinger, Hermann Helmers, Robert Petsch, Emily Gerstner-Hirzel. Ich habe mich für REGER (1990, S. 33 ff.) entschieden, seine Einteilung kommt jedoch der von GERSTNER- HIRZEL (1973) sehr nahe. Auch die gewählten Termini bestimmter Unterteilungen lassen sich da und dort finden. REGER unterteilt die Kinderlyrik in mehrere Kategorien mit verschiedenen Charakteristika. Kriterium seiner Einteilung war ebenfalls die Funktion:
- Gebrauchsverse
- Erlebnis- und Stimmungslyrik (= Natur- und Dinglyrik, Tiergedichte, Kindsein)
- Reflexionslyrik (= Gedankenlyrik) - es wird zwischen religiöser, sozial- und umweltkritischer, politischer und lehrhafter Lyrik unterschieden.
- Geschehnislyrik (= Balladen, Erzählgedichte, Versfabeln)
- Sprechspiele jeder Art
Gebrauchsverse
Die einzelnen Unterarten sind besonders wichtig für die Kommunikation unter den Kindern. Ständig wird das Repertoire an Reimen erweitert, entweder durch Heranwachsende oder durch namhafte Kinderlyriker.
Der Bereich der Gebrauchsverse wird abermals unterteilt, man unterscheidet zwischen folgenden Gruppierungen. Ich werde sie nur kurz aufzählen (mit jeweils einem oder zwei Beispielen), jedoch jene, zu denen ich mir mögliche Unterrichtsverläufe überlegt habe, will ich etwas genauer schildern.
Nachahme- und Deutreime
Ich bin ein Musikante und komm aus Schwabenland. Ich kann auch spielen, auf meiner Geige:
Fi-di-gei-gei-gei, fi-di-gei-gei-gei, fi-di-gei-gei-gei-gei-gei. (...) auch spielen auf der Trompete:
Tängterän-täng-täng (...)
Verschiedene Laute, Klänge, Stimmen, Tierstimmen [vgl. mit den Kinderliedern von Hoffmann von Fallersleben "Summ, summ, summ" oder "Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald" in KNORR/SCHERBER (1991)] werden nachgeahmt oder gedeutet.
rauchtumslieder
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, Brenne auf, mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht.
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne.
(mündlich überliefert, in KNORR/SCHERBER 1991) Ostersonntag
Weit über das Tal hinaus,
hoch über die Gipfel der Berge
klingen die Glocken und rufen froh:
"Wir sind zurück aus Rom.
Jesus bringt uns Leben.
Horcht her, das freut uns so."
Die Ratschenbuben ziehen heim.
Die Ratschen kommen in den Schrank.
Ostereier wollen die Kinder finden,
sie müssen in allen Gärten sein!
(Spatzenpost, April 96)
Das oben genannte Lied zählt zu den Liedern der Jahreszeitenfeste, die vor allem in der Grundschule (und auch schon im Kindergarten - Laternenfest zum hl. Martin) im Bereich des Gesamtunterrichts eine Rolle spielen. Außerdem zählen zu den Themen der Brauchtumslieder noch Glückwünsche, Schulfeste, Ansinge- und Heischelieder.
Kindergebete
Jedes Tierlein hat zum Fressen, jedes Blümlein trinkt von Dir, hast auch unser nicht vergessen, lieber Gott, wir danken Dir.
(mündlich überliefert)
In vielen Schulen, vor allem in konfessionellen Grundschulen, gehören Gebete wie das oben erwähnte zum Tagesablauf. In der Schule, in der ich mein Blockpraktikum absolvierte, war es zum Beispiel üblich, am Morgen zu allererst ein kleines Gebet zu sprechen, wobei der Schwierigkeitsgrad und die Länge mit zunehmendem Alter anstiegen. In "meiner" ersten Klasse wurde folgendes Gebet gesprochen (die Kinder standen dabei auf und falteten ihre Hände):
Ich bin klein, mein Herzlein ist rein, soll niemand drin wohnen als Gott allein.
Über die Sinnhaftigkeit läßt sich wahrscheinlich streiten. Die Kinder mußten dieses Gebet jeden Morgen sprechen. Ich glaube nicht, daß dies zu einem tieferen Religionsverständnis beiträgt.
Abzählreime
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
eine alte Frau kocht Rüben, eine alte Frau kocht Speck - und du bist weg.
(mündlich überliefert)
Abzählreime fallen besonders in der Grundschule beim selbständigen Schreiben und Erfinden ins Gewicht, weil sie durch ihre einfache Form, den Rhythmus, den Humor und die sprachspielerische Ausdrucksweise zum eigenen Gestalten anregen. Besonders lustig ist es für jüngere Schüler, sinnlose Silben aneinander zu reihen und klangvoll zu sprechen.
Albumverse
Typisch sind diese Reime für die Poesiealben oder Stammbücher der Mädchen und auch mancher Jungen in der dritten Klasse. Diese Verse können durchaus zur eigenen Gestaltung aufrufen und sind daher für den Unterricht wertvoll.
Kinderstubenreime
Hopp, Hopp, Hopp, immer im Galopp, über Stock und über Steine, aber brich dir nicht die Beine, Hopp, Hopp, Hopp, Pferdchen lauf Galopp.
(mündlich überliefert)
Schlaf- und Wiegenlieder (Schlaf, Kindlein, schlaf,...), Kniereiterreime, Schaukelreime, Tanzliedchen, Pflegereime, Kosereime und -spiele, Trostreime, Zuchtreime zählen zu dieser Untergattung der Kinderlyrik. Die meisten Verse stammen aus der Feder eines Erwachsenen, die fast jeder aus seiner Kindheit kennt. Für die Schüler der Grundschule sind besonders Tanzlieder und Fingerspiele von didaktischem Interesse.
Neckreime
Ilse Bilse Keiner will se. Kam der Koch, Nahm se doch, Schiebt ihr was ins Ofenloch.
(RÜHMKORF 1967; zit. in REGER 1990, S. 45)
Diese Reime regen zum Lachen an, sie leben durch die positive Haltung der Kinder, obwohl viele bis zu diesem Zeitpunkt schon Widerwärtigkeiten erfahren mußten. Diese Reime dienen dazu, anderer Kinder, Spielpartner zu necken, wobei der Selbstbehauptungstrieb eine übergeordnete Rolle spielt. Neckreime werden in der Schule von Kindern gerne angenommen, weil man sie verändern, weitergestalten oder eigene verfassen kann.
Spottreime
Lehrer ist ein kluger Mann, schad, daß er nicht denken kann!
(REGER 1990, S. 46)
Die Spottreime sind eine Verschärfung der Neckreime und man begegnet einer stärkeren Verhöhnung. Besonders Handwerker und Lehrer werden in diesen Versen kräftig verspottet. Manche Reime sind politisch bestimmt, andere sind stark auf Sexualität ausgerichtet. Für die Kinder der Grundschule sind jedoch die nächsten Verwandten wie die Geschwister, Eltern oder Großeltern jene Personen, die kräftig aufs Korn genommen werden.
Ulkreime
In diesen Versen werden gerne Bibelzitate auf witzige Weise umgestaltet:
Ich bin der Herr Pastor
und predige euch was vor
von Maria Zwiebel
aus der dicken Bibel.
Und wenn ich nicht mehr weiter kann,
dann steck ich mir ein Pfeifchen an.
(REGER 1990, S. 51)
Im Unterricht der Grundschule haben die Ulkreime eigentlich keine Bedeutung. Hin und wieder dienen sie der Belustigung der Schüler untereinander.
Trotzreime
Sie richten sich hauptsächlich gegen die Mütter, grundsätzlich wird aber gegen alles getrotzt. Für den Unterricht wären Trotzreime insofern zu verwenden, indem sie gesprächsauslösende Tendenzen beinhalten (Essen, Spielen, Fernsehen, Taschengeld,...).
Sauerkraut und Rüben, die haben mich vertrieben.
Hätt meine Mutter Fleisch gekocht, so wär ich geblieben.
(REGER 1990, S. 51)
Lieder zu Spielen und Tänzen
Has, Has, Osterhas, ich wünsche mir das Beste: ein großes Ei, ein kleines Ei, dazu ein lustiges Dideldumdei. Und alles in dem Neste.
(REGER 1990. S 53)
Zu Spielen, wie zum Beispiel dem Schaukeln, Seilspringen oder Ballspielen, werden gerne, vor allem von Mädchen, Lieder gesungen.
Dann gibt es noch die Kreis- und Reihentänze, zu denen Kinder gerne singen. Zu beliebten Liedern zählen hierbei "Häschen in der Grube" und "Plumpsack". Mir fällt dazu ein Liedchen ein, das ich auch aus meiner Kindheit kenne: Alle Kinder stehen im Kreis um eine Stange (Klopfstange), reichen sich die Hände und hopsen im Kreis. Dabei wird gesungen:
Ringel, Ringel, Reihe, sind der Kinder dreie, spielen unterm Hollerbusch, machen alle Husch, Husch, Husch.
(mündlich überliefert)
Bei den Wörtern Husch, Husch, Husch sind alle in die Hocke gegangen und haben sich auf den Boden fallen lassen.
Die Bedeutung dieser Lieder für die Grundschule, speziell für den Turnunterricht, ist offensichtlich: Bewegungen zu einem bestimmten Rhythmus durchführen. Die Aufgabe des Deutschunterrichts wäre die Vermittlung neuer, weiterer Spiellieder und Tänze. Eine Verbindung mit dem Musikunterricht bietet sich bei dieser Gelegenheit geradezu an.
Der Bereich der Gebrauchsverse ist nun abgedeckt mit einigen Informationen und Beispielen zum Thema.
Erlebnis- und Stimmungslyrik
Zu dieser Kategorie zählen die "Naturgedichte, Tiergedichte, Dinggedichte und Gedichte, die durchgängig problemfrei Kindsein thematisieren" (REGER 1990, S. 54 ff.). Diese Gedichte werden von den Schülern in literarischer Art rezipiert, also bewußt aufgenommen - zumeist zuerst individuell und dann in der Schule, oft auch im Unterricht in verschiedenen Sozialformen. Sie werden dazu verwendet, kreativen Umgang mit Texten zu üben oder einfach, um den Heranwachsenden Lebenswirklichkeit nahe zu bringen.
Der Übergang zwischen den Texten der Gebrauchsverse und der Erlebnis- und Stimmungslyrik ist fließend. Besonders für den Unterricht ist diese Gattung der Gedichte wertvoll. Sie regen Schüler zum Gespräch oder zur Diskussion an, weil oft Wünsche oder Bedürfnisse an- und ausgesprochen werden.
Tiergedichte
Sie liefern durchwegs humorvolle Unterhaltung. Viele sind kitschig, weil die Tiere (wie oft auch Pflanzen und Dinge) personifiziert werden, aber realitätsfremd handeln. Viele Tiergedichte sind einfach Fabeln in Versform, sie besitzen also einen lehrhaften Charakter. Ein Paradebeispiel eines Tiergedichtes wäre Christian Morgensterns "Die drei Spatzen":
In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch, an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans.
Sie haben die Augen zu, ganz zu, und obendrüber, da schneit es, hu!
Sie rücken zusammen, dicht an dicht. So warm wie der Hans hat’s niemand nicht. Sie hören alle drei ihrer Herzlein Gepoch. Und wenn sie nicht weg sind, dann sitzen sie noch.
(zit. in REGER 1990, S. 58)
In der neueren Literatur sind vor allem Gedichte von Josef Guggenmos zu finden. Er ist wohl bekannt für seinen Witz und Reiz: "Ameisen-Glückwunsch", "Amalia", "der Auerhahn", "Dick und Dünn", "Unterhaltung", "Was denkt die Maus am Donnerstag?", "Hummel, gib acht!" und viele mehr.
Dinggedichte
Dinggedichte kann man in der Kinderlyrik kaum antreffen. Sie haben meist Symbolcharakter und sind für Kinder unter zehn bis zwölf Jahren kaum zu erfassen. Ich will trotzdem ein Beispiel bringen. Das bekannte Gedicht von Peter Härtling "Baiabong":
Baiabong - die Wiegenwaage wiegt den Reis und wiegt dich auf; singend wippt die Bambustrage, an der Seidenschnur der Tage, zählt sie dir dein Leben auf.
Baiabong - die Schüttelstunde schluckt den Schatten, wendet ihn.
Dieses Mittags stete Runde reibt die heiße Schulterwunde - baiabong:
Ich bin, ich bin.
(zit. in REGER 1990, S. 60)
Gedichte, die durchgängig problemfrei Kindsein thematisieren
In diesen Gedichten wird im Großen und Ganzen eine heile Kinderwelt repräsentiert: Kinder beim Spielen, Kinder und ihre Beziehung zu den Eltern. Diese Texte sollen unterhaltend wirken und/oder Freude bereiten. Mein Beispiel, wie schon so oft bisher, ist von James Krüss: "Der Frechdachs"
Ich zieh’ an jedem Mädchenzopf, und dann verdrück’ ich mich. Ich haue jeden auf den Kopf, der kleiner ist als ich.
Ich stelle jedem gern ein Bein und lauf’ dann einfach weg. Das Lieb- und Brav- und Artigsein, das hat ja keinen Zweck.
Ich bin ein echter Egoist, und frech von A bis Zett.
Doch treff’ ich wen, der stärker ist, dann bin ich lieb und nett.
(zit. in REGER 1990, S. 62)
Reflexionslyrik (Gedankenlyrik)
Dieser Bereich der Kinderlyrik bespricht Probleme, die personal und sozial Heranwachsenden im Bereich ihrer Umwelt entgegentreten. Die Texte wollen informieren, belehren, aufrütteln, herausfordern - ganz einfach zum Handeln anregen. Das meist besprochene Thema ist die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. In den Gedichten selber kann man Erziehungsstile oder - absichten des Autors, pädagogische Leitvorstellungen, Ziele, Trends oder Entwicklungen in diesen Bereichen erkennen. Für die Schule sind diese Gedichte also äußerst wichtig und bedeutsam. Bevor REGER (1990) mit Beispielen dieses Kapitel näher erläutern will, nennt er noch die drei Einstellungen, die Eltern in bezug auf ihre Kinder haben können:
- Das Kind muß sich anpassen, ist also rechtlos.
- Das Kind steht im Widerspruch zu seinen Eltern.
- Das Kind ist ein potentiell gleichberechtigter Partner der Eltern.
Themen, die im Rahmen der Gedankenlyrik bearbeitet werden, sind der Umweltschutz, Friedenserziehung, Ablehnung von Rassendiskriminierung und Gesellschaftskritik.
A, Bee, Cee, Dee,
Was tut nicht weh?
Fleißig und nett zu sein,
Zeitig im Bett zu sein,
A, Bee, Cee, Dee,
Das tut nicht weh.
(...)
(KRÜSS; zit. in REGER 1990, S. 65 f.)
Geschehnislyrik
Zu diesem Bereich zählen die Balladen, Erzählgedichte, Versfabeln, Moritaten und Bänkelsänge, wobei die beiden letzten nicht zur Kinderlyrik gezählt werden.
In den Texten der Geschehnislyrik werden menschliche Probleme, sowohl individuelle als auch gesellschaftliche, thematisiert und in einer erzählerischen Darstellung vorgetragen. Die Inhalte können differieren, entweder geht es um ein Erlebnis, um eine erfundene (fiktive) Begebenheit, um ein gesellschaftliches Ereignis oder um eine historische Gestalt.
Ich werde nun kurz auf die einzelnen Unterteilungen eingehen, wobei mein Hauptaugenmerk den Erzählgedichten gilt. Aus diesem Bereich habe ich auch meine Praxisbeispiele gewählt.
Balladen
Vom Inhalt her sind sie ähnlich gestaltet wie die Sagen - sie sind durch etwas Außergewöhnliches, Unglaubhaftes, Undurchschaubares bestimmt.
Einige Beispiele: "Der Fischer" (Goethe)
"Das Riesenspielzeug" (a. v. Chamisso)
"Barbarossa" (F. Rückert)
"Der Knabe im Moor" (A. v. Droste-Hülshoff)
Der Knabe im Moor
Oh, schaurig ists, übers Moor zu gehen,
wenn es wimmelt vom Heiderauche,
sich wie Phantome die Dünste drehn,
und die Ranke häkelt am Strauche;
Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
Wenn aus der Spalte es zischt und singt.
Oh, schaurig ists, übers Moor zu gehen,
Wenn es Röhricht knistert im Hauche.
(...)
(zit. in KRÜSS 1959, S. 266)
Erzählgedichte
Es gibt von dieser Gattung moderne und traditionelle und sie sind keine große Gruppe der Kinderlyrik. Der Unterschied zur Ballade ist der, daß es zu keiner dramatischen Zuspitzung der Geschehnisse kommt.
Bedeutsame Autoren, die eine Anzahl an Gedichten zu dieser Gattung schrieben, waren Britting, Brecht, K ä stner, Zuckmayer, Ringelnatz, R ü hmkorf, und noch einige andere.
Entstehungszeit kann man das Ende des Ersten Weltkrieges und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nennen. Typische Charakteristika sind die präzise, sachliche Darstellung, nicht selten die "negativen" Helden und eine engagierte, anklagende Zeitbezogenheit.
Einige bekannte Beispiele: "Zehn kleine Negerlein"
"Vogelhochzeit"
"Die Heinzelmännchen"
"Ladislaus und Komkarlinchen" (Anti-Held-Gedicht)
Angsthase - Pfeffernase
Manchmal rufen die Kinder auf dem Hof.
Was sie rufen, was sie rufen, find ich doof:
Angsthase, Pfeffernase!
Morgen kommt der Osterhase!
(...)
Jeder hat mal Angst, die Kinder in der Schule,
die Autofahrer und bestimmt auch du.
Daß ich mich manchmal fürchte, daß ich manchmal Angst hab,
und zwar ganz schlimme Angst: das geb ich offen zu.
(JO PESTUM; zit. in REGER 1990, S. 75)
Versfabeln
Sie sind ebenfalls eine kleine Textgruppe der Kinderlyrik. Als Inhalt haben sie, ein Bild der menschlichen Welt zu entwerfen. Sie besitzen eine große didaktische Wichtigkeit, weil sie eine Lehre vermitteln wollen (mit einem Anspruch auf Wahrheit und Gültigkeit - daher fordern sie Anerkennung und Anwendung). Zu den Inhalten gehören Lebensweisheiten und moralische Einsichten (Werte und Normen), die vermittelt werden wollen.
Beispiele: "Fink und Frosch" von Wilhelm Busch
"Das Huhn und der Karpfen" von Heinrich Seidel
Ebenfalls ein wichtiger Vertreter ist James Krüss, der mit seinen Gedichten zu einem vernünftigen Verhalten auffordern will, indem er menschliche Schwächen mit Humor aufzeigt und irgendwie klarmacht, daß die jeder besitzt.
Sprachspiele
Der Begriff "Sprachspiele" scheint in den Literaturwissenschaften noch nicht auf. Dort spricht man eher von "Unsinnpoesie", "komischer Versliteratur" und "konkreter Lyrik". Im Bereich der Sprachförderung allerdings ist der Begriff schon seit ungefähr zehn Jahren (1990) transparent. Sprachspiele regen die Kinder zu eigenem Gestalten an, außerdem werden die Schüler behutsam der Literatur näher gebracht.
In Sprachspielen wird experimentell mit Sprache gehandelt. Für Kinder ist das besonders reizvoll, weil es vom üblichen Sprachgebrauch abweicht und sie ja erst im Laufe der Zeit in die Sprachnormen hineinwachsen - so sind sie besonders aufgeschlossen für Verstöße gegen den normalen Gebrauch.
Sprachspiele laufen keineswegs ohne Regeln ab. Nur wer aufgrund der Sprachnormen die Spielregeln erfaßt, kann zum Mitspieler werden.
Sprachspiele laufen auf verschiedenen Eben ab:
- auf der graphischen Ebene
- auf der phonetischen Ebene
- auf der semantischen Ebene
- auf der poetologischen und stilistischen Ebene
Die eben genannten Ebenen dürften den meisten Lesern nicht unbekannt sein, daher werde ich auf eine tiefere Auseinandersetzung damit verzichten. Einige Beispiele will ich trotzdem noch bringen:
Formen der Vermittlung , Didaktik und Methodik
Medien
In früheren Zeiten, damit meine ich die Zeit vor dem Eintritt der technischen Medien in den Schulalltag, war die mündliche Vermittlung von Lyrik die einzige mögliche Form der Weitergabe. Heute ist dies ganz anders - technische Medien wie Tonbänder, Kassetten, Fernsehen, Film, Video und - inzwischen schon etwas aus der Mode gekommen - die Schallplatte sind aus dem Schulleben nicht mehr wegzudenken. Doch gerade die Kinderlyrik (und auch der Witz) werden trotz dieser Überflutung an Medien noch am häufigsten (im Vergleich zu anderen Literaturgattungen) mündlich weitergegeben. Spielende Kinder, Eltern mit ihren Kindern, Institutionen wie Kindergarten, Vorschule,... pflegen bewußt oder unbewußt den Bestand an Reimen und Gedichten. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr wohl auch Musikaufnahmen dieser Art von Lyrik. Udo Jürgens hat zum Beispiel Kindergedichte von James Krüss vertont, oder oft gibt es auch zu Büchern mit Gedichten die dazugehörigen Kassetten. Das Kinderlied nimmt hier weitaus den größten Raum ein.
Nach wie vor als wichtigstes schriftliches Medium ist aber immer noch das Buch zu sehen. Kinderlieder, -reime-, und -gedichte werden ständig überarbeitet und in neuen Auflagen wieder an Kinder und Interessierte weitergegeben.
Seit einigen Jahren kann man einen relativ neuen Trend in der Veröffentlichung von Kinderlyrik erkennen: Mundartgedichte und internationale Gedichte gewinnen an Bedeutung. Bei letzteren kommt natürlich das Problem der Übersetzung dazu, die am ehesten von Kinderlyrikern selbst in die Hand genommen werden sollte (Erich K ä stner , Hans Baumann, Josef Guggenmos, James Kr ü ss,...).
Beim Kauf von Kinderbüchern konnte man bisher leider eine neue Strömung erkennen, nämlich, daß immer mehr Eltern lieber zu den billigeren Taschenbüchern greifen als zu den originalen Büchern mit Bild und Text. Der Nachteil von Taschenbüchern ist meist die gekürzte Form wie auch das sparsame Verwenden von Illustrationen. Das Werk "So viele Tage, wie das Jahr hat" (1959) von James Krüss gibt es zum Beispiel als Taschenbuchausgabe mit dem Titel "Gedichte für ein ganzes Jahr" (1966). Trotzdem gibt es natürlich Eltern, Erzieher oder Lehrer, die sich Gedanken beim Kauf eines Buches machen, sprich, um die Wichtigkeit des Zusammenhanges von Bild und Text Bescheid wissen.
Eine Übermacht an Buchveröffentlichungen nimmt im Moment jene Sorte Bücher ein, die über einen gemischten Inhalt verfügen. Gedichte, Witze, Rätsel, kurze Spielideen werden dabei zwischen kurze Texte eingestreut und bringen so eine interessante Abwechslung.
Wenn man mit offenen Augen durch die Welt der Kinderliteratur geht, bemerkt man eigentlich, daß man fast überall Gedichten begegnen kann: auf Kalendern, in Zeitschriften oder Schülerzeitungen, auf Postern, auf Kinderseiten in Zeitungen,...
(FRANZ 1979, S. 128 ff.)
Didaktik und Methodik
0123
Sprechen
Gespräch
Sprachübung
Lesen- Erstlesen
- Weiterführendes Lesen
Schreiben
Verfassen von Texten
Rechtschreiben
Sprachbetrachtung
Didaktische Überlegungen und Begründungen
Das Kindergedicht ist eines der wichtigsten sprachlichen Medien im Vor- und Grundschulalter, weil es dem geistigen, sprachlichen und psychischen Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Das Kind hat Freude an den Wiederholungen, Übersteigerungen, Klängen, Rhythmen und es kommt dem Spielbedürfnis entgegen. Aufgabe des Lehrers ist hierbei die Differenzierung für die einzelnen Grundstufen (FRANZ/MEIER 1983, S. 69 ff.).
Hinweise zur Methode
"Weg vom Zerpflücken und Zerreden mit abstumpfender Wirkung zu ganzheitlichkindgemäßen, spielerisch-lockeren Arbeitsweisen (STEFFENS 1979, S. 17)."
FRANZ/MEIER (1983, S. 74 ff.) weisen darauf hin, daß in Bezug auf die Methode unbedingt bestimmte Kriterien beachtet werden müssen:
- Aspekte des Humors
- Aspekte des Sprechens
- Aspekte des Lesens
- Aspekte des kreativen Umgangs mit Sprache
Nun aber will ich zu den eigentlichen methodischen Möglichkeiten kommen, wobei in der Praxis meistens eine Mischform mehrerer Methoden sinnvoll ist (DERS., S. 74 ff.):
Methoden des Erlebens
Die Schüler sollten vor dem Kennenlernen eines neuen Gedichtes (und nicht nur bei Gedichten) in eine bestimmte Stimmungslage versetzt werden. Je nach Gedicht könnte dies Trauer, Freude, Mitleid,... sein. Auch während der Gedichtbegegnung sollte der Lehrer darauf achten, daß die Schüler mitfühlen, in das Gedicht hineinhorchen wollen. Der Lehrervortrag (auch das Tafelbild) sollten für die Schüler eine motivierende Wirkung haben.
Methoden der sprechgestaltenden Interpretation
Hierbei sollen die Schüler sprechgestaltendes Vortragen erlernen. Der Text wird Stück für Stück erarbeitet (sprachlich und ohne Druckbild für die Schüler), indem einfach der Reihe nach mehrere Schüler einen Versuch wagen, das Gedicht zu sprechen. Ohne Druckbild deshalb, weil sonst die Gefahr, daß der Leseton den Sprechvorgang beeinflußt, zu groß ist. Das zwanghafte Auswendiglernen eines Textes fällt weg, da er meistens automatisch nach einigen wenigen Wiederholungen gekonnt wird.
Methoden der Erfassung von Form und Inhalt
Natürlich gibt es viel zu viele Methoden, um alle zu nennen, außerdem ist das Thema zu komplex, um ein "Rezept" für den Unterricht zu geben. Zusätzlich sind Form und Inhalt kaum voneinander zu trennen bzw. getrennt voneinander zu betrachten. Die Voraussetzungen für die Erschließung von Form und Inhalt sind im Großen und Ganzen die Erlebnisfähigkeit und die Erarbeitung der sprecherischen Gestalt (siehe oben).
Methoden des Mit-, Vor- und Nachgestaltens
Mitgestalten: Die Schüler erarbeiten das Gedicht gemeinsam mit dem Lehrer, wobei sie immer wieder herauszufinden versuchen, wie es weitergehen könnte. So nähern sie sich in kleinen Schritten dem Endergebnis, was zu einer besseren Identifikation mit dem Gedicht führt. Der Lehrer kann entweder nur die Überschrift vorgeben oder einfach einen Vers oder eine Strophe weglassen.
Vorgestalten: Den Kindern ist hier noch mehr Freiraum gegeben. Sie erarbeiten zum Beispiel gemeinsam mit dem Lehrer Reimwörter auf eine bestimmte Endsilbe, die dann zu einem sinnvollen Gefüge zusammengepaßt werden. Erst zum Schluß wird das Ergebnis der Schüler mit dem Originalgedicht verglichen.
Nachgestalten: Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Die Schüler führen z. B. einen Kinderreim zu Ende, indem sie das letzte fehlende Reimwort ergänzen (Jung ist nicht alt, warm ist nicht ).
- Die Schüler erarbeiten zuerst (gemeinsam mit dem Lehrer) das metrische Schema eines Gedichtes, dann versuchen sie, dieses mit eigenen Worten auszufüllen. Natürlich können auch Teile übernommen werden ("Ich wollt ich wär’ ein...").
- Die Schüler übernehmen bestimmte syntaktische Elemente, die sie dann mit eigenen Wörtern verbinden.
- Die Schüler bekommen ein Gedicht, das ursprünglich in Verszeilen geschrieben war, nun aber als Prosatext vor ihnen liegt. Die Aufgabe ist es, die Verszeilen zu finden. Dabei erkennen die Schüler das Problem von Sprachrhythmus und Sprachwirkung. Später können sie versuchen, einen eigenen Prosatext in Verse umzusetzen.
Methoden des eigenen Verfassens von lyrischen Vorformen
Um diese Stufe mit Kindern zu erreichen, benötigen die meisten viel harte Vorarbeit. Dem Kind steht hier der größtmögliche Freiraum zu, den sie allerdings oft nicht zu nutzen wissen. Im Formulieren einfacher Reime allerdings sind Kinder sehr produktiv.
Möglichkeiten der Umsetzung
Da meine Hausarbeit den Titel des handlungs- und produktorientierten Umgangs mit Gedichten trägt, widme ich nun ein ganzes Kapitel den verschiedenen Möglichkeiten mit diesen. Ich habe wohl auch die restliche Hausarbeit nach diesen Schlagwörtern orientiert, aber eher im Hintergrund und diese Begriffe daher noch kaum verwendet. Meine Unterrichtsverläufe allerdings spiegeln eindeutig wider, worum es eigentlich geht.
Im Folgenden nun einige produktive Rezeptionstechniken, spielerische Verfahren, mit Texten zu hantieren, Aufgabenerstellungen von und für Schüler, Präsentationsformen von Gedichten und Gedichte als Schreibimpuls (Aufgabenstellungen dazu). Eine Aufzählung zu all diesen Bereichen stammt von IDE - Informationen zur Deutschdidaktik (4/93). Hauptsächlich werde ich auf jene Bereiche näher eingehen, die ich auch für meine Unterrichtsplanungen verwendet habe. Dieses Kapitel soll unter anderem erklären, wieso ich mich für diese oder jene Aktivität im Unterricht entschieden habe.
Der Zugang zu einem Text, die Präsentation des Lehrers, die Motivation, die der Lehrer ausstrahlt und die Tatsache, ob Schüler handelnd mit den Texten umgehen dürfen, entscheiden, ob der Schüler Interesse daran findet oder nicht. Um also bei den Schülern Anklang für das Thema "Gedichte" zu finden (das ist bei allen Themen so), muß ein guter Stundeneinstieg geschaffen werden. Zusätzlich müßten die Schüler genügend Zeit bekommen, außerdem an einem Ort arbeiten, der ihre Kreativität nicht einengt.
Produktive Rezeptionstechniken
Auch ich habe mich sehr stark damit beschäftigt und daher aus dem Bereich der produktiven Rezeptionstechniken folgende Aktivitäten ausgewählt, die die Schüler ausüben können, um das Gedicht aufzunehmen:
Das Gedicht wird schön, kalligraphisch bewußt (Farben, Buchstabengestaltung, Zeilenaufteilung) auf ein Blatt geschrieben (Unterrichtsverlauf zu den ABC-Gedichten).
In Gedichte Wörter einfügen, so daß sie fast nicht mehr zu erkennen sind (geplant zum Gedicht "Besuch"). REGER (1990, S. 232) schreibt dazu in seinem Buch, daß "fiktionale Texte jeder Art mündlich, schriftlich ausgestaltet werden können. Vor allem lediglich erwähnte oder auch ausgesparte Situationen, Szenen regen zu ergänzenden Ausgestaltungen an".
Zu einem Gedicht Fragen beantworten, die der Lehrer vorbereitet hat. Vergleiche mit meinen Unterrichtsplanungen:
Thema Krieg: "Kampf der Bienen und Hornissen" Thema Träume: "Zwerg"
Diese Fragen beinhalten eigentlich eine Lernzielkontrolle, denn wenn der Schüler die Fragen ausreichend beantworten kann, kann man davon ausgehen, daß er den Text verstanden hat. Diese "Tests" fallen laut REGER (1990, S. 222 f.) überraschend positiv auf, außerdem sind sie für die Schüler Erfolgserfahrungen. Diese Art der Textrezeption hat einen großen Vorteil: der Text wird, nach einmaligem Lesen, ständig wieder ins Bewußtsein geholt, um die Fragen beantworten zu können.
Eine Nacherzählung über den Inhalt des Gedichtes schreiben. Diese Form des Umgangs mit Texten (sie geht eigentlich schon über die Textrezeption hinaus) hat eine wichtige Bedeutung: Kinder, die Texte nacherzählen (Gedichte oder andere Texte), regen ihre Umwelt (Freunde, Spielgefährten, Mitschüler) dazu an, auch zur Lektüre zu greifen. Zusätzlich können unter diesem Aspekt gemeinsam (Lehrer und Schüler) Bücher für den Unterricht ausgesucht werden. Wenn ein Kind einen Text besonders gerne hat, kann es dies der Klasse nacherzählen und dann auf den Wunsch aller vielleicht zur Klassenlektüre werden lassen.
Spielerische Verfahren
Unterricht muß nicht todernst ablaufen. Spielen macht Spaß, wieso also auch nicht mit Gedichten, das heißt mit Sprache spielen? Es gibt Möglichkeiten, Neues zu entdecken, oft spielt der Zufall dabei eine große Rolle. Ich habe mich in meinen Unterrichtsverläufen für folgende Aktivitäten entschieden:
In einem Gedicht jedes Substantiv durch das 7. ersetzen, das ihm in einem beliebigen Wörterbuch folgt. Dabei ist das neue Wort grammatikalisch an den Kontext anzupassen (vergleiche Planung zum Gedicht "Zwerg").
Kindern im Volksschulalter macht es Spaß, Unsinntexte zu erfinden. Bei dieser Art des produktiven Handels kann man "mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagen": Kinder finden Freude daran, der Gebrauch des Wörterbuches wird gefestigt, die Grammatik wird geübt, indem neue Wörter in das vorhandene Grammatikgebilde eingefügt werden müssen.
Viele klassische Texte sind durch Abschreiben erweitert worden. Schmuggle nun auch du irgendwelche Wörter in jede Gedichtzeile ein (Gedicht "Besuch").
In einem Lückentext die fehlenden Wörter finden.
Diese Form ist wohl die einfachste des lyrischen Mitgestaltens (sofern man es als solches Bezeichnen kann, weil auch die gesuchten Wörter genau in den Kontext passen müssen und daher immer nur eines möglich ist). Aber Kinder (schon ab der ersten Schulstufe) betreiben es mit Freude, die fehlenden Wörter zu ergänzen. Wenn es die Möglichkeit gibt, verschiedene Wörter einzusetzen, bereitet dies ebenfalls eine große Freude, weil man die Ergebnisse untereinander vergleichen kann.
Ein Gedicht zeilenweise an die Tafel schreiben. Nach jedem Vers haben die Leser Gelegenheit zu vermuten, wie es wohl fortgesetzt wird.
Bearbeitungsaufgaben
Die Schüler werden einfach dazu angehalten, sich mit dem Text intensiver auseinanderzusetzen. Dies kann in Einzel- oder in Partnerarbeit von sich gehen.
Ein Gedicht ohne Schluß auf ein Blatt kopieren und einen oder mehrere Schlüsse schreiben lassen.
Diese Möglichkeit habe ich etwas abgewandelt in meiner Stunde zum Gedicht "die Feder" verwendet: Die Schüler bekommen ein Arbeitsblatt ausgehändigt, auf dem das ganze Gedicht steht - allerdings gibt es zu jedem Zeilenende vier Möglichkeiten der weiteren Gestaltung. Die Schüler können selber entscheiden, ob sich ihr eigenes Gedicht reimen soll oder nicht, von welchem Ding eigentlich handelt und was dieses Ding erlebt. Alle Schüler bekommen die gleiche Aufgabenstellung, trotzdem gibt es unzählige Möglichkeiten der Ausführung.
Präsentationsformen
Viele Gedichte sind Vorlagen für Komponisten gewesen, andere Gedichte sind sogar erst durch deren Vertonung berühmt geworden. Jede Vertonung hängt mit einer intensiven Auseinandersetzung und einer darauffolgenden Interpretation zusammen: Spannung kann erzeugt werden, Gefühle können dargestellt,...
Der Mensch nimmt seine Umwelt hauptsächlich durch den Sehsinn war. Andere Sinne (Gehör, Tastsinn,...) werden oft vernachlässigt. Deshalb wäre es von Vorteil, zum Beispiel ein Gedicht seinen Zusehern so zu präsentieren, daß viele verschiedene Kanäle der Wahrnehmung angesprochen werden. Möglichkeiten dazu folgen in Kürze: Ein Gedicht allein oder mit Partner in einer kurzen pantomimischen Szene darstellen.
Zu diesem Bereich habe ich auch einfach jene Gedichtpräsentationen gezählt, bei denen die Schüler den Text sprechen und dazu bestimmte Bewegungen ausführen ("Begegnung", "Was Tiere können", ). Auch REGER (1990, S. 244 ff.) spricht sich eindeutig für das szenische Darstellen von Gedichten aus.
Ein Gedicht wird bildlich gestaltet: gezeichnet, gemalt oder collagiert, mit eingearbeitetem Text oder ohne.
Das bildliche oder graphische Gestalten eines Textes führen die meisten Schüler mit großer Begeisterung aus (hiermit stimme ich mit REGER überein).
Daß das Gestalten eines Textes Kindern wirklich Spaß bereitet und sie mit Eifer bei der Sache sind, habe ich selber erlebt:
Mit dem Gedicht "im Bett" von Josef Guggenmos (Planung und Ergebnisse der Schüler sind im Anhang zu finden) bin ich auf große Begeisterung gestoßen: Die einzelnen Unterrichtssequenzen wechselten zwischen Belebung und Beruhigung ab, so daß die Schüler zwar das Gefühl hatten, sich ausleben zu dürfen, aber sehr wohl wußten, wann es genug ist und wieder eine Phase der Ruhe eintritt. Während dem "Vorschreiben" des Gedichtes war ein bestimmter Arbeitslärm gestattet, die Schüler durften auch ihre Plätze verlassen. Als es dann aber darum ging, das Gedicht graphisch schön zu gestalten, bemerkten die meisten Schüler, daß sie dafür Ruhe und Konzentration brauchen. Viele Arbeiten gelangen einwandfrei.
Gedichte als Schreibimpuls - Schreibaufgaben
Diese Aufgaben regen den Schüler an, selber kreativ zu schreiben. Es sind zwar bestimmte Rahmenbedingungen vorgegeben, in denen kann der Schüler aber frei handeln.
- Ein Zeitungsmeldung über ein Gedicht schreiben. Das Gedicht "Besuch" eignet sich sehr gut, daraus einen Zeitungsartikel zu schreiben. In den Zeitungen kann man täglich nachlesen, wer wenn wo und warum besucht. Meistens geht es zwar um Politiker oder andere Berühmtheiten(Schauspieler,...), aber wieso sollte nicht auch einmal ein Riese bei jemandem zu Gast sein. Ich glaube, daß es den Schülern Spaß bereitet, so einen Artikel zu schreiben. Auf der einen Seite, weil sie sich ein bißchen wie Reporter fühlen, auf der anderen Seite, weil sie dabei ihre Phantasie spielen lassen und erfundene Tatsachen beschreiben können.
- Ein eigenes Gedicht mit derselben Struktur wie die Vorlage schreiben. Die Gedichte "die Feder", "im Bett", "Was Tiere können", "Was ich mag/Was ich nicht mag-ABC" habe ich dazu verwendet, die Schüler eigene Ideen in vorhandene Strukturen einbauen zu lassen. Zu diesem Punkt habe ich in REGER 1990, S. 240 f.) eine Bestätigung dieser Art von Methode gefunden: "Mädchen und Jungen sind bereits im Primarstufenalter fähig, Texte aller Gattungsarten der Kinderlyrik nachzugestalten, wenn speziell auf Reimverwendung verzichtet wird. Methodisch empfehlen sich hierfür sämtliche Sozialformen des Unterrichts."
Diese Aufzählung von Möglichkeiten ist noch lange nicht komplett, eine Fortsetzung dieser wäre bis ins Unendlich möglich. Weitere Vorschläge sind jederzeit bei REGER (1990), FORYTTA/HANKE (1991), FRANZ (1979) und noch einigen anderen nachzulesen.
Literaturverzeichnis
Didaktische Literatur zur Kinderlyrik und andere Behelfe
CORDES, Roswitha (Hrsg.): Lyrik für Kinder und junge Leute. Schwerte 1988.
DUDEN (Mannheim: Bibliographisches Institut), Bände aus der Reihe
Die deutsche Rechtschreibung. 21. Aufl. 1996.
Das Fremdwörterbuch. 5. Aufl. 1990.
FORYTTA, Claus; HANKE, Eva: Lyrik für Kinder - gestalten und aneignen. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1991.
FRANZ, Kurt: Kinderlyrik. München 1979.
FRANZ, Kurt; MEIER, Bernhard: Was Kinder alles lesen. 3. Aufl. München 1983.
GERSTNER-HIRZEL, E.: Das Kinderlied. In: BREDNICH, L. u. a.: Handbuch des Volkslieds I. München 1973.
GIEHRL, Hans E.: Der junge Leser. Donauwörth 1972.
IDE - Informationen zur Deutschdidaktik 4/93
LEHRPLAN der Volksschule. Ausgabe für das Bundesland Steiermark. Graz 1992.
REGER, Harald: Kinderlyrik in der Grundschule. Baltmannsweiler 1990.
STEFFENS, Wilhelm u. a.: Das Gedicht in der Grundschule. 3. Aufl. Frankfurt am Main 1979.
Kinderlyrik - Einzelwerke, Anthologien, in Sammelbänden zur Kinderliteratur
ANDRESEN, Ute: Versteh mich nicht so schnell. Gedichte lesen mit Kindern. Berlin 1992.
BACHMANN, F. u. a.: Klang, Reim, Rhythmus - Gedichte für die Grundschule. 3. Aufl. Frankfurt am Main 1978.
DIRX, Ruth; SEELIG, Renate: Kinderreime. Frankfurt 1987.
ENZENSBERGER, H. M.: Allerleirauh. Viele schöne Kinderreime. Frankfurt am Main 1971.
DOMENGO, H. u. a.: Das Sprachbastelbuch. Wien/München 1977.
GELBERG, Hans-Joachim: Überall und neben dir. Gedichte für Kinder. Weinheim/Basel 1986, 1994.
GUGGENMOS, Josef: Was denkt die Maus am Donnerstag? 10. Aufl. München 1978.
GUGGENMOS, Josef: Sonne, Mond und Luftballon. Gedichte für Kinder. Weinheim/Basel 1984.
HARRANTH, Wolf; SORMANN, Christine: Im Pfirsich wohnt der Pfirsichkern. Gedichte für Kinder. Wien 1994.
JATZEK, Gerald: Der Lixelhix. Wien/München 1986.
KNORR, Ernst - Lothar; SCHERBER, Paul Friedrich: Kinderlieder. Eine Auswahl der schönsten Kinderlieder in Wort und einstimmiger Melodie. Stuttgart 1959.
KRÜSS, James: So viele Tage, wie das Jahr hat. Gütersloh 1959.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text ist eine umfassende Typologie der Kinderlyrik, inklusive Didaktik und Methodik der Vermittlung. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, Definitionen wichtiger Begriffe, eine Analyse der Entstehung und Entwicklung der Kinderlyrik, eine Beschreibung ihrer Elemente und Merkmale, eine thematische Einteilung und konkrete Anleitungen zur Umsetzung im Unterricht.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in folgende Hauptpunkte: 1. Typologie der Kinderlyrik, 2. Formen der Vermittlung, Didaktik und Methodik, 3. Möglichkeiten der Umsetzung, 4. Literaturverzeichnis.
Welche Definitionen wichtiger Begriffe werden gegeben?
Der Text definiert Begriffe wie Kinderlyrik, Kinderreim, Kindergedicht, Kinderlied, Text und Funktion im Zusammenhang mit Kinderlyrik. Er erklärt auch die Lesemotivationen von Kindern und Jugendlichen.
Was sind die wesentlichen Elemente und Merkmale von Kindergedichten?
Zu den Elementen und Merkmalen von Kindergedichten zählen der Klang der Wörter, der Reim, der Rhythmus, Bilder, eine geschlossene Form (Verse und Strophen), ein optimistischer Grundtenor und ein niedriger Abstraktionsgrad.
Wie werden Kindergedichte thematisch eingeteilt?
Kindergedichte werden thematisch unterteilt in: Kommunikationsbereich Familie, Kinder und ihre Alterspartner, Kinder und Erwachsene, Kinder und Natur, Arbeitswelt, Erwachsene unter sich (kritische Öffentlichkeit), Kinder und Sprache (Sprachspiele).
Welche Kategorien der Kinderlyrik werden unterschieden?
Die Kinderlyrik wird in folgende Kategorien unterteilt: Gebrauchsverse, Erlebnis- und Stimmungslyrik, Reflexionslyrik (Gedankenlyrik), Geschehnislyrik und Sprachspiele.
Welche Unterarten von Gebrauchsversen werden genannt?
Zu den Gebrauchsversen zählen Nachahme- und Deutreime, Brauchtumslieder, Kindergebete, Abzählreime, Albumverse, Kinderstubenreime, Neckreime, Spottreime, Ulkreime, Trotzreime und Lieder zu Spielen und Tänzen.
Was versteht man unter Erlebnis- und Stimmungslyrik?
Die Erlebnis- und Stimmungslyrik umfasst Naturgedichte, Tiergedichte, Dinggedichte und Gedichte, die problemfrei Kindsein thematisieren.
Was beinhaltet die Reflexionslyrik (Gedankenlyrik)?
Die Reflexionslyrik behandelt Probleme, die personal und sozial Heranwachsenden im Bereich ihrer Umwelt entgegentreten, wie z.B. Umweltschutz, Friedenserziehung, Ablehnung von Rassendiskriminierung und Gesellschaftskritik.
Welche Formen gehören zur Geschehnislyrik?
Zur Geschehnislyrik gehören Balladen, Erzählgedichte und Versfabeln.
Welche Medien werden zur Vermittlung von Kinderlyrik genannt?
Genannt werden mündliche Überlieferung, Tonbänder, Kassetten, Fernsehen, Film, Video, Schallplatten und vor allem das Buch.
Welche didaktischen und methodischen Aspekte werden behandelt?
Behandelt werden didaktische Grundsätze für die Grundschule (Lehrplan), didaktische Grundsätze im Deutschunterricht, didaktische Überlegungen und Begründungen, Hinweise zur Methode (Methoden des Erlebens, der sprechgestaltenden Interpretation, der Erfassung von Form und Inhalt, des Mit-, Vor- und Nachgestaltens, des eigenen Verfassens von lyrischen Vorformen).
Welche Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht werden vorgeschlagen?
Vorgeschlagen werden produktive Rezeptionstechniken, spielerische Verfahren, Bearbeitungsaufgaben, Präsentationsformen und Gedichte als Schreibimpuls (Schreibaufgaben).
Was beinhaltet das Literaturverzeichnis?
Das Literaturverzeichnis listet didaktische Literatur zur Kinderlyrik und andere Behelfe sowie Kinderlyrik-Einzelwerke, Anthologien und Sammelbände zur Kinderliteratur auf.
- Quote paper
- Christine Heitzinger (Author), 1997, Handlungs- und produktorientierter Unterricht mit Gedichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95673