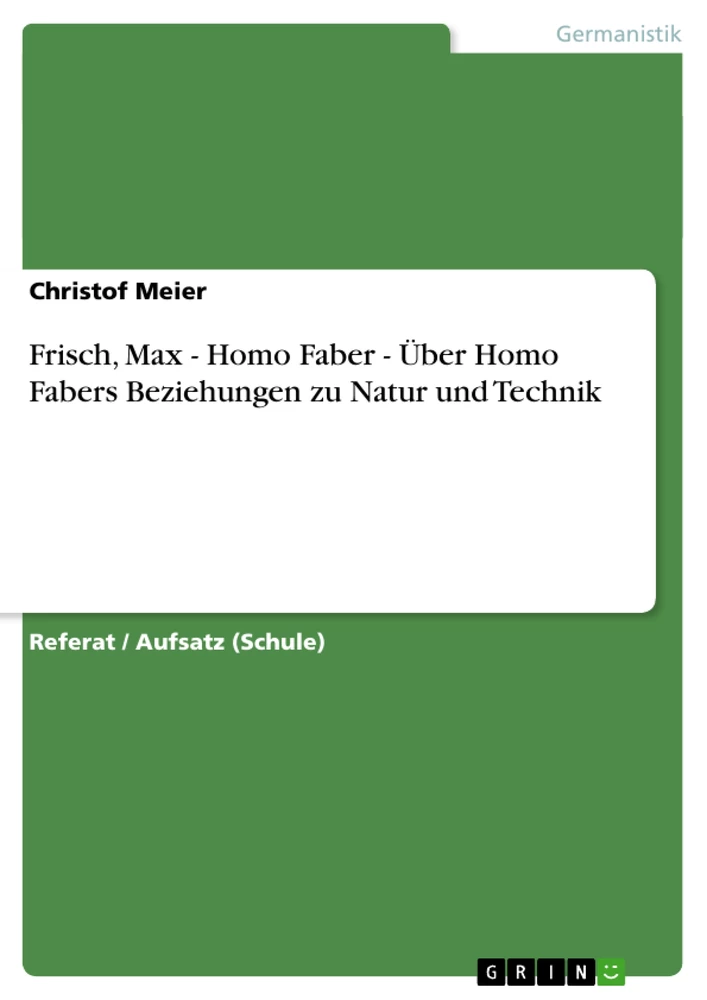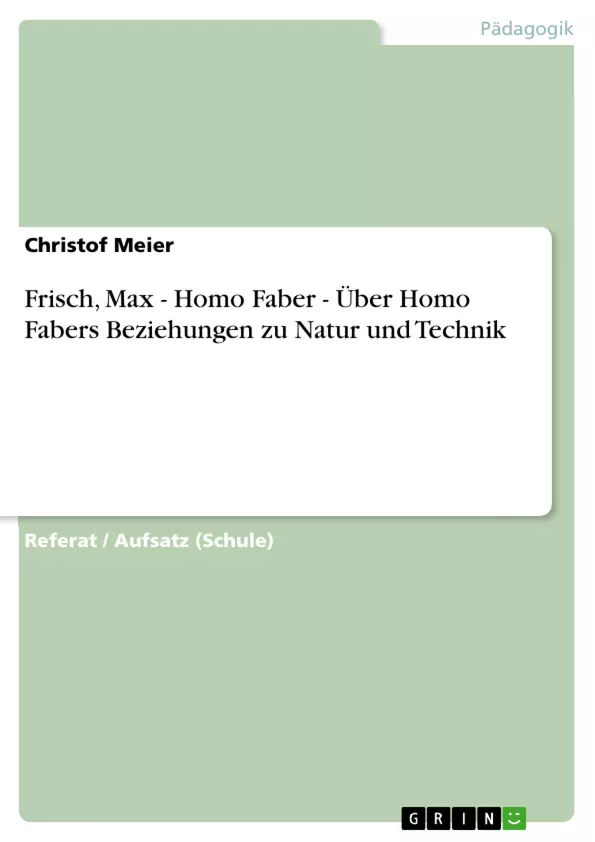Was, wenn die vermeintliche Ordnung der Technik im Chaos des Lebens zerbricht? Max Frischs "Homo Faber" ist mehr als nur ein Roman – es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den fundamentalen Fragen der menschlichen Existenz im Zeitalter der Technologie. Walter Faber, der Ingenieur, verkörpert den rationalen, technokratischen Menschen, der sich in einer Welt von Berechenbarkeit und Kontrolle eingerichtet hat. Doch seine vermeintlich sichere Welt gerät ins Wanken, als das Schicksal ihn auf eine Reise schickt, die ihn mit seiner Vergangenheit, seinen verdrängten Gefühlen und der unberechenbaren Kraft der Natur konfrontiert. Eine Reise, die ihn zwingt, seine starren Überzeugungen zu hinterfragen und sich der Möglichkeit eines Lebens jenseits von Algorithmen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu öffnen. Im Zentrum steht Fabers ambivalentes Verhältnis zur Natur, die er einerseits verachtet und fürchtet, andererseits aber auch auf subtile Weise faszinierend findet. Seine Vergötterung der Technik dient ihm als Schutzschild gegen die Unberechenbarkeit des Lebens, doch dieser Schutzmechanismus beginnt zu bröckeln, als er sich in einer Reihe von schicksalhaften Ereignissen wiederfindet, die ihn zwingen, sich seinen Ängsten und seiner eigenen Sterblichkeit zu stellen. "Homo Faber" ist eine packende Geschichte über Selbstentdeckung, Liebe und Verlust, die den Leser dazu anregt, über die Rolle der Technik in unserem Leben und die Bedeutung von Menschlichkeit, Intuition und dem Akzeptieren des Unvorhersehbaren nachzudenken. Ein zeitloser Klassiker der Schweizer Literatur, der auch heute noch brandaktuell ist und zum Nachdenken über unsere moderne, technologiegetriebene Welt anregt. Die Themen sind Technik, Natur, Entfremdung, Identität, Liebe und Tod, und die Geschichte spielt in einer globalisierten Welt der Nachkriegszeit. Ein Muss für alle, die sich für philosophische Fragen und die Herausforderungen des modernen Lebens interessieren und bereit sind, sich auf eine intellektuelle und emotionale Reise mit einem komplexen und widersprüchlichen Protagonisten einzulassen. Frischs präzise Sprache und die subtile Ironie machen "Homo Faber" zu einem unvergesslichen Leseerlebnis, das lange nachwirkt.
Arbeit über Homo Faber von Max Frisch
Über Homo Fabers Beziehungen zu Natur und Technik
Christof Meier, Ettingen, CH,
Schon der Titel des Werkes „Homo Faber, ein Bericht“ zeigt, dass die Themen ‚Technik und Natur‘ in diesem Werk von Max Frisch eine wichtige Rolle spielen: ‚homo‘, der lateinische Ausdruck für ‚Mensch‘, welcher vor allem in historischen und naturwissenschaftlichen Bereichen zur Verwendung kommt, bezeichnet den Aspekt der Natur. ‚faber‘ kommt vom griechischen und bedeutet ‚Verfertiger, Künstler‘ aber auch ‚Handwerker‘, Sinnbild also für den Techniker, welcher durch Walter Faber verkörpert wird. Ausserdem handelt es sich um einen Bericht und keine Beschreibung oder Interpretation.
Über Fabers Abneigung der Natur gegenüber
Walter Faber sieht in der Welt einen starken Antagonismus zwischen Natur und Technik. Er ist davon überzeugt, dass die natürliche Welt der technischen unterlegen ist:
Ich habe sie immer gefürchtet; was man auch dagegen tut: ihre [der Zähne] Verwitterung. Überhaupt der ganze Mensch! - als Konstruktion möglich, aber das Material ist verfehlt: Fleisch ist kein Material, sondern ein Fluch!… (S. 171/595)*
In seinen Argumentationen widerspricht sich Faber oft, beziehungsweise lässt er durchschimmern, dass eine gewisse Faszination und Wertschätzung der Natur sehrwohl vorhanden ist, welche er aber verdrängt. So anerkennt er zwar die Konstruktion ‚Mensch‘, ist aber mit dem Material nicht zufrieden, obwohl es sich im Verlauf der Evolution bewährt hat. Die Tatsache, dass der Körper nicht von einem Menschen errichtet worden ist und dass er deshalb von niemandem (vor allem von ihm nicht) verstanden und beherrscht werden kann, hindert ihn daran, den Menschen als faszinierendes Werk der Natur zu betrachten. Dieses Gefühl der Unterlegenheit quält Walter Faber, er würde sich statt als Baustein lieber als Bauherr sehen. (Dieser Meinung ist übrigens auch Hanna; bei einer Diskussion mit Faber erwähnt sie die Manie des Technikers, die Schöpfung nutzbar zu machen, weil er sie als Partner nicht aushält [...] (S. 169/593))
Besonders deutlich wird diese Unterlegenheit, als Faber auf der Reise zu Joachims Plantage den schützenden Rahme n der Zivilisation langsam verliert und in einen Bereich gerät, in dem sich Natur ungehindert vollzieht. Voll Abscheu registriert er die Allgegenwart von Zeugung und Verwesung:
[...] dies Fortpflanzererei überall, es stinkt nach Fruchtbarkeit, nach blühender Verwesung. Wo man hinspuckt, keimt es. (S. 51/475)
Als besonders erschreckend empfindet er die fliessenden Übergänge, die keine klaren (technischen) Trennungen zulassen. Das Ineinanderfliessen von werden (Blühen) und Vergehen (Verwesen), von Leben und Tod. Mit Feuer, der völligen Vernichtung, die beispielsweise bei mittelalterlichen Hexenverbrennungen als ‚reinend‘ galt, will er der ekelerregenden Natur eine Grenze setzen:
Feuer ist eine saubere Sache, Erde ist [...] Verwesung voller Keime, glitschig wie Vaseline, Tümpel im Morgenrot wie Tümpel von schmutzigem Blut, Monatsblut, Tümpel voller Molche, nichts als schwarze Köpfe mit zuckenden Schwänzchen wie ein Gewimmel von Spermazoten, genau so - grauenhaft. (Ich möchte kremiert werden!) (S. 68/492)
Da Faber selbst glaubt, an Krebs, einer unheilbaren, d.h. vom Menschen nicht kontrollierbaren Krankheit zu leiden, kann er die Überlegenheit der Natur nicht ohne weiteres akzeptieren. Deshalb versucht er auch die Angst vor dem Tod mit Hilfe der Statistik zu bändigen. Hanna, welche mehr die gefühlsbetonten, mystischen Seiten hat, und von Faber sinnigerweise auch
‚Kunstfee‘ genannt wird, meint nach Sabeths Einlieferung ins Spital folgendes dazu:
„Du mit deiner Statistik! [...] Wenn ich hundert Töchter hätte, alle von einer Viper gebissen, dann ja! Dann würde ich nur drei bis zehn Töchter verlieren. Erstaunlich wenig! Du hast vollkommen recht.“ (S. 136/560)
Auch beim Auffinden von Joachims Leiche verdrängt Faber die Vergänglichkeit und den Tod. Die ersten Gedanken gehören den Fakten des Selbstmordvorgangs (Er hatte es mit einem Draht gemacht) und dem laufenden Radio (Es wunderte mich, woher sein Radio [...]den elektrischen Strom bezieht [...].) und eine seiner ersten Tätigkeiten war es, den Toten Freund zu fotografieren (Wir fotografierten und bestatteten ihn. (alle S.56/478)). Keine Anzeichen von Trauer: Faber fährt mit den Ausführungen über die Loyalität der Indios fort. Auch Professor O.‘s Tod wird nur am Rande erwähnt.
Über Fabers Vergötterung der Technik
Gerade weil sich Walter Faber der Natur nicht gewachsen fühlt, versucht er in der Welt der Technik Mittel zu finden, die Übermacht der Natur zu verdrängen und zu verdecken. Ein Beispiel dafür ist seine Bartstoppel-Phobie:
Ich fühle mich nicht wohl, wenn unrasiert; nicht wegen der Leute, sondern meinetwegen. Ich habe das Gefühl, ich werde etwas wie eine Pflanze, wenn ich nicht rasiert bin, und ich greife unwillkürlich nach meinem Kinn. (S. 27/451)
Wie oben schon erwähnt, nennt er Hanna eine Schwärmerin und Kunstfee, sich bezeichnet er im Gegensatz dazu als Typ, der mit beiden Füssen auf der Erde steht (alle S. 47/471). Realitätssinn und Kunstverständnis sind für Faber, vor allem vor und zu Beginn seiner Beziehung mit Sabeth, unvereinbare Grössen, künstlerische Produktionen lediglich ein primitiver Vorläufer der Technik:
[...] ich habe aber keine Lust, davon zu sprechen, und sagte lediglich, dass Skulpturen und derartiges nichts anderes sind (für mich) als Vorfahren der Roboter. Die Primitiven versuchten den Tod zu annullieren, indem sie den Menschenleib abbilden - wir, indem wir den Menschenleib ersetzen. Technik statt Mystik. (S. 77/501)
Die menschlichen Gefühle sieht Faber als Störfaktoren der technischen Welt:
Vor allem aber: die Maschine erlebt nichts, sie hat keine Angst und keine Hoffnung, die nur stören, keine Wünsche in bezug auf das Ergebnis, sie arbeitet nach der Logik der Wahrscheinlichkeit, [...]. (S. 75/499)
Der Mensch, einst Krone der Schöpfung, erscheint im Vergleich zur Maschine als mangelhaftes Produkt. Infolgedessen möchte Faber an der Idealität der Technik teilzuhaben, indem er ihr möglichst ähnlich zu werden versucht und alles unterdrückt, was ihn an einem reibungslosen mechanischen Funktionieren hindert. So verwendet er als Vorbild seiner Augen die Kamera, die vor keinem Objekt erschrickt oder sich daran erfreut.
Ich habe mich schon oft gefragt, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie von Erlebnis reden. Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich sehe alles wovon sie reden, sehr genau; ich bin ja nicht blind. (S. 24/448)
Faber sieht die Umgebung nicht an, sondern überlässt den Blick darauf seiner Kamera. Auch dies ist ein Versuch, immer sachlich zu sein und zeigt, dass es ihm nichts bedeutet, sich in einem lebendigen Zusammenhang mit der Welt zu betrachten. Er reduziert die Welt und auch sich selbst (was auch im ‚reduzierenden Schreibstil‘ zum Ausdruck kommt), auf das objektiv Wahrnehmbare, Benennbare und Messbare, da nur so die Illusion aufrechtzuerhalten ist, die Bewegungen in dieser Welt und seine eigenen Handlungen darin seien berechenbar und insofern kontrollierbar.
Während sich Mystisches und Sinnliches negieren, Kunst ignorieren und die Welt zur Not auf Messbares reduzieren lässt, kann Faber im Kontakt mit Menschen, vor allem mit Frauen, seinen und ihren Gefühlen nicht aus dem Weg gehen. Er liebt diesen Kontakt (bis zu seinem Verhältnis mit Sabeth) grundsätzlich nicht:
[...] es ekelt mich ihre [Ivys] Zärtlichkeit, ihre Hand auf meinem Knie, ihr Arm auf meiner Schulter, ihre Schulter an meiner Brust, ihr Kuss, wenn ich Wein einschenkte, es war unerträglich. (S. 62/486)
Er sehnt sich spätestens nach drei Wochen nach Turbinen. (S. 91/515)
Über Fabers Entwicklungen im Bezug auf Technik und Natur
Wenn Faber im Verlauf der Handlung durch seine Liebe zu Sabeth zunehmend an Menschlichkeit gewinnt, fängt er an, die Fähigkeit des lebendigen Wahrnehmens zu erlernen und zu trainieren. Die beiden Liebenden wetteifern darin, passende Vergleiche für das zu finden, was sie sehen. Das Wieher eines Esels in der Nacht:
Wie der erste Versuch auf einem Cello! findet Sabeth, ich finde: Wie eine ungeschmierte Bremse! (S. 151/575)
Obwohl Fabers Vorschläge, im Gegensatz zu denjenigen von Sabeth, immernoch seine Realitätsnähe und Technikverbundenheit wiederspeigeln, zeigt er, dass er Gegebenes jetzt auch mit Erinnerungen, Gefühlen und Phantasie verknüpfen kann.
Auch kann Faber dann die Natur bewusst wahrnehmen und geniessen:
Wir hatten unsere Schuhe ausgezogen, unsere blossen Füsse auf der warmen Erde, ich genoss es, barfuss zu sein, und überhaupt. (S. 116/540)
Letztlich verändert sich Walter Faber auch im Bezug auf seinen Körper und seine sexuellen Gefühle. So kann er in Kuba, während der Verarbeitung der Inzestliebe und deren tragisches Ende, seine Begierde ohne Abscheu wahrnehmen:
[...] draussen das Girl, das im Korridor putzt und singt [...]. Meine Begierde - Warum kommt sie nicht einfach! (S. 173/597)
Faber wird also im Verlauf seines Berichtes vom Roboter, den er zu sein wünschte immer mehr zu einem menschlichen Wesen - leider bleibt ihm wahrscheinlich nur noch wenig Zeit, diese Seiten seiner Natur richtig auszuleben und zu geniessen.
Mit der Darstellung von Homo Faber kritisiert Max Frisch den ungebremsten Glaube in die Technik, der vor allem während des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem 2. Weltkrieg besonders ausgeprägt war. Doch auch heute noch ist die Überzeugung, dass wir die Natur beherrschen müssen und das die Technik das einzige Mittel dazu ist, sehr stark verbreitet und macht sich allzuoft bemerkbar. Das Scheitern von Faber und die Tatsache, dass er umdenken muss, zeigt, dass dieser Weg eine Sackgasse ist.
Häufig gestellte Fragen
- Worum geht es in dem Text "Arbeit über Homo Faber von Max Frisch"?
-
Der Text ist eine Analyse von Max Frischs "Homo Faber", die sich hauptsächlich auf die Beziehung zwischen dem Protagonisten Walter Faber und den Konzepten von Natur und Technik konzentriert. Es wird untersucht, wie Faber die Natur ablehnt und die Technik vergöttert, und wie sich seine Perspektive im Laufe der Geschichte verändert.
- Welche Rolle spielt die Technik in Fabers Leben?
-
Faber sieht die Technik als überlegen gegenüber der Natur. Er versucht, die natürliche Welt durch Technik zu kontrollieren und zu ersetzen. Er idealisiert Maschinen, da sie keine Emotionen haben und rein logisch funktionieren.
- Wie steht Faber zur Natur?
-
Faber hat eine tiefe Abneigung gegen die Natur, die er als chaotisch, unkontrollierbar und ekelerregend empfindet. Er sieht in ihr einen Gegensatz zur Ordnung und Präzision der Technik.
- Wie verändert sich Fabers Beziehung zur Natur und zur Technik im Laufe der Geschichte?
-
Durch seine Beziehung zu Sabeth beginnt Faber, die Natur bewusster wahrzunehmen und zu genießen. Er entwickelt auch eine größere Wertschätzung für menschliche Gefühle und die lebendige Wahrnehmung. Er wandelt sich vom Roboterhaften zum Menschlichen.
- Was kritisiert Max Frisch mit der Darstellung von Homo Faber?
-
Frisch kritisiert den ungebremsten Glauben an die Technik und die Überzeugung, dass die Natur beherrscht werden muss. Das Scheitern von Faber zeigt, dass dieser Weg eine Sackgasse ist.
- Was bedeutet der Titel "Homo Faber, ein Bericht"?
-
"Homo" (Mensch) steht für den Aspekt der Natur, während "Faber" (Verfertiger, Handwerker) den Techniker symbolisiert. Die Bezeichnung "Bericht" deutet auf eine objektive Darstellung ohne subjektive Interpretation hin.
- Warum hat Faber Angst vor seinem eigenen Körper?
-
Faber sieht seinen Körper als fehlkonstruiert, weil er aus Fleisch besteht, welches er als Fluch empfindet. Er hasst, dass er seinen Körper nicht kontrollieren kann, wie er eine Maschine kontrollieren kann.
- Was symbolisiert das Feuer für Faber?
-
Feuer symbolisiert für Faber Sauberkeit und Vernichtung, im Gegensatz zur Verwesung in der Erde. Er will im Falle seines Todes kremiert werden.
- Wie steht Hanna zu Fabers Technikgläubigkeit?
-
Hanna kritisiert Fabers Technikgläubigkeit und seine Manie, die Schöpfung nutzbar zu machen. Sie hält ihn für unfähig, die Natur als Partner zu akzeptieren.
- Wie geht Faber mit dem Tod um?
-
Faber verdrängt den Tod und die Vergänglichkeit. Er konzentriert sich auf Fakten und technische Details anstatt Trauer zu zeigen.
- Quote paper
- Christof Meier (Author), 1999, Frisch, Max - Homo Faber - Über Homo Fabers Beziehungen zu Natur und Technik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95655