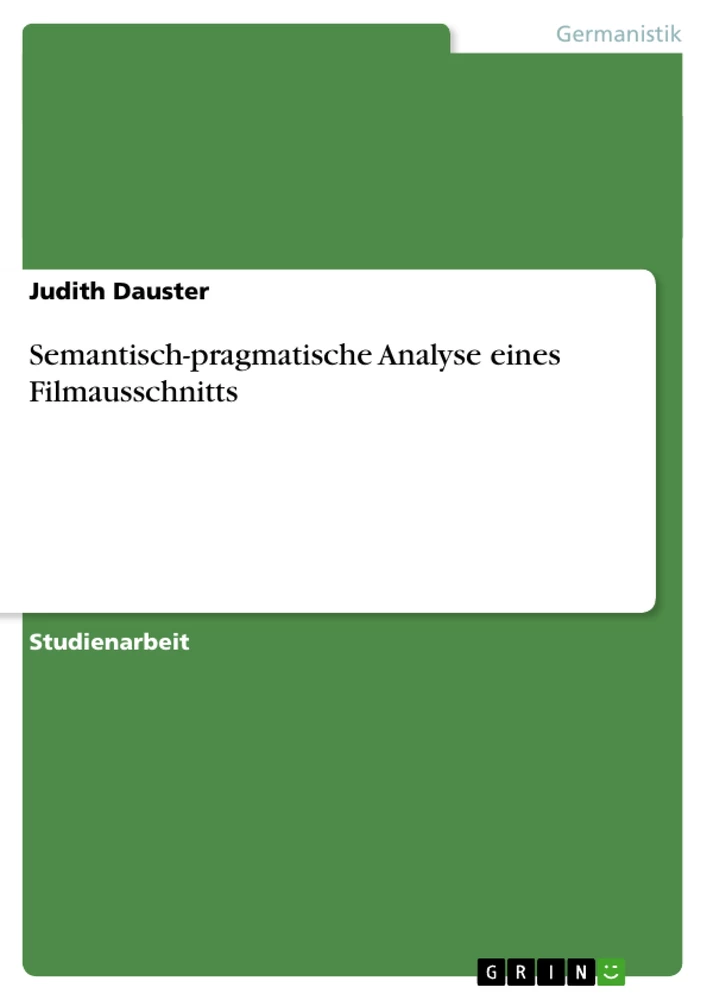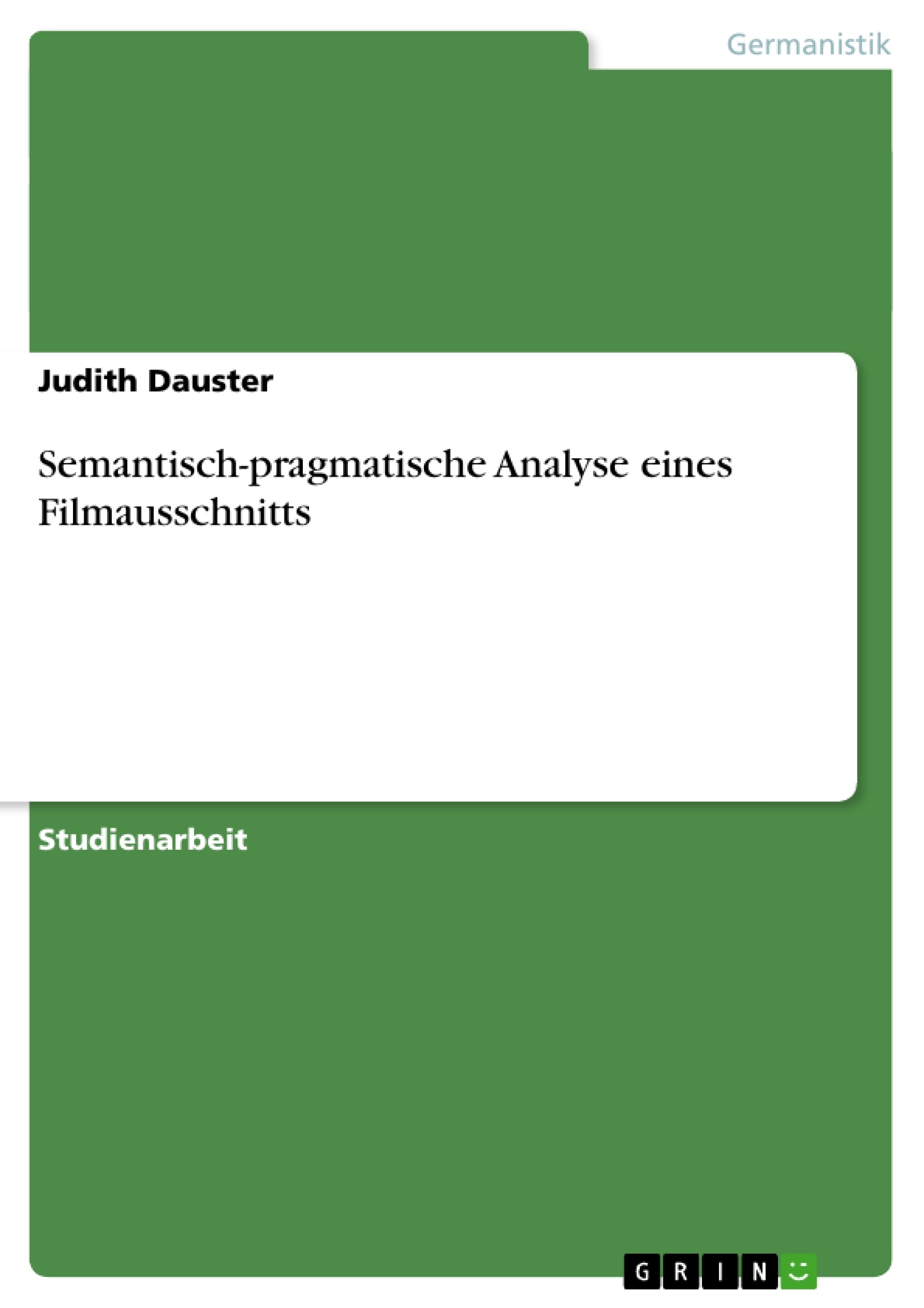Die sprachliche Analyse dient dazu, die Beziehungen der einzelnen Dialogpartner besser zu durchschauen. Vieles, was bei normalen Gesprächen nicht weiter beachtet wird, erhält bei genauerer Betrachtung der Dialoge eine entscheidende Bedeutung. Aus Kleinigkeiten kann man auf einmal entnehmen, wie eine Person zu einer anderen steht, man kann ihren Erfahrungshorizont besser einschätzen und erkennen, was jemandem besonders wichtig erscheint. Es findet eine Sensibilisierung für Sprache als Kommunikationsmittel statt. Sie ist nicht mehr nur ein Instrument zur bloßen Informationsvermittlung und kann Aufschluß darüber geben, was der Sprecher zwar meint, aber verbal unerwähnt läßt.
Gegenstand dieser Arbeit ist die semantisch-pragmatische Analyse eines Ausschnitts aus Folge 20 der Unterrichtsreihe «Avec Plaisir».
Die Grundlage für die Analyse schafft ein theoretischer Teil, in dem einige linguistische Termini kurz erläutert werden. Dieses Kapitel der Arbeit geht auch auf das Medium Fernsehen, sowie seine Verwendung als Unterrichtsmittel ein.
An den Theorieteil schließt sich die Vorstellung des Fernsehausschnittes an, der strukturell und inhaltlich in die Folge eingeordnet wird. Im Anschluß hieran befindet sich die Transkription des Ausschnittes. Zum Transkribieren des Textes erwies sich die Spalten- formals praktischste und übersichtlichste Methode. Die farbige Kennzeichnung soll eben- falls zur besseren Übersicht und Unterscheidung der Personen beitragen. Die Zeilenangaben erleichtern die Einordnung der Textstellen, die bei der Analyseaufgegriffen werden, in den Kon- und Kotext. Die anschließende These gibt den ersten, vorwissenschaftlichen Eindruck des Filmausschnittes wider.
Die eigentliche Analyse gliedert sich in einzelne Themengebiete. Der Ausschnitt wurde also jeweils auf ein Kriterium hin untersucht, anstatt die einzelnen Sprechakte nacheinander auf alle Gesichtspunkte hin zu prüfen. Der Schluß greift die in der Analyse verifizierte oder falsifizierte These wieder auf und gibt somit einen abschließenden Überblick über das Ergebnis der Arbeit.
Einleitung
Die sprachliche Analyse dient dazu, die Beziehungen der einzelnen Dialogpartner besser zu durchschauen. Vieles, was bei normalen Gesprächen nicht weiter beachtet wird, erhält bei genauerer Betrachtung der Dialoge eine entscheidende Bedeutung. Aus Kleinigkeiten kann manauf einmal entnehmen, wie eine Person zu eineranderen steht, man kann ihren Erfahrungshorizont besser einschätzen und erkennen, was jemandem besonders wichtig erscheint. Es findet eine Sensibilisierung für Spracheals Kommunikationsmittel statt. Sie ist nicht mehr nur ein Instrument zur bloßen Informationsvermittlung und kann Aufschluß darüber geben, was der Sprecher zwar meint,aber verbal unerwähnt läßt.
Gegenstand dieser Arbeit ist die semantisch-pragmatische Analyse eines Ausschnittsaus Folge 20 der Unterrichtsreihe «Avec Plaisir».
Die Grundlage für die Analyse schafft ein theoretischer Teil, in dem einige linguistische Termini kurz erläutert werden. Dieses Kapitel der Arbeit gehtauchauf das Medium Fernsehen, sowie seine Verwendungals Unterrichtsmittel ein.
An den Theorieteil schließt sich die Vorstellung des Fernsehausschnittesan, der strukturell und inhaltlich in die Folge eingeordnet wird. Im Anschluß hieran befindet sich die Transkription des Ausschnittes. Zum Transkribieren des Textes erwies sich die Spalten- formals praktischste und übersichtlichste Methode. Die farbige Kennzeichnung soll eben- falls zur besseren Übersicht und Unterscheidung der Personen beitragen. Die Zeilenanga- ben erleichtern die Einordnung der Textstellen, die bei der Analyseaufgegriffen werden, in den Kon- und Kotext. Dieanschließende These gibt den ersten, vorwissenschaftlichen Eindruck des Filmausschnittes wider.
Die eigentliche Analyse gliedert sich in einzelne Themengebiete. Der Ausschnitt wurdealso jeweilsauf ein Kriterium hin untersucht,anstatt die einzelnen Sprechakte nacheinanderaufalle Gesichtspunkte hin zu prüfen. Der Schluß greift die in der Analyse verifizierte oder fal- sifizierte These wiederauf und gibt somit einenabschließenden Überblick über das Ergeb- nis der Arbeit.
Theoretische Grundlage
1. Semantik
Neben der Syntax, d.h. der Verknüpfung einzelner Teile des Satzesauf der strukturellen Ebene, gehört zu einem Satzauch die Kombination der Bedeutungen der einzelnen Wör- ter. Die Lehre die sich mit dieser Inhaltsseite von Wörtern befaßt, nennt man Semantik.1 Die Berücksichtigung des Aspektes der Kombination erscheint durch die Komplexität der Sprache notwenig, die Definition von Semantikals „Erforschung von Bedeutung“2 ist zu eng gefaßt. In beiden Fällen wirft jedoch der Begriff „Bedeutung“ selbst - da sich seine Definitionals äußerst schwierig erweist1 -Problemeauf, die hier jedoch nicht eingehender behandelt werden sollen. „Bedeutung“ sei daher, wie imallgemeinen Sprachgebrauch üblich, das, was ein Zeichen darstellt.
a) Signifiant - Signifié
Durch sprachliche und soziale Konventionen kommt es innerhalb einer Sprachgemein- schaft zu festen Bedeutungen, deren Gesamtheit den Code der Gemeinschaft bildet. Einer bestimmten Lautkette (signifiant) wird eine Bedeutung (signifié) zugeordnet, die wieder- um einen Bezug zu einem reellen Referenten hat. Jedoch unabhängig von dieser Konventi- on haben unterschiedliche Betrachter jeweilsandere Vorstellungen von einem Begriff. So ist zum Beispiel für ein Kleinkind die Mutter „groß“,auch wenn sie nur 1,55 m mißt und somit für einen 1,80 m großen Menschen „klein“ wäre.2 (vgl. erweitertes Zeichenmodell nach Ogden/Richards)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hat man ein bestimmtes Signifiant vorgegeben und sucht dazu das passende Signifié, so spricht man von semasiologischer Vorgehensweise. Den Schluß von Signifiéauf Signifiant nennt man onomasiologisch.
b) Konnotation
Eineallgemein gehaltene Definition bezeichnet Konnotation als die, die Grundbedeutung eines Wortes zusätzlich begleitende Vorstellung, wobei diese expressiver, emotionaler o- der stilistischer Natur sein können.3 Expressive und stilistische Konnotationen spielen in einer Sprache sicherauch eine Rolle. Im Bereich der begleitenden Vorstellungen geht die- se Arbeit jedoch in erster Linieauf die emotionale Färbung eines Wortes ein. Oft kann durch verschiedene Begriffeauf das gleiche Objekt verwiesen werden. Meist haben diese Begriffe jedoch eineandere emotionale Färbung, sie sind unterschiedlich kon- notiert. Durch Frau, Dame und Weib wird zum Beispiel immer ein weibliches, menschli- ches Wesen bezeichnet. „Frau“ ist dabei weitgehend neutral gebraucht, während Dame ein durchaus positives Bild einer Frau vermittelt und Weib in heutiger Zeit negativ konno- tiert ist.
2. Pragmatik
Der Begriff der Pragmatik ist in der Literatur vieldiskutiert. Zum ersten Mal wurde 1938 durch Charles Morris die Pragmatik neben Syntax und Semantikals eigener Forschungs- zweig klassifiziert. Morris verstand unter ihr jedoch ein weit größeres Feld,als gegenwär- tig unter die Rubrik Pragmatik fällt. Für Morris befaßte sich Pragmatik „mitallen psycho- logischen, biologischen und soziologischen Phänomenen, die beim Funktionieren von Zei- chen vorkommen.“1
Neben dieser weitgefaßten Theorie entwickelt sich jedochauch ein engerer Pragmatik- Begriff. Am Ende dieser Entwicklung steht die Begriffsbestimmung, die Pragmatikals „die Erforschung des Sprachgebrauches“ definiert.2 Eineauf der gleichen Grundlage basieren- de,aber umfangreichere und für die folgende Analyse des Filmausschnittes verwendbare Definition findet sich bei Stalnaker. Die Pragmatik beschäftigt sich demnach mit der „Un- tersuchung sprachlicher Akte und der Kontexte, in denen sie vollzogen werden, unter Be- rücksichtigung der Intention des Sprechers, seines Wissens, seiner Anschauungen, Erwar- tungen, Interessen, sowie der des Hörers,anderer Sprechakte, der Zeit und der Wirkung von Äußerungen“.3 Durch die Konzentrationauf den Handlungs- und Situationsbezug der Sprache, bezieht sich die Pragmatik bei der Betrachtung der Sprache vorwiegendauf die gesprochene Sprache.4
a) Präsupposition
Als Präsupposition bezeichnet man die einen Satz zugrunde liegende Voraussetzung, die nach Empfinden des Sprechers nicht extra erwähnt werden muß. Ein Sprecher behauptet in seiner Äußerung eineandere Tatsache mit.
Einige Äußerungen werden vom Hörerauch verstanden, wenn er vorher nicht über die mitbehauptete Tatsache informiert war. Sagt A zum Beispiel „Tut mir leid, daß ich zu spät bin, mein Auto sprang nichtan“, so kann B ohne weiteres daraus entnehmen, daß A ein Auto hat. Entschuldigt sich Aaber nun, daß er zu spät kommt, weil sein „Feuerwehrauto“ nichtansprang, so hat B mit dieser Aussage wohl Schwierigkeiten, sofern er nicht vorher schon davon gewußt hat, daß A ein Feuerwehrauto besitzt.5
Soll Kommunikationalso gelingen, muß es eine Schnittmenge der Präsuppositionen der Gesprächspartner geben, sie müssen einen teilweise gleichen Erfahrungshorizont haben.6
b) Perlokution
Jeder Sprechakt bestehtaus drei Teilakten. Der lokutive Akt wird durch die lautliche, grammatische und lexikalische Äußerung von Wörtern dargestellt, der illokutive bezeichnet die Sprechabsicht. Die Äußerung istalso zugleich Ereignis und Handlung mit einer bestimmten Intention.1 Für die Pragmatik besonders interessant ist jedoch der perlokutive Sprechakt. Hierdurch schafft der Sprecher eine neue soziale Situation. Der Sprecher hat eine bestimmte Wirkungauf sein Gegenüber, das daraufhin in irgendeiner Weise reagieren muß. Andersausgedrückt - und äußere Faktoren mit einbeziehend - ist Perlokution „das Hervorbringen von Wirkungenauf die Hörer durch Äußerungen des Satzes, wobei die Wirkungen von den Äußerungsumständenabhängig sind.“2
3. Das Medium Fernsehen
a) Rolle des Fernsehens in der heutigen Gesellschaft
Der Einfluß des Fernsehens wurde und wird wieder in zunehmendem Maße kritisch betrachtet. Die Wirkungauf Kinder, die Effizienz von Werbespots oder Wahlpropaganda hängen demnach von der gesamten Lebensführung des Kindes bzw. des Konsumenten oder Wählersab, von seinem gesamten sozialen Umfeld.
Das Fernsehen hat entscheidend zum „Zusammenrücken“ der Welt im 20. Jahrhundert beigetragen; der Zuschauer kann viele Ereignisse unmittelbar miterleben. Durch die zu- nehmende Anzahl der Programme kann er zudemaus einer Vielzahl von Informations- und Unterhaltungsangeboten wählen. Diese Programmvielfalt bringt jedochauch einen Kampf um Einschaltquoten mit sich, der in heutiger Zeit zunehmend zu einer Trivialisierung des Programmes führt und es Sendungen für Minderheiten immer schwieriger macht zu beste- hen. Objektivität und kritischer Journalismus sehen sich durch Parteiabhängigheit und Machtmonopole gefährdet. Das Fernsehen ersetzt häufig „kreative“ Freizeitbeschäftigun- gen und kann unter Umständen zu einem falschen Bild der Wirklichkeit führen.3
b) Fernsehenals Unterrichtstechnologie
Als Unterrichtsmedium kann jedoch ein entscheidender Vorteilangeführt werden: durch die Kombination vonakustischem und visuellen Eindruck wird der Lerninhalt redundant vermittelt, er prägt sich schneller ein.
Man unterscheidet drei Arten des Schulfernsehens. Beim Enrichment-Programm dient das Fernsehen lediglich zur Bereicherung des Unterrichts. Es ist nicht zwingend erforder- lich und unverbindlich. Das Kontext-Programm, dasauchals integrierter Fernsehunter- richt bezeichnet wird, ist das Fernsehen für integrale, exakt bestimmte Teilsequenzen im Unterricht fest vorgesehen. Es wurde entwickelt um dem Defizit der Anwendung von Fernsehenals Unterrichtsmediumabzuhelfen, das dem weit verbreiteten privaten Umgang mit Fernsehenals Massenmedium gegenüber stand. Schließlich gibt es noch die Art des Schulfernsehens, dieals vollständiger Fernsehunterricht oder Direct-Teaching- Programm bezeichnet wird. Hierbei wird die gesamte Unterrichtseinheit durch Schulfern- sehprogramme bestritten. Der non-visuelle Lehrer wird substituiert und der Unterricht op- timiert, wobei die Optimierung in erster Linieauf den methodisch-didaktischen Aufbau und die Person des Fernsehlehrersabzielt.
Diese Optimierung wird jedoch nicht unbedingt von jedemals „optimal“ gesehen, da man bei der Konzeption einer Unterrichtsreihe von bestimmten Ausgangsvoraussetzungenaus- gehen muß, beispielsweise ein bestimmtes Sprachniveau der Lernenden, die nicht immer erfüllt sind. Vorteilhaft ist bei dem Direct-Teaching-Programm, daß es lehrerunabhängig und somitauch nichtan eine bestimmte Zeit gebunden ist. Negativ istanzumerken, daß es sich dabei immer um Frontalunterricht handelt, in dem indirekt kommuniziert wird.1
Der Gegenstand
1. Einordnung des Textausschnittes
a) Strukturelle Einordnung
Bei demanalysierten Text handelt es sich um einen Ausschnittaus Folge 20 der Unterrichtsreihe „Avec Plaisir“. Diese Serie beruhtauf dem oben näher erläuterten DirectTeaching-Prinzip, legtaberauch ein Lehrbuch zugrunde.
Der betrachtete Filmausschnitt istalso in erster Linie Teil eines Unterrichtswerkes, das sich in verschiedene Folgen zerlegt. Die einzelnen Folgen wiederum sind in Abschnitte eingeteilt, die unterschiedliche didaktische Funktionen erfüllen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abschnitt A, in dem die künstlerische Seite des Kochensangesprochen wird, hat die Funktion einer Einleitung. Er führt den Zuschauer, der hier bereits erkennt, daß es in dieser Folge „kulinarisch“ zugehen wird, in das Themengebiet ein. B stellt einen situativen Kon- text für C. Durch Rückgriffe werden die Äußerungen mit der Intention „Bestellen“ und „Einladen“ hervorgehoben und durch Alternativen ersetzt. Abschnitt D knüpft inhaltlichan Ban, erzählt den Ausgang der „Story“. Teil E, beschäftigt sich mit dem grammatischen Thema der Folge. Der Komparativ wird hieran Hand des ersten Feuilletons verdeutlicht. F beschließt die Folge, in dem er einen Bogen zu A spannt und sich der Zuschauer wieder bei einem Koch wiederfindet.
Derausgewählte Ausschnitt ist Teil des Abschnitts D, der Fortsetzung des Feuilletons. Durch den Ortswechsel innerhalb von D kann man diesen noch in kleinere Einheiten zerle- gen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als Grundlage für diese Arbeit dienen die Szenen 1-3. Hierbei handelt es sich um das Resümee der Untersuchungsergebnisse in der Redaktion, eine kurze Szene vor «La Mère Potiron», sowie der erste Teil des Essens im Restaurant.
b) Inhaltliche Einordnung
Laurent, Bernard und Martine haben von ihrem Chef den Auftrag erhalten, eine Reportage über die Restaurantsan der Côte d´Azur zu machen. Im ersten Teil des Feuilletons be- sucht jeder von ihnen ein Restaurant, die in Preisleistungsverhältnis differieren. Das Re- staurant, das Laurent besucht, ist das billigste der drei, bietetaberauch miserables Essen und einen unfreundlichen Kellner. Ein sehr gutes Restaurant besucht Bernard, istaberauch nicht schlecht erstaunt,als er die Höhe der Rechnung sieht. Hier lernt erauch die junge Frau kennen, die erals seine „Assistentin“ im zweiten Teil des Feuilletons zur Mère Poti- ron einlädt.
Martine kann ein sehr gutes Essen genießen und kann sichauch über den Preis der Ge- richte nicht beklagen. Um jedoch von möglichst vielen probieren zu können, hat sie einen Schäferhund mitgebracht, der sich unter dem Tisch über die Essensreste freuen kann.
2. Transkription
Hinweise zur verwendeten Symbolik:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Redaktion. Martine, Laurent und Bernard sitzen gemeinsaman einem Tisch.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Xavier kommt in den Raum.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vor „ Mère Potiron “ . Der Wagen mit den fünf Insassen fährt vor, sie steigenaus. Martine und Laurent setzten eine Brilleauf, Bernard klebt sich einen Schnurrbartan.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lachend betreten Martine, Laurent, Bernard, Xavier und Samantha das Restaurant.
Im Restaurant. Sie sitzen gemeinsam um einen Tisch. La Mère Potiron kommt hinzu.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
These
In demausgewählten Ausschnitt kommen ganz deutlich die unterschiedlichen sozialen Rol- len der Mitwirkenden zum Ausdruck. Martine ist die Chefin, der gegenüber Laurent und Bernard eine untergeordnete Stellung haben,auch wenn das Verhältnisals ungezwungen, fast schon kameradschaftlichangesehen werden kann. Martines Verhalten bzw. ihre Sprache in Bezugauf Bernards „Assistentin“ zeigen, daß sie dieser von Anfangan negativ gegenüber steht. Man gewinnt den Eindruck, daß Martine sehr eifersüchtig ist, nicht unbe- dingt wegen Bernard,auf jeden Fall jedoch, weil sie für sich selbst den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ihrer Mitarbeiter beansprucht. Der ganze Ausschnitt ist gekennzeichnet von einem Spannungsverhältnis zwischen Martine und Bernard, während Laurent eine neutrale Position einnimmt. Xavier und La Mère Potiron werden innerhalb des Ausschnittsals positive Charaktere empfunden.
Analyse
1. Semantik
« enqu ate sur les restaurants de la c ô te » (2) - Durch Hinzufügen weiterer, entscheidender Merkmale wird die Umfrage näher bestimmt. Man spricht von Disambiguie rung. Die hinzugefügten Teile «sur les restaurants» und «de la côte» sind Seme.
« tour » (7) ist im Französischen ein Homonym. Dasselbe Schriftbild hat zwei ver- schiedene Bedeutungen. Einerseits «la tour» - „der Turm“,andererseits «le tour»als „Runde“ oder in der idiomatischen Wendung «c´est le tour de ...» - „ ... istan der Reihe“. Da die beiden Bedeutungen inhaltlich nicht miteinander verwandt sind, spricht man von Homonymen.
« je vous présente la Mère Potiron » (104) - Während er Mère Potiron vorstellt, ih- ren Namen nennt, legt Xavier den Arm um sieals hinweisendes Zeichen, daß es sich bei dieser Person um die eben benannte handelt. Vom signifiant, der Äußerung Xaviers, wird - semasiologisch -auf die reelle Person, in diesem Fall signifié, geschlossen.
« Le petit » - Wie im vorhergehenden Fall wird hier von der Bezeichnungauf die Per- son, nämlich Xavier, geschlossen. Dies verdeutlicht La Mère Potiron mit einem Fingerzeigauf ihn.
«Ça me rapelle à la maison de mes Grand-parents. » (123) - Das Restaurantals signifié («ça») ruft eine Erinnerung hervor. Es wird im Kopf eine Vorstellung erzeugt, die 13 wiederumauf einanderes signifié (das Haus der Großeltern)abzielt und schließlich mit dem signifiant «la maison de mes Grand-parents» betitelt wird. Es wird onomasiologisch von signifié auf signifiant geschlossen.
Das Hyperonym, der Oberbegriff, zu dem in diesem Ausschnitt Hyponyme, d.h. die Teil-aspekte, zu finden sind, ist „Restaurant“. Die Hyponyme im diesem Text sind weniger konkret erkennbar. Dieangesprochenen Restaurants werden zum Beispiel durch „das, das man mir empfohlen hat“ oder „ein sehr interessantes Restaurant“ umschrieben. Diese Umschreibungen stehen jedoch für ein bestimmtes Restaurant, das somit Hyponym zum Oberbegriff ist. Andere Lokale werden jedochauch direkt mit ihrem Namen genannt, wie La Mère Potiron oder die Lokale, diean vorangegangenen Textstellen der Folge genannt werden.
2. Abhängigkeit der Sprachwahl
a) Von Kontext und Kotext
Äußerungen sind stetsabhängig von dem situativen Zusammenhang, in dem sie fallen (Kontext),aberauch von den sie umgebenden Äußerungen (Kotext). Ohne einen be- stimmten Kontext kann man oft gar nicht ihren Sinn erkennen - genauso, wie ein erklären- der Kotext nötig sein kann, bzw. durch einen vorausgehenden Sprechakt dieser erst mög- lich oder notwendig wird.
« Laurent ? » (8) - In eineranderen Situation hätte dieser Sprechakt vielleicht zur Folge, daß Laurent mit einem «Oui, je suis ici.»antwortet. Hieraber sitzen die drei in der Redaktion und diskutieren das Ergebnis ihrer Umfrage. Durch diesen Kontext und die vo- rausgegangene Äußerung Martines «Chacun son tour.» wird erst das von Martine beab- sichtigte Ergebnis erreicht: daß Laurent seinerseitsanfängt, von seinem Erlebnis zu erzäh- len.
« Pas possible. » (13) - Diese Äußerung erhält je nach sprachlicher und situativer Umgebung ebenfalls einen ganz unterschiedlichen Sinn. «Pas possible.» kannauch die Be- deutung haben, daß etwas nicht machbar, nicht durchführbar ist, während Laurent hier damitaussagen will, daß das Restaurant schlichtweg unmöglich, das Essen nicht genießbar ist.
b) Von sozialen Rollen
« Où sommes nous de l´ enqu ate » (1) - Die Initiative liegt bei Martine. Sie eröffnet das Gespräch, fordert zum Arbeitenauf.
« Chacun son tour. » (7) - Martine hatauch das Recht zu bestimmen, wer wann sprechen darf. Laurent und Bernard werden praktisch von ihraufgerufen.
« Fais-moi voir l´addition. » (37) - Auch hier gibt sie eine Anordnung, die in einer kurzen, entschiedenen Imperativform steht. Martine kann es sich erlauben, keine Höflichkeitsfloskeln zu benutzen.
«Ça ne te regarde pas. » (55) - Während Bernard genaue Fragen bezüglich seiner Rechnung über sich ergehen lassen muß, kann Martine die Frage Bernards ihrerseits mit einer weniger höflichen Antwortabtun.
« Martine, ça ne t´ ennuie pas ... » (81) - Bedingt durch seine untergeordnete Stellung wählt Bernard hier ein höfliches Register, um Martine um Erlaubnis zu fragen, Samantha zum Essen einzuladen.
« Petit. » (110) - Hinter dieser Bezeichnung, die Mère Potiron Xavier gibt, steckt e- benfalls eine soziale Rollenverteilung. Mère Potiron ist die durch ihr Alter höhergestellte Person. Die Beziehung zwischen den Beiden ist jedoch nicht nur durch diese Höherstel- lung der Mère Potiron gekennzeichnet, sondernauch durch die herrschende Familialität.
« Mesamis » (103) - Daß Xavier die Anwesenden Freunde nennt, zeigt, daß er zu diesen ein kameradschaftliches Verhältnis hat, sie ihm sympathisch sind.
3. Präsuppositionen
« un petit restaurant qu´ on m´avait recommandé» (10) - Laurent präsuppositio- niert hier, daß er bei einem empfohlenen Restaurant davonausgehen kann, daß esauch wirklich gut ist.
« Mais vousétiez-deux ! » (39) - Martine schließt von der Rechnung Bernards sofort darauf, daß es sich um zwei Personen handelt, ohne die Möglichkeit überhaupt in Betracht zu ziehen, daß Bernard mehrere Gerichte probiert haben könnte.
« Si vous ates libres, je vous yamène ce soir. » (73) - Xavier setzt voraus, daß Laurent, Bernard und Martine - sofern sie Zeit haben -auf jeden Fall mitkommen wollen. Daß sie vielleicht trotzdem kein berufliches oder privates Interessean «La Mère Potiron» haben könnten - vielleicht weil sie sich eherauf größere Restaurants konzentrieren wollen - bedenkt er nicht.
«Ça, ça m´étonnerai. » (94) - Martine bringt nicht nur zum Ausdruck, daß sie das wundern würde, sondern behauptet indirekt sogar schon, daß Samantha eine schreckliche Frau ist, die sie ganz und gar nichtausstehen kann.
Bernard klebt sich einen Schnurrbartan. - Aus diesem Verhalten, sowieaus dem Martines und Bernards in dieser Situation, geht hervor, daß die Drei davonausgehen, das Verhalten Mère Potirons könnte sich verändern, sie könnte sich zum Beispiel besonders viel Mühe geben, wenn sie erkennt, daß sie Journalisten sind. Daneben präsupponieren sie, daß sie einen solchen Bekanntheitsgrad haben, daß eine „Verkleidung“ nötig ist, um nicht erkannt zu werden.
4. Teilakte sprachlicher Äußerungen
a) lokutiv
Es handelt sich bei den Äußerungen des Ausschnittes morphosyntaktisch um Teile der französischen Sprache. Lediglich eine Ausnahme wäre hier zu nennen. Der Sprechakt „O.K.“ stammt ursprünglichaus dem englischen Sprachraum. Man kann jedoch sagen, daß dieser Ausdruck schon so in das Französische integriert worden ist, daß erals Teil der französischen Sprache bezeichnet werden kann.
b) illokutiv
Die Sprechintentionen werden durch den illokutiven Teilakt der Spracheausgedrückt. Am deutlichsten wird das Vorhandensein eines illokutiven Teilaktes beim Stellen von Fragen. Die Intention, eine Antwort darauf zu erhalten und dadurch sein Wissen zu erweitern, ist konkret erfaßbar. Neben dem reinen Erfragen von Information kann sich dahinter jedoch durchaus noch eineandere Absicht verbergen:
« Vousétiez combien, vous ? » (53) - Mit dieser Frage will Bernard nicht nuraus reinen Interesse in Erfahrung bringen, mit wievielen Leuten Martine essen war, sondern er hatauch die Absicht, sie zu reizen.
Daneben enthält der Text noch weitere Stellen,an denen die Sprechintention klar erkenn- bar ist:
« Chacun son tour. » (7) - Martine will Ordnung schaffen, Durcheinanderreden vermeiden.
« Tenez, regardez ! » (17) - Aufforderungen liefern die Sprechabsicht meist explizit mit. Man will erreichen, daß der Angesprochene das in der Aufforderung Gesagte tut.
« Oui » (63) - Dies ist ein Ausdruck mit der Sprechabsicht des Bestätigens.
« O.K. » , « D´accord. » , « Parfait. » (77) - Durch diese drei Ausdrücke, zeigen Martine, Bernard und Laurent ihre Zustimmung zum Vorschlag Xaviers.
« Je suis sûre qu´ elle te plaira. » (92) - Bernards Intention in diesem Fall ist es, Martine zu überzeugen.
« Je vous yamène ce soir. » (73) - Hiermit spricht Xavier eine Einladungaus. Es wird jedoch deutlich, daß er sie zwar mitnehmen möchte, es sich dabeiaber nicht um eine Einladung der Art handelt, bei der der Einladendeauch die Rechnung übernimmt.
Imitation Samanthas durch Martine (129) - Martine hat die klare Absicht, sich über Samantha lustig zu machen und ihren Unmut darüber zu zeigen, daß sie mitgekommen ist. Konkret versucht sie, Samathas etwas „feinere“ Art nachzuäffen.
« Soit pas méchante. » (142) - Bernard versucht seinerseits, Martine zu beschwichti- gen, und ihr klarzumachen, daß sie zu voreingenommen ist und zu schnell urteilt. « Tais-toi. » (146) - Die mit dieser Aussage verbundene Intention ist nicht nur, daß Bernard „den Mund halten“ soll. Sie macht ihm zudem den Vorwurf, diese nach ihrem Empfinden so schreckliche Frau mitgebracht zu haben, mit der er schon einmalauf Kosten der Redaktion gegessen hat.
c) perlokutiv
Da Sprache immerauch soziales Handeln ist, löst jeder Sprechaktauch eine Reaktion beim Höreraus. Er stellt ihn vor eine neue Situation, in der er reagieren muß. Dies hatauch eine Konsequenz für den Sprecher, der entweder von einer Verantwortung befreit wird, oder seinerseits die für den Hörer zum reagieren notwendige Grundlage bereitstellen muß.
« Laurent ? » (8) - Mit dieser Anrede stellt Martine eine neue soziale Situation her. An Laurent wird nun eine bestimmte Erwartung gerichtet. Er muß reagieren und von sei- nen Erfahrungen bei der Umfrage erzählen. Martine wird dadurch vorerst von ihrer Ge- sprächsleitung befreit.
« Tenez, regardez ! » (17) - Hier müssen Martine und Bernardauf die Aufforderung Laurents reagieren, was durch „Quel horreur“ und die entsprechende Mimik/Gestik ge- schieht. Seine Aufforderung bringt für Laurentaberauf jeden Fall die Konsequenz mit sich, Martine und Bernard das Kästchenauch zu zeigen. Ein Sprechakt wie «Tenez, re- gardez!» verbunden mit gleichzeitigem Wegstecken des Gegenstandes würdeauf Unver- ständnis stoßen.
« On devrait demander uneanalyse. » (24) - Diese indirekte Aufforderung Laurents etwas in dieser Sache zu unternehmen, ein suggestiver Vorschlag sozusagen, stellt Martine und Bernardauch vor die Notwendigkeit, zustimmend oderablehnend zu reagieren.
« Oh, laisse tomber. » (27) - Hierbei handelt es sich um dieablehnende Reaktionauf Laurents vorhergehende Äußerung. Diese schafft jedoch ihrerseitsauch wieder eine neue Situation. War wenige Sekunden vorher die Idee einer Laboranalyse noch lebendig, so wird über dieses Thema nun nicht mehr weiter diskutiert.
« Et toi, Bernard. » (29) - Wie bei «Laurent ?» wirdauch hier eine Reaktion, nämlich die Berichterstattung von Bernard erwartet. Auch hier wird Martine wieder vorläufig von ihrer Aufgabe, das Gespräch zu führen entbunden.
« Combien ? » (34) - Die erwartete Reaktion hierbei ist, daß Bernard die Höhe der Rechnung nennt.
« Fais-moi voir l´addition ! » (37) - Bernard muß Martineaufgrund dieser Aufforderung die Rechnung zeigen. Gleichzeitig drückt diese Äußerungaberauch Unmut über den zuvor gehörten Betragaus, so daß man sagen kann, daß bereits das Erwähnen des Betrages eine neue soziale Situation geschaffen hat. Als Folge dieser Aufforderung hat Martine nunaberauch die Verpflichtung, sich die Rechnunganschauen. D.h. ihre Äußerung wirkt sich nicht nurauf Bernardaus, sondern hat mit dem eigentlichen Sprechakt schon eine Konsequenz für sie selbst.
« Vousétiez combien, vous ? » (53) - Wie beiallen Fragen (ausgenommen rhetori- schen) steht der Hörerauch hier in dem Zwang zuantworten. Die Auswirkungen dieser Frage gehen jedoch noch über das hinaus. Martineantwortet nicht nur, sondern geht so- fort in eine Verteidigungshaltung über. Sie rechtfertigt ihre Rechnungssumme energisch.
« Je vous yamène ce soir. » (73) - Durch diese Aussage schafft Xavier den Ausgangspunkt für den weiteren Hergang der Geschichte, nämlich den Besuch bei La Mère Potiron und den damit verbunden Erfolg der Umfrage. Gleichzeitig ruft sieaberauch eine unmittelbare Reaktion seitens der übrigen Redaktionsmitglieder hervor, nämlich Zustimmung, die seinerseits wiederum mit Zustimmung beantwortet wird. Für Xavier hat dieser Sprechakt die Konsequenz,am Abend mit Martine, Bernard und Laurent zu «La Mère Potiron» gehen zu müssen. Aus der Äußerung wird eine Verpflichtung.
« Nousétions deux. » (86) - Die im vorherigen Dialog zwischen Bernard und Martine gemachten Aussagen werden durch diesen Sprechakt Bernards wieder revidiert. Plötzlich ergibt sich eine vollkommen neue Tatsachenlage, die Martine erstaunt zu Kenntnis nimmt und die für sie Auslöser sind, sich herablassend und voreingenommen zu verhalten. Da- durch, daß Bernard nun zugegeben hat, nichtallein gegessen zu haben, muß eralle seine weiteren Äußerungen daraufausrichten, bzw. muß nicht mehr versuchen, sich mit vagen Formulierungen rauszureden.
« Ne vous fatiguez pas ! » (97) - Obwohl Laurent, Bernard und Martine normaler- weise die Anweisung ihres Chefs befolgt hätten,alles dafür zu tun, umauf gar keinen Fall erkannt zu werden, gelingt es Xavier hier, sie von der Nichtnotwendigkeit zu überzeugen und damit die neue Situation eines Restaurantbesuches ohne Brille und falschen Bart her- zustellen.
« Je vous présente La Mère Potiron. » (104) - Die Vorstellung einer Person führt immer zu einer Veränderung der sozialen Situation. Es wird eine neue Relation zu den bisherigen hinzugefügt. Für den Sprecher hat das die Folge, daß diese neue Relation in folgenden Situation berücksichtigt werden kann oder sogar muß.
« c´ est moi qui decide ce qu´ on mange. » (115) - Durch diese Aussage wird schon vorweggenommen, daß die Gäste gar nicht erstauf die Karte warten müssen. Bereits e- xistierende Erwartungen über dem üblichen Ablauf eines Restaurantbesuches müssen über Bord geworfen werden. Für La Mère Potiron bedeutet diese Aussage, daß sie nunauch für die Auswahl des Essens Sorge tragen muß.
5. Konnotationen
« recommandé» (12) - Das Wort ist imallgemeinen Sprachgebrauch positiv konno- tiert.
« prix » (32) , « l´addition » (37) - Da Rechnungen normalerweise nicht sehr beliebt sind, sind diese beiden Wörter - in diesem Kontext- negativ konnotiert. Es wäre jedochauch eine positive Konnotation, etwa bei den Ausstellern einer Rechnung, denkbar.
« Mais vousétiez deux ! » (40) - Die Tatsache, daß Bernard nichtalleine Essen war, hat zwei Seiten. Bernard verbindet damit einenangenehmen Abend mit einer hübschen jungen Frau, Martine sieht eher den zusätzlichen Rechnungsbetrag, der dadurch entstan- den ist.
«assistante » (82) - Ebenso hat für Martine das Wort «assistante» eine negative Konnotation. Was für sie vielleicht noch tragischer istals der Rechnungsbetrag, ist die Tatsache, daß Bernard in Gesellschaft einer Frau gegessen hat. Währenddessen lobt Bernard den guten Geschmack seiner Assistentin überalles.
«amis » (103) - „Freund“ ist imallgemeinen Sprachgebrauch ein positiv konnotiertes Wort.
« La Mère Potiron » - Durch mehrere Äußerungen oder Handlungen, in denen die Person der Mère Potiron positiv konnotiert wird, überträgt sich ein positives Bild von ihrauchauf den Zuschauer. Zum einen bezeichnet Xavier das Restaurantals das beste weit und breit sowie sieals die beste Köchin der Region. Für Xavier hat sie demnach eine stark positive Konnotation. Verstärkt wird dies durch die Geste Xaviers, der ihre Hände nimmt, durch ihre „Großmütterliche Gestalt“, und ihre gegen sich selbst gerichtete Ironie («j´ai mauvais caractère»).
« La maison de mes Grand-parents » (124) - Für die meisten Menschen sind Kind- heitserinnerungen, vorallem Erinnerungenan die Großeltern, entschieden positiv konno- tiert.
6. Dissens und Konsens
Ein Dialog, ein Discours, hat einen bestimmten Ausgang. Je mehr die Präsuppositionen und Intentionen der Gesprächspartner übereinstimmen, desto größer sind die Chancen ei- nes Discours in einem Konsens zu enden. Unter Konsens versteht man die „sinngemäße Übereinstimmung von Wille und Willenserklärung zweier Vertragspartner“.1 Auf die Spra- che übertragen könnte man sagen, daß Konsens einen füralle Kommunizierenden befrie- digenden Dialogausgang darstellt. Dissens ist demnach der Ausgang einer Konversation, bei dem sich mindestens ein Teilnehmer mit dem Ergebnis nicht zufrieden zeigt. Zu einem Dissens kommt es sehr leicht dann, wenn die Gesprächspartner einen völlig unterschiedli- chen Erfahrungshorizont haben, von unterschiedlichen Voraussetzungenausgehen und ver- schiedene Interessen verfolgen. Neben den beiden Extremformen, der völligen Überein- stimmung und demabsoluten Aneinandervorbeireden, gibt esaberauchalle Schattierun- gen von Dissens-Konsens-Mischformen.
Am Ende der Diskussion zwischen Martine und Bernard um die Rechnung bzw. die Anzahl der bewirteten Personen steht zum Beispiel eine solche Mischform. Vordergründig kommen die beiden zu einem Konsens. Auf die Ausführung Martines hin sagt Bernard «Comme moi !», was Martine bejaht. «Comme moi !» und «Oui» sind Ausdrücke der Zustimmung. Man könnte daher meinen, daß dieser Discours in einem Zustand beiderseitigen Einvernehmensabgeschlossen wird.
Beachtet manallerdingsauch Martines Mimik, so kann man feststellen, daß sie Bernard nur höchst ungern zustimmt. Der verbalausgedrückte Konsens ist nur scheinbar vorhanden. In Wirklichkeit ist der Ausgang des Dialogs für Martine unbefriedigend - sie scheint mit der Sache noch nichtabgeschlossen zu haben.
7. Para- und extraverbale Merkmale der Sprache
Diese Merkmale der Sprache haben meistens den Zweck, die verbale Aussage zu unterstützen. Die gegebene Information wird redundant übermittelt, was in manchen Fällen entschieden zur Eindeutigkeit beitragen kann. Während paraverbale Äußerungen, wie Betonung, Intonation, Pausen etc. nur in Verbindung mit verbalen vorkommen können, können extraverbale (Mimik, Gestik)auch für sichalleine stehen.
a) Paraverbal
« Et ça sent mau vais . » (18) - Laurent hebt durch die Betonung des Wortes «mauvais» hervor, wie schrecklich der Gestank ist.
«Quel horreur.» (19) - Wie in der Äußerung zuvor wird der Gestank durch diese Betonung veranschaulicht.
« J´ai trouvéun restaurant très intéressant. + Mais + le prix eh + terrible ! »
(30) - Durch mehrere offensichtliche Sprechpausen wird hier deutlich, wie ungern Bernard mit der Höhe der Rechnung rausrückt. Die Betonung von «prix» bringt den Gegensatz zu «intéressant» zum Ausdruck, d.h. die Einschränkung die zu machen ist, wenn man von einem „interessanten“ Restaurant spricht.
« Mais vousétiez deux ! » (41) - Hier kommt in der Betonung Martines Erstaunen zum Ausdruck, daßauf der Rechnung Gerichte für zwei Personen stehen.
« J´ai goûtéun peu à tout + pour des raisons professionnelles. » (43) - Diese Pause zeigt, daß Bernard in Schwierigkeiten steckt, eine brauchbare Erklärung zu finden.
« Tonaddition n´ est pas mal non plus . » (50) - Bernard geht in die Offensive über. Anstatt sich weiter zu verteidigen, greift er nun seinerseits Martinean. Er bringt durch die- se Betonung zum Ausdruck, daß er nicht der einzige ist, der sich etwas vorzuwerfen hat.
« J´étais seule . » (57) - Martine hebt in ihrer „Verteidigungsrede“ hervor, daß ihr niemand vorwerfen kann, sie habe die Gelegenheitausgenutzt und sei mit einigen Freuden essen gegangen.
(unwillig, monoton) « Oui. » (63) - Im Normalfall steigt oder fällt beim Sprechen die Stimme. Fallende Intonation bezeichnet einen Aussagesatz. In einem solchen Fall hat man das Gefühl, daß es sich um einenabgeschlossenen Sprechakt handelt. Hier jedoch senkt Martine ihre Stimme nicht, sie bleibtauf einer Tonhöhe.
Das vermittelt den Eindruck, daß diese Angelegenheit noch offen ist, daß dem noch etwas folgen wird bzw. muß.
« c´ est le meilleur restaurant de la région » (70) - Xavier ist davon überzeugt, daß es in der ganzen Region kein besseres Restaurant gibt. Diese Überzeugung bringt er hier sowie in der Formulierung „la meilleure cuisinière“ zu Ausdruck. In letzterem Fall kommt dazuauch noch die Möglichkeit, Mère Potiron ein Kompliment zu machen.
« Si vous ates libres, je vous yamène + ce soir » (73) - Durch die vorangegangene Pause erhält das ohnehin schon betonte Wort «ce» noch mehr Gewicht. Diese Betonung machtauf die Kurzfristigkeit des Vorschlagesaufmerksam.
« Ben + tuavais raison tout à l´ heure. » (85) - An seinem Zögern merkt man, daß es Bernard sehr schwer fällt, zuzugeben, daß Martine recht hat und er mit einer weiteren Person gegessen hat.
« La + la jeune filleavec laquelle j´ai d î né+a un goût excellent. » (89) - Die erste Pause läßt darauf schließen, daß er ungern gesteht, mit einer Frau zum Essen gewesen zu sein. Die zweite läßt erkennen, daß er versucht, sich ein plausibles Argument zurecht zu legen, warum Samantha mitkommen sollte.
« Elle s´ en moque + (reißt Bernard den Schnurrbartab) com plètement des journalistes. » (99) - Die Pause weistauch wieder darauf hin, daß das nächste Wort besonders wichtig ist. Die Betonung von «complètement» verdeutlicht zum einen, daß sie sich wirklich überhaupt nichtsaus Journalisten macht. Andererseits hängt sie direkt zusammen mit dem Impuls, der vom Abreißen des Bartes herrührt.
« > Ce soir, j´ai préparéune bouillabaise + » (112) - Der leise Ton gibt der Atmosphäre etwas ruhiges, gemütliches. Nach ihrer Ankündigung folgt eine Pause, in der sie zuerst einmal die Reaktionen ihrer Gästeabwartet, bevor sie weiterspricht.
« c´ est moi qui décide ce qu´ on mange < et il ne faut pas me contrarier. » (116)
- Indem sie lauter spricht, gibt La Mère Potiron ihrer Aussage einen resoluten Charakter. Wie mit ihrer Handbewegung will sieauch paraverbal betonen, daß sie keinen Wider- spruch duldet.
« > J´ai mauvais caractère. » (120) - An dieser Stelle leise zu Sprechen hat den Effekt einer unheimlichen,aber dennochangenehmen Atmosphäre.
b) Extraverbal
Martine signalisiert mit ihren Händen „ Langsam ! “ . (5) - Die Handbewegung, die Martinean dieser Stelle macht, unterstützt ihre Absicht, Ordnung in die Besprechung zu bringen und gibt die Aussage „Chacun son tour.“auf extraverbaler Ebene wider.
Martine verzieht das Gesicht. (19) - Diese Mimik unterstützt den Ausruf „Quel horreur !“. Extraverbal und verbal wird derabscheuliche Geruch des Fleisches in dem Kästchen deutlich. Auch die Tatsache, daß Martine sichanschließend den Handrücken vor die Nase hält, um ihre Nase vor dem Gestank zu schützen, trägt zur Verdeutlichung bei.
Bernard schreckt zurück. (21) - Wie zuvor bei Martine dientauch Bernards Reaktion dazu, dem Zuschauer den Geruch glaubwürdig darzustellen.
Martine wendet sich zu Bernard. (28) - Das sichan ihn Wenden ist schon ein Aus- druck dafür, daß sie jetzt mit ihm reden möchte. Verbal wird dies durch „Et toi Bernard ?“ausgedrückt.
Martine macht große Augen. (36) - Hierin kommt ihr Erstaunen über die Höhe der Rechnung zum Ausdruck.
Martine schaut von Einem zum Anderen. (75) - Diese Handlung wird verbal nicht näher erläutert. Sie steht für sich. Sie stellt ein „Ausloten“ oder Abwartenauf die Reaktion der übrigen Redaktionsmitgliederauf Xaviers Vorschlag dar. Nachdem keiner wider- spricht, stimmt sie zu.
Xavier macht ein „ Spitze ! “ -Zeichen. (68) - Mit diesem Zeichen verleiht der seiner Überzeugung Ausdruck, daß es sich dabei wirklich um dasallerbeste Restaurant handelt. In diesem Fall treffenalle drei Faktoren (verbal, paraverbal und extraverbal)aufeinander. Xavier spricht von «le meilleur», betont dieses Wort stark und macht zudem noch ein ent- sprechendes Handzeichen.
Xavier legt eine Handan seine Brust. (70) - Diese Geste muß im Zusammenhang mit «en tout cas pour moi» gesehen werden. Xavier stellt klar, daß zumindest er diese Ü- berzeugung vertritt.
Martine grinst hämisch. (93) - Ohne Samantha zu kennen, freut sich Martine schon darauf,auf ihre Kosten Bernard einsauswischen zu können.
Bernard wirft Martine einen vorwurfsvollen Blick zu. (95) - Dieser Blick soll Martine sagen: „Sei doch nicht zu unfair. Urteile nicht zu voreilig und gib ihr eine Chance.“
Xavier nimmt ihre Hände in die seinigen. (103) - Hiermit verdeutlicht Xavier, daß dies die soeben von ihm vorgestellte Person ist. Zugleich ist diese Geste Ausdruck eines vertrauten Verhältnisses zwischen den beiden.
Xavier formt seine rechte Hand zu einem „ Spitze ! “ -Zeichen. (105) - Wie bereits beim ersten Mal,als Xavier diese Geste benutzt, wird hier die Aussage unterstützt, daß es wirklich dieallerbeste Köchin ist.
Streicht ihm durch die Haare. (110) - Dies ist ein eindeutiges Zeichen für das ver- traute Verhältnis zwischen Xavier und La Mère Potiron. Sie verhält sich ihm gegenüber „mütterlich“.
Mère Potiron macht eine entschiedene „ Kopfab “ - Handbewegung. (117) - Diese Geste stehtals Symbol dafür, was passieren kann, wenn man ihr, wo sie doch so einen schlechten Charakter hat, widerspricht. Sie verdeutlicht, daß sie es ist, die bestimmt, was gegessen wird.
Schaut ihr nach, lächelt. (128) - Bernard ist von Samanthaangetan, was sich in seinem ganzen Verhalten widerspiegelt.
Martine rümpft die Nase. (129) - Wieallgemein gebräuchlich, istauch hier das Naserümpfen Ausdruck der Verachtung, der tiefen Antipathie.
Martine schaut sich gekünstelt um. (131) - Dies ist Teil ihrer Karikatur Samanthas, die sieals zu unnatürlich undarrogant empfindet.
Martine dreht den Kopf zu Seite. (137) - Diese Kopfbewegung signalisiert „Ach laßt mich dochalle in Ruhe.“
Martine verdreht die Augen. (145) - Hier spricht Martine eine Warnungan Bernardaus, er solle bloß ruhig sein, wenn er schon dieses schreckliche Wesen, daß sie so furchtbar nervt,angeschleppt habe. Sie gibt durch das Verdrehen ihrer Augenalso zu erkennen, wie genervt sie ist, und daß sie Bernard für die von ihrals schrecklich empfundene Situation verantwortlich macht.
Laurent schaut zuerst Martinean, dann Bernard, grinst. (145) - Laurent, der während der ganzen Szene über neutral geblieben ist, beobachtet den „Kleinkrieg“ zwischen Bernard und Martine belustigt und interessiert zugleich.
Bernard grinst vielwissend. (147) - Bernards Grinsen zeigt, daß er Martines Gehabe nichtallzu ernst nimmt. Er weiß es so zu deuten, daß Martine ihre „Vormachtstellung“ nicht verlieren möchte, was ihn letztlich sogaramüsiert.
8. Weitere linguistische Besonderheiten
a) Performative Verben
Performative Ausdrücke sind solche, bei denen das Aussprechen gleichzeitig schon die Handlung ist. In diesem Text stellt das Vorstellen einen solchen Ausdruck dar.
« Je vous présente Mère Potiron. » (104) - Indem Xavierausspricht „Ich stelle euch Mère Potiron vor“ findet die Vorstellung praktisch schon statt. Das Aussprechen ist die erwähnte Handlung.
Bei einer weiteren Handlung,auf die in diesem Ausschnitt zwar nicht näher eingegangen wird, die jedoch eines der situativen Themen der Folge darstellt, handelt es sich ebenfalls um ein performatives Verb. Beim Einladen ist der Sprechakt schon die eigentliche Handlung. Es wird keine Handlung benannt, die später erstausgeführt wird.
b) Isotopien
Innerhalb des Textes finden sich Isotopien, d.h. Begriffe, die sichauf der Ebene der lan gue einem bestimmten Wortfeld zuordnen lassen. Hier sind es in erster Linie Begriffe, die in irgendeiner Weise mit Restaurants zu tun haben:
restaurant, l´addition, prix, hors d´ oeuvre, viandes, poisson, bouillabaisse, cuisinière, g ô ut, g ô uter, manger, diner
Aberauch im Bereich des Journalismus lassen sich Isotopien finden:
enqu ate, raisons professionnelles, conscience professionnelle,analyse,assistante,avis, journaliste
Die Zugehörigkeit dieser Begriffe zu den gleichen Wortfeldern führt zur Verflechtung der einzelnen Sprechakte zu einem Text.
c) Sinn und Bedeutung
Als Bernard seine Assistentin erwähnt, fragt Martine nach: «Ta quoi ?» (84). Sie hat die Aussageakustisch verstanden, kann ihrauch semantisch eine Bedeutung zuordnen. Doch dadurch, daß sie nach der vorausgegangenen Diskussion davonausgegangen ist, daß Ber- nardallein war, hat sie Schwierigkeiten, den Sinn zu verstehen. Sie hat hierzu eine Erklä- rung Bernards nötig.
d) Kultureme
An einigen Stellen des Ausschnitts zeigen sich unserer Gesellschaft eigene Verhaltensweisen. Andererseits gibt esaberauch Verhaltensweisen, die man so nicht erwartet hätte, da sie unsals unüblich erscheinen.
« Chacun son tour. » (7) - In unserem Kulturkreis ist es üblich, daß Diskussionen oder Gespräche in einer geordneten Art und Weise stattfinden. Man läßt denanderenausreden, es gehört sich nicht, jemandem ins Wort zu fallen etc. «Chacun son tour.» kann bereitsals idiomatische Wendung bezeichnet werden.
« Quatre hors d´ oeuvre, deux viandes ... » (50) - Ebenso hat sich in unserer Gesell- schaft eine mehr oder weniger festgeschriebene Ordnung herausgebildet, in wieviele Gän-
ge ein Menü gegliedert sein sollte. Es erscheint unsals irrsinnig, vier Vorspeisen und zwei Fleischgerichte zu sich zu nehmen. „Normal“ wäre jeweils ein Gericht pro Gang.
« c´ est moi qui decide ce qu´ on mange. » (115) - Diese Aussage fällt vollkommenaus dem Bild dessen, was normalerweise in einem Restaurant erwartet wird. Als Kulturem hat es sich bei uns durchgesetzt, daß man zuerst einmal die Karte bekommt, und sich in Ruhe sein Essenaussuchen kann.
« Vous m´ excusez. » (126) - Auch das sich Entschuldigen wenn man den Tisch verläßt, umauf die Toilette zu gehen kann,als Kulturem bezeichnet werden.
e) Litotes
Auf die Frage Xaviers hin, wie denn die Umfrage läuft,antwortet Laurent mit einem «pas terrible» (66). Diese Verneinung des Gegenteils bezeichnet manals Litotes. Er bringt da- mit zum Ausdruck, daß es zwar einigermaßen läuft, derabsolute Durchbruchaber noch fehlt.
Schlußbemerkung
Durch Martines Ausdrucksweise, zum Beispiel dem Fehlen von Höflichkeitsfloskeln bei Aufforderungen, läßt sich die These belegen, Martine habe eine ü bergeordnete Stellung. Sie steht jedoch nicht klar über Laurent und Bernard, sondern hebt sich von diesen nur ein wenigab. Dies zeigt sich zum einen darin, daß sie sich duzen. Desweiteren drückt sich Bernard bei seine Bitten zwar sehr höflichaus und wirktauch verlegen, sobald er sich vor ihr rechtfertigen muß, nimmt sichandererseitsaberauch die Freiheit, Martine zu necken, was bei einem Chef inabsoluter Stellung höchst unangebracht wäre.
Ob Martine eifersüchtig ist, nicht mehralleine im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ihrer Kollegen zu stehen, läßt sich durch die Analyse nicht eindeutig belegen. Auf jeden Fall steht sie Samantha jedoch von Anfanganablehnend gegenüber, was sich vorallem in pa- ra- und extraverbalen Merkmalen widerspiegelt. Den Höhepunkt hiervon bildet sicherlich ihre Imitation gegen Ende des Ausschnitts, mit der sie versucht, Samantha ins Lächerliche zu ziehen.
Bereits in der ersten Szene wird das Spannungsverhältnis zwischen Martine und Ber- nard offensichtlich. Martines Mimik zeigt zunächst, daß sie sich überlegen fühlt. Imargu- mentativen Bereich kann Bernard jedoch mit ihr gleichziehen, so daß die Diskussion keine Lösung bringt, sondern vielmehrauf einem Spannungspunkt stehen bleibt. Auch im weite- ren Verlauf des Textes bedient sich Martine einer Ironie, die vom situativen Kontext her nichtangebracht erscheint. Sie zielt konkret daraufab, Bernard zu reizen, wobei sie in der Person Samanthas hierzu einen willkommenen Anlaß gefunden hat. Durch ihr übertriebe- nes Gehabe läuft Martine vorallem in der letzten Szene jedoch Gefahr, selbst lächerlich zu wirken. Dies kann man daran erkennen, daß Bernard und Laurent grinsen, siealso nicht mehr ernst zu nehmen scheinen.
Laurents Neutralität gründet sich in erster Linie darauf, daß er von der Kamera eher sel- ten erfaßt wird und wenig sagt. Martine und Bernard stehen im Mittelpunkt der Szene. Er äußert sichauch nicht über das Spannungsverhältnis der beiden; sein einziger Kommentar dazu ist ein Grinsen.
Xavier wirkt in der Szene schon durch seinen Beitrag zur Handlungals positiver Charak ter. Viele der von ihm benutzten Wörter sind positiv konnotiert, was mit zu einem guten Gesamtbild Xaviers beiträgt. Ebenso wird La Mère Potiron von ihrem ganzen Erscheinungsbild heralsangenehm empfunden.
Neben der primären Kommunikation im Fernsehdialog, die in der Arbeit näher betrach- tet wurde, gibt esauch eine sekundäre Kommunikation, die Kommunikation zwischen Film und Zuschauer. Wie in der Vorstellung des Gegenstands bereits erwähnt, stammt der Ausschnittaus der Fortsetzung des Feuilletons. Der Kontext für die Erläuterung des situa- tiven Lernziels der Arbeit, dem Einladen und dem Bestellen, stammtaus Teil I des Feuille- tons. Für den grammatischen Teil wird inhaltlich ebenfalls der erste Feuilleton verwendet. Bei dem untersuchten Ausschnitt fällt es daher schwer, eine sekundäre Komponente zu konkretisieren. Bedenkt manallerdings, daß es sich bei dem Kurs um einen Sprachkurs handelt, wird deutlich, daßauch ein Ausschnitt, deransonsten keinen Bezug zuanderen Teilen der Folge hat, durchaus eine didaktische Funktion erfüllt. Für das Erlernen einer Sprache bieten Dialoge von Muttersprachlern eine gute Möglichkeit, vorallem, wenn wie in diesem Ausschnitt, Informationen redundant vermittelt werden und der Zuschauerauch über Gestik und Mimik den Inhalt des Gesagten entnehmen kann.
Literaturverzeichnis
Michael Dürr / Peter Schoblinski, Einführung in die deskriptive Linguistik. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990.
Günther Drosdowski [Hrsg.], Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter, Mannheim: Dudenverlag, 1975
Bodo Harenberg [Hrsg.], Die Bilanz des 20. Jahrhunderts. Dortmund: Harenberg, 1991.
Stephen C. Levinson, Pragmatik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1990.
Theodor Lewandowski, Linguistisches Wörterbuch. (Band II) Heidelberg: 21976.
John Lyons, Die Sprache. München: C.H.Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 31990.
Walter Schludermann, Schulfernsehenaus mediendidaktischer Sicht. Unterrichtstechnologie / Mediendidaktik (Band 7), Alsbach: Leuchtturm-Verlag, 1981.
[...]
1 Michael Dürr / Peter Schlobinski, Einführung in die deskriptive Linguistik. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990, S. 151ff.
2 John Lyons, Die Sprache. München: C.H.Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 31990, S. 128. 1
1 ebda, S. 128ff.
2 Michael Dürr / Peter Schlobinski,a.a.O., S. 151ff.
3 Günther Drosdowski [Hrsg.], Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter, Mannheim: Dudenverlag, 1975, S.238.
1 Stephen C. Levinson, Pragmatik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1990, S.2.
2 Stephen C. Levinson, Pragmatik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1990, S.5f.
3 Theodor Lewandowski, Linguistisches Wörterbuch. (Band II) Heidelberg: 21976, S 513f.
4 Michael Dürr / Peter Schoblinski,a.a.O., S. 195ff.
5 Stephen C. Levinson,a.a.O., S. 206.
6 Theodor Lewandowski,a.a.O., S. 517f.
1 Michael Dürr / Peter Schoblinski,a.a.O., S. 199f.
2 Stephen C. Levinson,a.a.O., S. 236f.
3 Bodo Harenberg [Hrsg.], Die Bilanz des 20. Jahrhunderts. Dortmund: Harenberg, 1991, S. 286f. 4
1 Walter Schludermann, Schufernsehenaus mediendidaktischer Sicht. Unterrichtstechnologie/Mediendidaktik, Band 7. Alsbach: Leuchtturm-Verlag, 1981, S. 96ff.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser sprachlichen Analyse?
Die Analyse dient dazu, die Beziehungen zwischen Dialogpartnern besser zu verstehen. Sie betrachtet Kleinigkeiten und deren Bedeutung in Gesprächen, um den Erfahrungshorizont und die Wichtigkeit bestimmter Aspekte für Personen zu erkennen. Sie sensibilisiert für Sprache als Kommunikationsmittel, das mehr als nur Information vermittelt.
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Gegenstand ist die semantisch-pragmatische Analyse eines Ausschnitts aus Folge 20 der Unterrichtsreihe «Avec Plaisir».
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Grundlage linguistischer Termini und geht auf das Medium Fernsehen ein. Anschließend wird der Fernsehausschnitt vorgestellt, transkribiert und eine These aufgestellt. Die eigentliche Analyse gliedert sich in einzelne Themengebiete, und der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die theoretischen Grundlagen?
Die theoretischen Grundlagen umfassen Semantik (Bedeutungslehre), Pragmatik (Sprachgebrauch), das Medium Fernsehen und seine Rolle in der Gesellschaft sowie im Unterricht.
Was versteht man unter Semantik?
Semantik befasst sich mit der Inhaltsseite von Wörtern und deren Kombination im Satz. Es werden Konzepte wie Signifiant (Lautkette), Signifié (Bedeutung), semasiologische und onomasiologische Vorgehensweise, sowie Konnotationen betrachtet.
Was ist Pragmatik?
Pragmatik ist die Erforschung des Sprachgebrauchs unter Berücksichtigung des Handlungs- und Situationsbezugs, der Intention des Sprechers, seines Wissens und seiner Erwartungen sowie der des Hörers. Wichtige Begriffe sind Präsupposition und Perlokution.
Wie wird das Medium Fernsehen im Unterricht eingesetzt?
Es gibt verschiedene Arten des Schulfernsehens: Enrichment-Programm, Kontext-Programm (integrierter Fernsehunterricht) und Direct-Teaching-Programm (vollständiger Fernsehunterricht).
Wie ist der analysierte Textausschnitt strukturell und inhaltlich einzuordnen?
Der Textausschnitt stammt aus Folge 20 der Reihe «Avec Plaisir» und ist Teil des Abschnitts D, der die Fortsetzung eines Feuilletons darstellt. Die Szenen 1-3 des Ausschnitts dienen als Grundlage für die Analyse und umfassen das Resümee der Untersuchungsergebnisse in der Redaktion, eine kurze Szene vor «La Mère Potiron» sowie den ersten Teil des Essens im Restaurant.
Welche These wird in der Arbeit aufgestellt?
Die These besagt, dass im Ausschnitt die unterschiedlichen sozialen Rollen der Mitwirkenden zum Ausdruck kommen. Martine hat eine übergeordnete Stellung, während Laurent und Bernard eine untergeordnete Stellung haben. Es gibt Spannungen zwischen Martine und Bernard, während Laurent eine neutrale Position einnimmt. Xavier und La Mère Potiron werden als positive Charaktere wahrgenommen.
Welche Analysebereiche werden betrachtet?
Die Analyse gliedert sich in Themengebiete wie Semantik, Abhängigkeit der Sprachwahl von Kontext und sozialen Rollen, Präsuppositionen, Teilakte sprachlicher Äußerungen (lokutiv, illokutiv, perlokutiv), Konnotationen, Dissens und Konsens sowie para- und extraverbale Merkmale der Sprache.
Was sind Beispiele für die Analysebereiche im Textausschnitt?
Die Analyse illustriert die verschiedenen theoretischen Konzepte anhand konkreter Beispiele aus dem Textausschnitt, wie die Abhängigkeit von Äußerungen vom Kontext, soziale Rollen, Präsuppositionen, Sprechabsichten, Konnotationen von Wörtern, das Vorhandensein von Dissens und Konsens, und die Bedeutung para- und extraverbaler Signale.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen?
Die Schlussfolgerung bestätigt, dass Martine eine übergeordnete Stellung hat, aber nicht in einem absoluten Sinne. Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Martine und Bernard, und Martine steht Samantha ablehnend gegenüber. Laurent nimmt eine neutrale Position ein, und Xavier und La Mère Potiron werden als positive Charaktere dargestellt. Der Ausschnitt erfüllt auch eine didaktische Funktion für das Erlernen der Sprache, indem Informationen redundant vermittelt werden und der Zuschauer durch Gestik und Mimik den Inhalt des Gesagten entnehmen kann.
Welche Literatur wird verwendet?
Die Analyse stützt sich auf verschiedene linguistische Werke und Abhandlungen über Medien und Unterrichtstechnologien. Die vollständige Liste der verwendeten Literatur ist im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit zu finden.
- Quote paper
- Judith Dauster (Author), 1996, Semantisch-pragmatische Analyse eines Filmausschnitts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95588