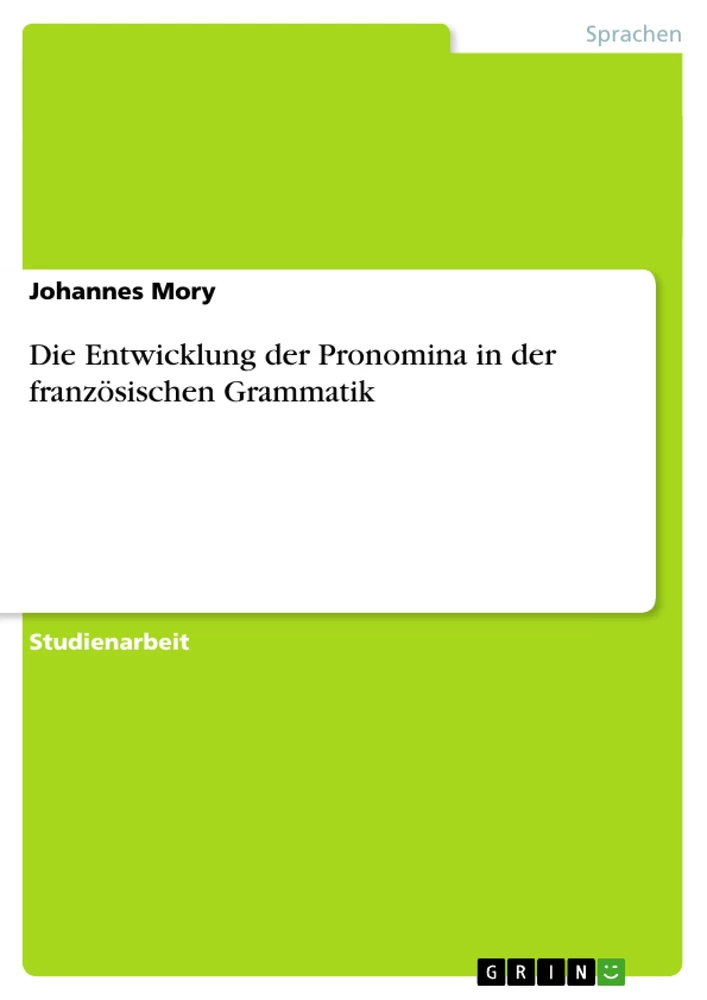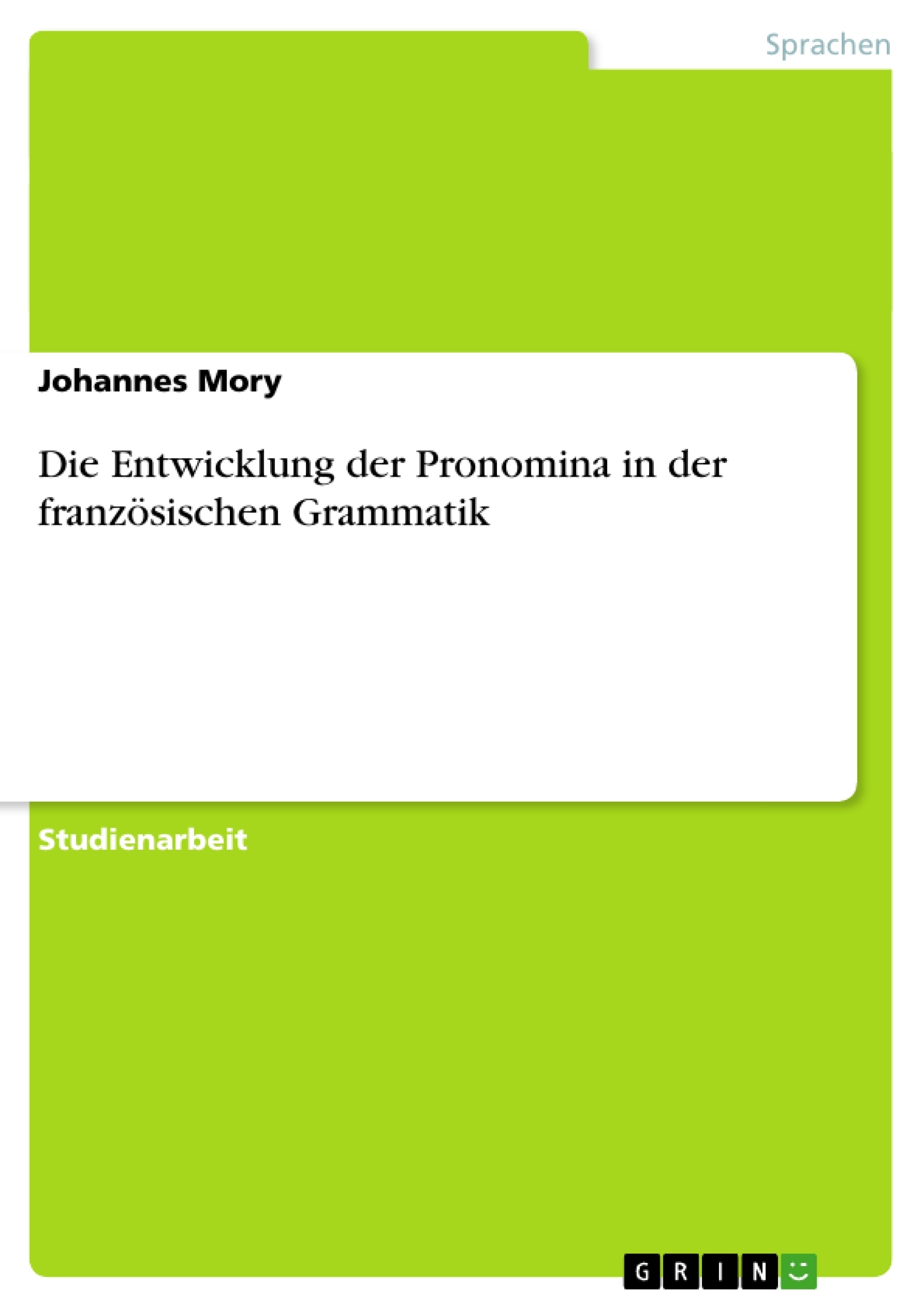0 Einleitung
Einleitend zu dieser Arbeit bedarf es einer Definition der verwendeten Termini, vor allem der Klärung des Begriffes Pronomen, da sich die damalige Auffassung dieses Terminus von der heutigen wie folgt unterscheidet:
Étienne Bonnot de Condillac (Grenoble 1714 - Flux bei Beaugency, 1780), dessen im Jahr 1775 erschienene Grammatik mir neben anderen, in Sekundärwerken zitierten zeitgenössischen Autoren - Abbé Jean FranVois Féraud (1725-1807) steht hier an erster Stelle - als Grundlage diente, benannte in seinem Cours d ’é tude pourl’ introduction du prince de Parme 1 die Wörter, die ein Substantiv auf irgendeine Art determinieren, als Adjektive, wobei dieser Begriff des Adjektivs nicht mit der heutigen Auffassung gleichzusetzen ist. Il, elle, le, la, les, tout und die meisten anderen uns heute bekannten Pronomina - Ausnahmen bilden u.a. y und en - zählten nach Condillac also auch zu der Gruppe der Adjektive, da sie - wenn auch mit Ellipse gesetzt, d.h. das determinierte, zuvor im Kontext genannte Substantiv fällt weg, wobei das an dieses Substantiv gebundene Gedankengut trotzdem transportiert wird - die Bedeutung eines Substantivs modifizieren: ² Nous avons vuqu’ il , elle, le, la sont dans le vrai des adjectifs employés avec ellipse; [...] qu’après avoir parléd’Alexandre, j’ajoute ilavaincu Darius, il , sera pour il Alexandre ,oùl’on voit que ce mot est un adjectif [...] aussi-tôtqu’ onaremplil’ ellipse.“2
Diese Gruppe der determinierenden Adjektive unterteilte Condillac in die Gruppe der ²noms de la troisième personne“3, zu der u.a. il, elle, ils, elles gehören und die Gruppe der Artikel der er u.a. le, la und les zuordnete, wobei angemerkt sei, daß Condillacs Auffassung der Artikel eine andere als die heutige war.
Ausgehend von dieser Klassifizierung argumentierte E. B. de Condillac, daß solche, mit Ellipse gesetzten Adjektive ² ont paru prendre la place des nomsqu’ on supprime, & ils sont devenus des pronoms, c’est-à-dire, des noms employés pour des noms qui ontétéé noncés auparavant, & dont on veutéviter la répétition.“4 Wenn man Condillac als einen der berühmtesten Linguisten des 18. Jh. mit seinen Forschungsergebnissen als repräsentativ für die Sprachforscher dieses Jahrhunderts sieht, war das Pronomen für die Grammatiker dieser Zeit also eine Funktion, die eine bestimmte Wortklasse in einem Satzgefüge annehmen konnte, und nicht, wie wir heute wissen, eine eigenständige grammatische Wortklasse.
In diesem Sinne beziehe ich mich in meiner Darstellung auf die damalige Auffassung der Pronomina, wobei ich in meiner Beschreibung auf die Possessivpronomina und ähnliche Phänomene, deren Anwendung sich bis heute praktisch nicht geändert hat, zugunsten interessanterer Bereiche verzichten werde.
1. Zeitlicher Kontext
Im 17. Jh. orientierten sich die Sprachforscher - und allen voran Claude Favre de Vaugelas (1585- 1650) mit seinen Remarques sur la langue fran V oise (1647) - an der am Hof, genauer von der ² plus saine partie de la Cour “5 gesprochenen französischen Sprache, deren Besonderheiten sie deskriptiv festzuhalten versuchten, während die Sprache des Volkes als „per Definition schlecht“6 abgetan wurde. Gegen Ende des 17. Jh. und am Anfang des 18. Jh. setzte sich aber eine ²strenge Kodifizierung und ein fixierter, hierarchisch geordneter Wortschatz“ und ²als Grundlage der Grammatik [...] das Prinzip der Logik durch“, was eine deutliche Akzentverlagerung von der gesprochenen zur geschriebenen Sprache zu Folge hatte, auf die die logischen Prinzipien der Grammatik leichter anzuwenden waren. Die Sprachforscher wendeten sich jedoch wenig später wieder der gesprochenen, sich ständig verändernden Sprache zu, da sich die Kluft zwischen der gesprochenen und der geschriebenen, unflexiblen französischen Sprache vertiefte. Doch schon Vaugelas wußte, daß es ein „hoffnungsloses Unterfangen sei, jeden Aspekt der Sprache rational erfassen zu wollen“ und ging z.B. davon aus, daß es ²logische Gründe dafür gibt, einen Relativsatz nicht von einem Substantiv abhängen zu lassen, das ohne den bestimmten Artikel steht.²7
Infolge der oben genannten Tatsachen bemühten sich die Grammatiker des fortgeschrittenen 18.
Jh., einen normierenden Kompromiß zu finden zwischen der Schriftsprache, die als Sprache par excellence galt, und der gesprochenen Sprache, die aufgrund möglichst unmißverständlicher Kommunikation schon eine gewisse Eindeutigkeit bezüglich der Beziehungen der einzelnen Satzelemente untereinander aufwies. So wies auch Jean-FranVois Marmontel (1723-1799), ein namhafter Schriftsteller und Philosoph des 18. Jh. darauf hin, ²wie absurd es sei, den tatsächlichen Sprachgebrauch aus der Literatur zu verbannen²8, da er die reale Sprache repräsentiere und es sonst zu einer Verschärfung der Kluft zwischen gesprochener und Schriftsprache kommen könne. Trotzdem wird der Sprachgebrauch der klassischen Vorbilder wie Racine und Voltaire kaum kritisiert, obwohl die von ihnen benutzte Sprache den Grammatiken und Erkenntnissen des 18. Jh. widerspricht.
Die allgemeine Tendenz dieser Zeit läßt sich wie folgt zusammenfassen:
Das Bedürfnis nach Fixierung und Eindeutigkeit der französischen Sprache und die steigende Wichtigkeit von Bedeutungsnuancen , d.h. die Wahl des richtigen Wortes in der richtigen Abfolge und klarem Bezug, dominierten die Gewohnheit, die Sprache frei und flexibel innerhalb eines weit gefaßten Rahmens von grammatischen Regeln zu handhaben.
2. Das Pronomen
Der Erfolg der Sprachforscher im 17. Jh., die aus dem Lateinischen stammende Postdeterminierung zugunsten der Prädeterminierung durch das Substantiv bzw. durch das entsprechende Pronomen nahezu vollständig aus der französischen Sprache zu eliminieren, - oder sie zumindest parallel zu installieren, wie es bei der 1. Und 2. Person Plural der Fall ist - bildete die Grundlage für eine lebhafte Diskussion im 18. Jh., ob, oder unter welchen Umständen das Pronomen fakultativ oder obligatorisch zu setzen sei.
Die allgemeine Tendenz, ² àchaque verbe son sujet ²9, d.h. die allgemeine Etablierung der Pronomina, zählte zu den wichtigsten Schritten der Syntax in der Sprachentwicklung im Französischen und diente dazu, Redundanzen zu vermeiden, größtmögliche Eindeutigkeit bei abwechslungsreicher Wortwahl zu erzielen und die Bezüge der einzelnen Satzelemente zueinander zu klären; außerdem ersetzte das Pronomen ² un nom avec toutes les modifications qui lui ontétédonnées ²10 oder sogar eine Nominalgruppe.
Um den vielfältigen, oft unklaren Gebrauch der Pronomina zu reglementieren, schränkte Condillac die Bedingung für deren Einsatz folgendermaßen ein: ²[ Les ] pronoms doivent réveiller la m ême idée que les noms dont ils prennent la place ²11
Es wurden deshalb folgende syntaktischen Vorgehensweisen ohne Wiederaufnahme des Themas durch das entsprechende Pronomen verboten:
1. Ein Wechsel des Themas,
2. Ein Wechsel von der negativen zur affirmativen Form,
3. Ein zu langer Abstand zwischen dem Pronomen und seinem Bezugswort,
4. Bei durch mais,où, puis oder Aufzählungen aneinandergereihten Haupt- und/oder Nebensätzen und ganz generell:
5. Das Weglassen des Pronomen der 1. oder 2. Person Singular.12
Im 18. Jh. wurde auch die heutige Regel installiert, daß ²das pronominale Objekt immer nach dem Imperativ stehen sollte²13 und nicht, wie es noch im klassischen Französisch der Fall war, bei zwei koordinierten Imperativen vor dem zweiten stehen sollte. Die allgemeine Sprachpraxis, bei einem Satzgefüge mit Infinitivkonstruktion müsse das pronominale Objekt zwischen den beiden Elementen der Negation stehen, wie bei pour ne le pas voir wich erst zu jener Zeit der heutigen Konstruktion, das Pronomen vor dem Infinitiv zu setzen: Pour ne pas le voir.
Eine andere Neuerung des 18. Jh. - wenn auch in der gesprochenen Sprache schon oft praktiziert - war die folgende Regel: ²Il, qui, que, dont, lequel, le, on,où, celui ne doivent pas se rapporteràun nom pris dans une signification indéfinie, et qui forme un sens indépendamment de ce qui peut suivre.²14
Auch die bereits im Jahr 1538 formulierte Regel, um die Angleichung des Partizip Perfekt an das
vorangestellte Objektpronomen im Akkusativ zu reglementieren, wurde erst Ende des 17. Jh. und Anfang des 18. Jh. konsequent realisiert.
2.1 Das Personalpronomen
Ein wichtiger Punkt bei der Betrachtung der Pronomina war das Bedürfnis nach Eindeutigkeit, welches Pronomen einen leblosen Gegenstand und welches eine Person implizierte, was bis Mitte des 17. Jh. nur aus dem Kontext erschlossen werden konnte. Condillac unterscheidet den Gebrauch der Objektpronomina lui, elle und eux für Menschen oder menschenähnliche Verhältnisse (z.B. geliebte Haustiere), von en und y für Gegenstände Nutztiere oder einer Menschenmenge. Er ordnet die mit den Präpositionen de und à kombinierten Objektpronomina der ersten Gruppe zu, wie bei ² je m’approchai d’elle ² (eine Frau) im Gegensatz zu ² je m’en approchai ²15 (eine Armee oder ein Berg). Condillac macht eine Ausnahme: ² Les prépositions avec & après n’emp êchent pas [les pronoms lui und elle ] qu’on les dise des choses ²16, womit er der Meinung vieler Grammatiker - darunter Vaugelas - widersprach, die die generelle Regel aufgestellt hatten, ² lorsque ces pronoms sont précédés d’une préposition, ils ne se disent des choses, que dans le casoùelles ontétépersonnifiées.²17
Das heute geläufige Subjektpronomen on schloß Condillac von seiner Betrachtung der Pronomina aus, da er argumentierte, ²on ou l’on [...] n’est pas un pronom, puisqu’iln’ est jamais employéàla place d’aucun nom. ²18 In einem späteren Absatz fügte er hinzu, ²on & l’on sont les noms d’une troisième personne considérée vaguement. [...] Ils sont toujours le sujet d’une proposition; [...] ils viennent, par corruption, du mot homme²19, womit er on den Status eines Pronomen in seinem Sinn zusprach, da es anstelle des unterdrückten Nomen homme trat.
Die Fixierung der Pronomina in der französischen Sprache führte streckenweise zu einer Überreaktion, d.h. zu Pleonasmen, die nicht nur in der gesprochenen Sprache, sondern auch in der Literatur zu finden waren; zuerst wurde das hervorzuhebende Thema durch die forme lourde
benannt, der Satz aber mit der forme légère weitergeführt: Die ältere Form ² Moy m’en allais de
mon côté ² wurde von der Académie zu ² Moy, je [ m’en allais de mon côté ]²20 korrigiert, was angesichts der Innovation im Französischen, das Setzen der Pronomina zu normieren, durchaus als Überreaktion zu bewerten ist. Dies gipfelte in ² un vrai tic: ‘ Oh, je voudrais de la conversation, moi. ’ ²21 Ein anderer Hinweis auf die steigende Wichtigkeit des Pronomen: ² ses emplois substantivés se multiplient: ‘ S’il est lui quand il joue, quand cessera-t-il d ’être lui ?’(Diderot) ²22
Ein anderes Phänomen der französischen Sprache im 18. Jh. war die bereits von der Académie verbotene, trotzdem gängige und in der Literatur verwandte Konstruktion, ein mit dem unbestimmten Artikel gesetztes Nomen durch ein Pronomen im Nebensatz zu ersetzen, wie bei ² un eunuque [...], il vit le manteau du roi ²23.
Das obligatorische Setzen des neutralen Objektpronomen le löste dessen in den Texten des 17. Jh. vor den Verben vouloir und pouvoir noch gängige représentation non faite ab: ²[...] comme nous avons dit [ est ] corrigéparl’ Académie en comme nous l ’avons dit²24
2.2 Das Demonstrativpronomen
Bei der Gruppe der Demonstrativpronomina ist die Orientierung an der gesprochenen Sprache deutlich zu erkennen.
Die Suffixe -ci / -là wurden zur Angabe nah/fern, ²früher in den Demonstrativa selbst enthalten, [...] an die substantivische Form oder an Substantive, die mit den adjektivischen Formen stehen, angehängt.²25
Das früher fakultative Setzen von ce und celui wurde von der Académie verbindlich vorgeschrieben. Voici qui wird zu voici celui qui korrigiert, wenn celui auch immer häufiger an ein complément gebunden ist, die auch in der Literatur immer mehr variieren. Wendungen wie ² je
demandaiqu’ avait Madame ²26 werden zu Archaismen erklärt; das direkte und/oder indirekte, vom
Verb abhängende Objekt muß - entweder in Form eines Nomen oder eines Pronomen - formuliert werden, wie bei je demandai cequ’ avait Madame.
Cela - die ²Reduktion von cela zu V a ist bereits im frühen 18. Jh. belegt, ist aber sicher älter²27 - rückte in bestimmten Wendungen an die Stelle des unpersönlichen il und konnte im Gegensatz zu heute sowohl Personen oder Gegenstände als auch einen Sachverhalt bezeichnen. ² On désigne couramment la personne par cela , ‘ fortàla mode’, suivant Féraud: ‘ Celan’apas vingt ans ’ ²28, obwohl Féraud gleichzeitig im neutralen le in je le trouve charmant anstelle von je trouve cela charmant als einen ² jargon précieux et moderne ²29 sieht.
Um dem Verlangen nach Eindeutigkeit, d.h. nach verschiedenen Signifikanten für Personen und leblose Gegenstände zu entsprechen, wurde sorgfältig zwischen ² c’est lui (personne) und cel’ est (chose)²30 unterschieden. Trotzdem gab es eine Entwicklung der Personen bezeichnenden Demonstrativpronomina von il über cela zu ce, deren ² caractère général ²31 oft unterschätzt wurde. Dies wird u.a. daran deutlich, daß il / elle / ce est oft - ggf. sogar mit Substantiven kombiniert - zu c’est vereinheitlicht wird: ² C’est affreux [...], c’est de sonâge ²32, während ce mit anderen Verben als être kombiniert zu verschwinden droht, wie bei der Wendung ² quand ce vintàpayer. ²33 Im späteren Verlauf der Sprachentwicklung setzt sich eine klare Unterscheidung durch zwischen celui für einen konkreten, vorher verbalisierten Bezug oder für eine Person und V a / cela für einen generellen Sachverhalt, jedoch nicht mehr für Personen.
2.3 Das Relativpronomen
Dem Bereich ² des pronoms ‘ conjonctifs’(=’relatifs’chez les linguistes suisses) ²34 muß
besondere Aufmerksamkeit zukommen, da sich hier die bis heute gängigen Relativpronomina - nach dem ² loi de la jungle ²35 - im jeweiligen, klar umrissenen Anwendungsgebiet etabliert haben. Es gibt jedoch wenig allgemeines zu sagen, deshalb werde ich die Relativpronomina mit ihrer Reduzierung von einer allgemeinen auf eine konkrete Bedeutung mit wenig Interpretationsspielraum einzeln abhandeln. Einzig die Bedingungen für ihren Gebrauch lassen sich generell formulieren: ²Das Bezugswort des Relativpronomen steht so nah wie möglich bei diesem und der Relativsatz darf kein unbestimmtes Substantiv bestimmen.²36
Où, bis ins 18. Jh. hinein auch für nicht-lokale Sachverhalte gebraucht, wie ²[ le fait ] oùil faut penser ²37, wird ausschließlich auf zuvor präzisierte örtliche Angaben beschränkt - wie es heute noch gebraucht wird - obwohl in diesem Bereich durch dont, ² qui rentre triomphalement dansl’ usage ²38 Interferenzen in den Bedeutungen entstanden. Gegen Ende des 18. Jh. ergibt sich ein weiterer Anwendungsbereich, da où anstelle von que verstärkt für zeitliche Relationen eingesetzt wurde: ² L’hiver [ où ] il fit si froid. ²39
Lequel / laquelle, von Rickard sorgfältig von quel (Adj.) unterschieden und ² en recul depuis le XVIIe siècle ²40 wurde überwiegend aus Gründen der Eindeutigkeit und zur Vermeidung von Redundanzen gesetzt. Der Gebrauch wurde weiter eingeschränkt, indem lequel, außer in Fällen von Zweideutigkeit oder zwei ² qui consécutifs [...] continueàêtre refoulédans le style judiciaire ²41. Die einzige Ausnahme bildete die Kombination mit de zu duquel. Rickard schließt sich der Meinung an, daß ²als Relativpronomen [...] lequel nur noch nach Präpositionen gebraucht werden [darf].²42
Dont, lange Zeit zugunsten von de qui in die Schriftsprache verbannt und mit äußerst unklarem Bezug verwendet, etablierte sich im 18. Jh. wieder in der gesprochenen Sprache. Die von der Académie installierte Regel, dont dürfe nicht anstelle von d ’où örtlich gebraucht werden, wird von Voltaire (1694-1778) in ² arrivésur le bord dont on voyait Babylone ²43 mißachtet.
Que hatte weiterhin die Rolle des ² substitut des conjonctifs prépositionnels ²44 ; die im 18. Jh.
gängigen Anwendungsbereiche wurden in drei Punkten wie folgt zusammengefaßt:
1. Für eine zeitliche Relation: ² L’hiver qu ’ il fit si froid ²45, obwohl que in zunehmenden Maß von où verdrängt wurde, wie oben bereits am selben Beispiel ausgeführt.
2. Für einen Ort: ² Je tournois la t ête du côté que venait la voix ²46, obwohl besonders in diesem Bereich où wenig später dominierte.
3. Für die Art und Weise nach dem Modell von Jean Racine: ² Me voyait-il del’ oeuil qu ’ il me voit aujourd’hui? ²47 doch im Verlauf des Jahrhunderts etablierte sich dont in diesem Bereich parallel. Es ist offensichtlich, daß das vorherrschende que zugunsten präziserer Relativpronomina im Sinn einer auf Bedeutungsnuancen achtenden Sprache seine Vormachtstellung verlor. Que etablierte sich wiederum anstelle des aussterbenden àqui, wie in der Sprachwendung ² C’estàvous que je parle ² anstatt ² c’estàvous àqui je parle. ²48
Qui durfte sich, sowohl relativ als auch interrogativ gebraucht, nur auf Personen beziehen.
2.4 Das unbestimmte Pronomen
Condillac akzeptierte das neutrale, unpersönliche il als Pronomen, obwohl es kein Nomen zu ersetzen schien. ² C’est lorsqu’onl’ empoye avec les verbes quin’ ont ni premiere, ni seconde personne, telqu’ il faut , [...] il pleut.²49 Er begründete seine Entscheidung damit, daß das nicht verbalisierte, zu ersetzende Bezugswort des unbestimmten il trotzdem existiere: ² Il pleut ² stand also für das in der Wendung implizierte ² il ciel pleut. ²50 Il konnte auch eine ganze Nominalgruppe ersetzen: Il m’est impossible de te voir aujourd’hui.
Il konnte nur in feststehenden Redewendungen weggelassen werden: ² Qu ’àcela ne tienne, d ’oùvient que (Féraud)²51, obwohl Féraud die Regel mit der Wendung ² àquoi sert-il ²52 brach.
Formulierungen wie ² suffit que je le nomme (Corneille)² oder ²’ Ainsi arriva de moi’sont
considérés comme des archaïsmes. ²53
Für die folgenden unbestimmten Pronomina galt, daß ² l’emploi des indéfinis tendàse fixer exactement tel que nous connaissons [ aujourd’hui ] .²54
Nul wurde von den Grammatikern des 18. Jh. weitgehend aus der Sprache verbannt, erhielt aber seine Bedeutung damals wie heute durch seinen häufigen Gebrauch in der gesprochenen Sprache. Rien: Hier hatte sich im 18. Jh. noch keine einheitliche Regel für den Gebrauch etabliert; Redewendungen wie ² passer la vieàrien faire ² wurden stark kritisiert, während ² Y a-t-il rien que ...? ²55 von der Académie akzeptiert wurden.
L’autre wurde von der Académie zurückgewiesen, wenn es nicht, mit l’ un kombiniert, einer Gegenüberstellung diente.
Chacun sollte seinen generalisierenden Aspekt konservieren, während der Sprachgebrauch in der Regel lehrte, daß chacun als Singular zu behandeln sei.
M ême verlor, wenn vorangestellt, seine Bedeutung ‘selbst’. Als Konsequenz von sprachlichem Mißbrauch wurde le m ême sowohl für la m ême chose als auch im Sinn von pareil verboten. On wurde, wie oben erwähnt, von Condillac nicht als Pronomen anerkannt. Der sich langsam vollziehende Wechsel in der gesprochenen Sprache vom lateinisch-postdeterminierenden nous hin zum französisch-prädeterminierenden on begann jedoch schon im 18. Jh. und war definitiv dem mündlichen Sprachgebrauch zugeordnet.
Quiconque alleinstehend ist ein klassisches Äquivalent für qui que ce soit, wurde aber trotz häufigem, vorwiegend mündlichem Gebrauch von den Grammatikern ignoriert.
2.5 Andere Pronomina
En, pronominal an die Präposition de gebunden, wurde vor allem für Gegenstände, abstrakte Sachverhalte oder als Mengenangabe gebraucht. Séguin zitiert Voltaire, welcher von einem Wechsel zwischen en und son sprach, der seine Entsprechung im Wechsel lebendig/leblos fand; Voltaire
korrigierte ² la paixqu’ elleajurée en a calméla haine ² zu ²[...] a du calmer sa haine. ²56 Der
selbe Wechsel bot Anlaß zu einer weiteren Unterscheidung zwischen einfacher und zusammengesetzter Satzergänzung: ² Paris est beau, j ’ en admire les promenades; on admire la grandeur de ses bâtiments ²57, während Condillac den Gebrauch von en verbindlich vorschrieb und das Possessivpronomen nur unter der Bedingung akzeptierte, daß en nicht gesetzt werden konnte.
Für das Pronomen y galt die gleiche Regel, gebunden an die Präposition à, obwohl Prévost schrieb: ² Ayant aimétendrement son fils, iln’ y trouveàla finqu’ un fripon qui le déshonore. ²58 Zu der Wortabfolge dieser beiden Pronomina ² àplus juste titre [...] puisqu’ilsn’ ont jamais pu avoir d’autre emploi ²59 läßt sich sagen, daß il en y a bereits um die Mitte des 17. Jh. durch das einheitliche, bis heute erhaltene ilyena ersetzt wurde.
Ein anderes Phänomen des 18. Jh. ist die Entdeckung der neuen Pronomina soi und quoi. Die mit diesen neuen Pronomina - die bei Condillac nicht erwähnt wurden - einhergehenden Unklarheiten, wann lui und wann soi gesetzt werden müsse, wurden früh geklärt, indem die Sprachforscher lui einer namentlich genannten Person und soi einer unbestimmten, allgemein benannten Person zuordneten.
Das unbestimmte Relativpronomen quoi durfte sich ausnahmslos auf leblose Gegenstände beziehen, womit ²die frühere Möglichkeit, quoi (nach Präpositionen) mit Bezug auf Personen zu gebrauchen, verschwindet.²60
3. Schluß
Es ist anhand der oben ausgeführten Veränderungen der Einsatzgebiete der verschiedenen Pronomina in der französischen Sprache offensichtlich, daß im 18. Jh. viele entscheidende Entwicklungsschritte vom Mittelfranzösisch hin zum uns heute geläufigen Neufranzösisch stattgefunden haben. Gleichzeitig ist aber eine Diskrepanz zu verzeichnen zwischen dem Willen, die französische Sprache einheitlich zu reglementieren und der Praxis, die diesen Regeln zuwiderlaufenden Redewendungen der klassischen Vorbilder mit geringer, nicht weiter ins Gewicht fallender Kritik hinzunehmen.
Abschließend muß ich anmerken, daß einige der oben gestrafft behandelten Bereiche hätten vertieft werden müssen, was jedoch den Rahmen dieser Arbeit bei weitem gesprengt hätte.
4. Bibliographie
- Condillac, E. B. de: Cours d ’àtude pourl’ introduction du prince de Parme: Grammaire. Nouvelle impression ..., Stuttgart 1986.
- Grammaire générale et raisonnée ou La grammaire de Port Royal, Hrsg. Herbert E. Brekle, Friedrich Frommann Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt 1966.
- Rickard, P.: Geschichte der franz ö sischen Sprache, Tübingen 1977.
- Séguin, J.-P.: La langue fran V aise au XVIIIe siècle, Paris 1972.
- Swiggers, P.: Grammaire et théorie du langage du XVIIIe siècle, Lille 1986.
[...]
1 Condillac, E. B. de: Cours d ’é tude pourl’ introduction du prince de Parme: Grammaire. Nouvelle impression ..., Stuttgart 1986.
2 Ebd., S. 231.
3 Ebd., S. 231.
4 Ebd., S. 231/232.
5 Rickard, P.: Geschichte der franz ö sischen Sprache, Tübingen 1977, S. 119.
6 Ebd., S. 119
7 Ebd., S. 119.
8 Ebd., S. 123.
9 Séguin, S. 102.
10 Condillac, S. 232.
11 Ebd., S. 236
12 Séguin, J.-P.: La langue fran V aise au XVIIIe siècle, Paris 1972.
13 Rickard, S. 128.
14 Séguin, S. 109.
15 Condillac, S. 239.
16 Ebd., S. 239.
17 Ebd., S. 239.
18 Ebd., S. 233.
19 Ebd., S. 243.
20 Séguin, S. 103.
21 Ebd., S. 103.
22 Ebd., S. 104.
23 Ebd., S. 103
24 Ebd., S. 104.
25 Rickard, S. 127.
26 Séguin, S. 104.
27 Rickard, S. 126.
28 Séguin, S. 105.
29 Ebd., S. 105.
30 Ebd., S. 108..
31 Ebd., S. 105.
32 Ebd., S. 105.
33 Ebd., S. 105.
34 Ebd., S. 105.
35 Ebd., S. 105.
36 Rickard, S. 129.
37 Séguin, S. 105.
38 Ebd., S. 106.
39 Ebd., S. 106.
40 Ebd., S. 106.
41 Ebd., S. 106.
42 Rickard, S. 127.
43 Séguin, S. 106.
44 Ebd., S. 106.
45 Ebd., S. 106.
46 Ebd., S. 106.
47 Ebd., S. 106.
48 Ebd., S. 106.
49 Condillac, S. 237.
50 Ebd., S. 237.
51 Séguin, S. 103.
52 Ebd., S. 103.
53 Ebd., S. 103.
54 Ebd., S. 106.
55 Ebd., S. 107.
56 Ebd., S. 108.
57 Ebd., S. 108.
58 Ebd., S. 108.
59 Condillac, S. 232.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der ursprüngliche Kontext dieses Textes?
Der Text ist eine linguistische Analyse von Pronomen im Französischen des 17. und 18. Jahrhunderts. Er untersucht die damalige Auffassung und Verwendung von Pronomen im Vergleich zur heutigen.
Wie unterschied sich die damalige Definition von Pronomen von der heutigen?
Im 18. Jahrhundert betrachteten Linguisten wie Condillac Pronomen als eine Funktion, die bestimmte Wortklassen (Adjektive mit Ellipse) in einem Satzgefüge annehmen konnten, anstatt als eine eigenständige grammatische Wortklasse.
Welchen zeitlichen Kontext behandelt der Text?
Der Text konzentriert sich auf das 17. und 18. Jahrhundert, wobei der Übergang von einer deskriptiven Sprachbetrachtung (basierend auf der Sprache des Hofes) zu einer stärker kodifizierten und logisch orientierten Grammatik analysiert wird.
Was waren die wichtigsten syntaktischen Veränderungen in Bezug auf Pronomen?
Die allgemeine Etablierung der Pronomina, um Redundanzen zu vermeiden, Eindeutigkeit zu gewährleisten und Bezüge zu klären, war ein wichtiger Schritt. Die obligatorische Setzung von Pronomen und die Einschränkung bestimmter syntaktischer Konstruktionen ohne Pronomen wurden ebenfalls diskutiert.
Wie wurde der Gebrauch von Personalpronomen im 18. Jahrhundert geregelt?
Es gab ein Bedürfnis nach Eindeutigkeit, welches Pronomen einen unbelebten Gegenstand und welches eine Person implizierte. Die Verwendung von "lui," "elle," und "eux" für Personen und "en" und "y" für Gegenstände wurde unterschieden, obwohl es Ausnahmen gab.
Welche Veränderungen gab es bei Demonstrativpronomen?
Die Suffixe "-ci" und "-là" wurden zur Angabe von Nähe/Ferne verwendet. Die Setzung von "ce" und "celui" wurde verbindlich vorgeschrieben. "Cela" konnte im Gegensatz zu heute sowohl Personen oder Gegenstände als auch einen Sachverhalt bezeichnen.
Wie veränderte sich der Gebrauch der Relativpronomen?
Die Relativpronomen etablierten sich in ihren jeweiligen Anwendungsgebieten. "Où" wurde hauptsächlich auf örtliche Angaben beschränkt. "Lequel/laquelle" wurde überwiegend aus Gründen der Eindeutigkeit verwendet. "Dont" etablierte sich wieder in der gesprochenen Sprache. "Que" verlor an Bedeutung zugunsten präziserer Relativpronomen.
Gab es Veränderungen bei unbestimmten Pronomen?
Condillac akzeptierte "il" als Pronomen, auch wenn es kein Nomen zu ersetzen schien. Für die anderen unbestimmten Pronomina galt, dass sich ihr Gebrauch zunehmend festlegte.
Welche Rolle spielten "en" und "y"?
"En" wurde pronominal an die Präposition "de" gebunden und vor allem für Gegenstände oder abstrakte Sachverhalte verwendet. Für "y," gebunden an die Präposition "à," galt die gleiche Regel.
Welche neuen Pronomina wurden entdeckt?
Die neuen Pronomina "soi" und "quoi" wurden entdeckt. "Lui" wurde einer namentlich genannten Person und "soi" einer unbestimmten, allgemein benannten Person zugeordnet. "Quoi" durfte sich ausnahmslos auf leblose Gegenstände beziehen.
Welche bibliographischen Angaben werden im Text erwähnt?
Der Text listet folgende Werke auf:
- Condillac, E. B. de: Cours d ’àtude pourl’ introduction du prince de Parme: Grammaire.
- Grammaire générale et raisonnée ou La grammaire de Port Royal.
- Rickard, P.: Geschichte der franz ö sischen Sprache.
- Séguin, J.-P.: La langue fran V aise au XVIIIe siècle.
- Swiggers, P.: Grammaire et théorie du langage du XVIIIe siècle.
- Quote paper
- Johannes Mory (Author), 2000, Die Entwicklung der Pronomina in der französischen Grammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95554