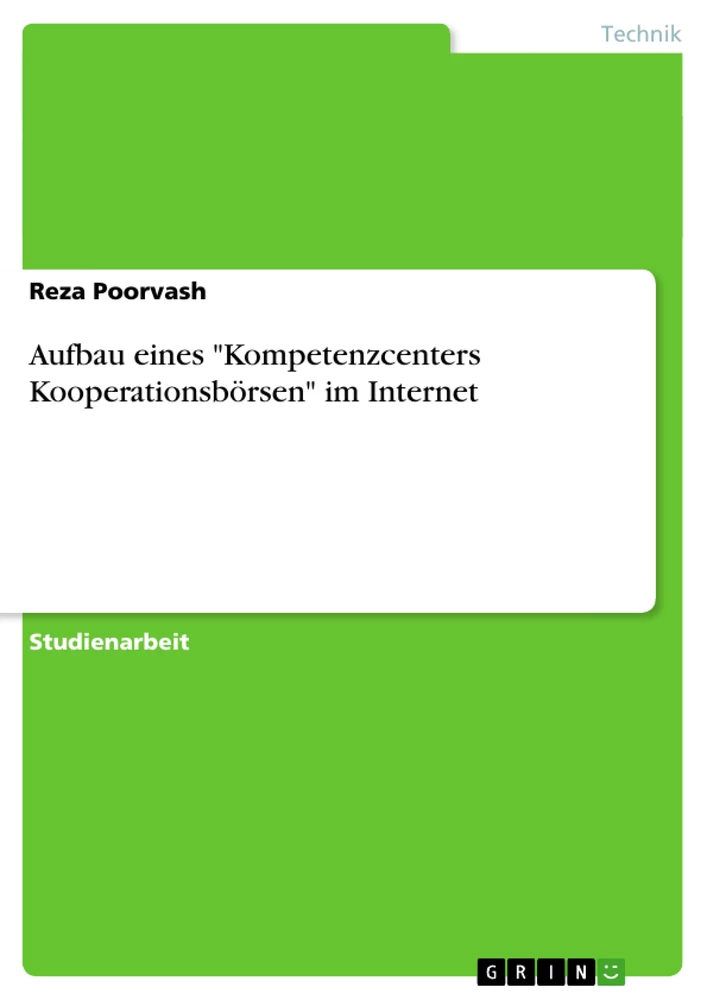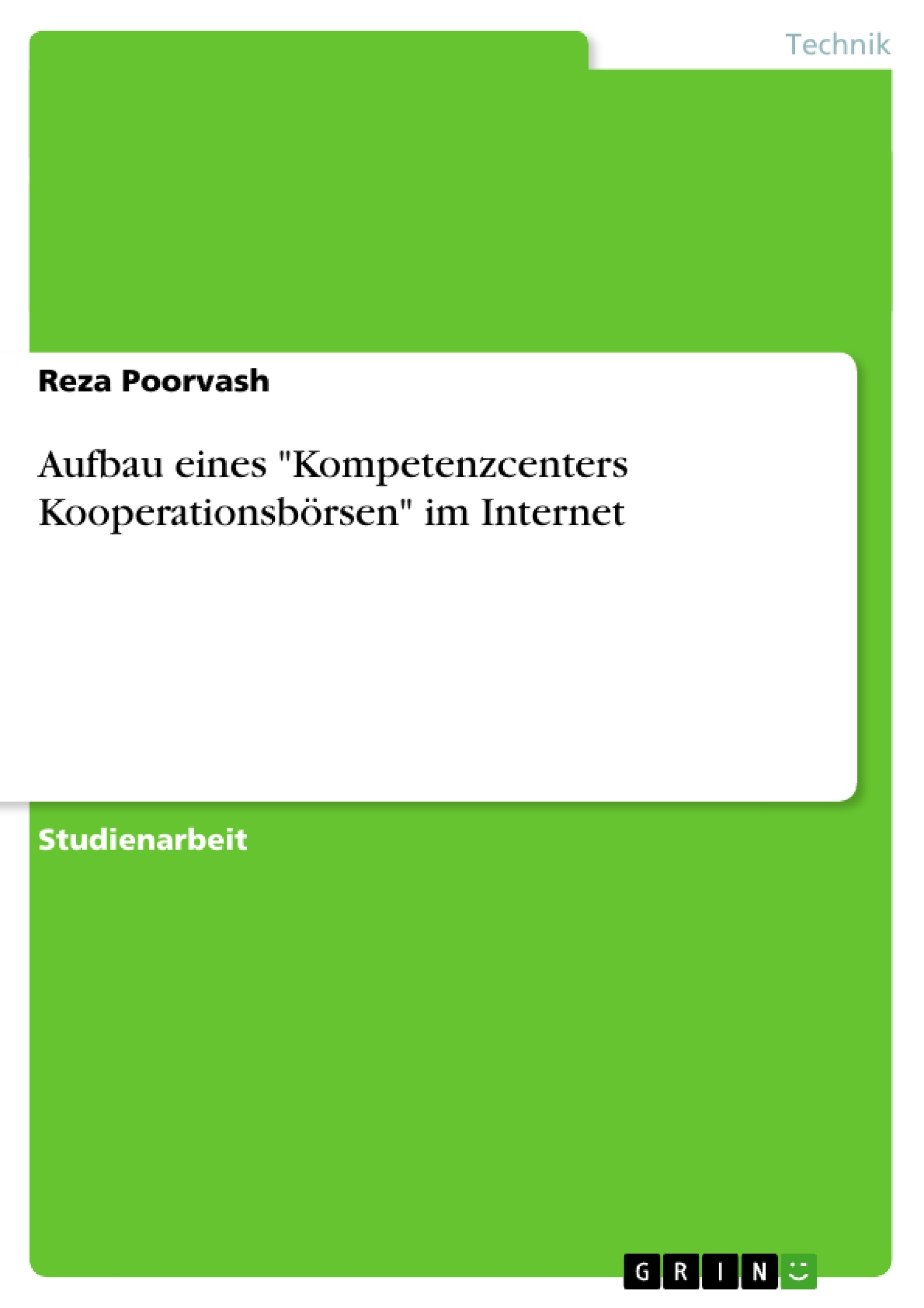INHALTSANGABE
1 EINLEITUNG
1.1 INTERNE FAKTOREN
1.2 EXTERNE FAKTOREN
1.3 ZIEL DER ARBEIT
2 DIE BÖRSE
2.1 BEGRIFFSDEFINITION
2.2 FUNKTIONSWEISE EINER BÖRSE
3 ARTEN VON BÖRSEN
3.1 KOOPERATIONSBÖRSE
3.2 TECHNOLOGIEBÖRSEN
3.3 SOFTWAREBÖRSEN
3.4 EXISTENZGRÜNDERBÖRSEN
3.5 RECYCLING-/WERTSTOFFBÖRSEN
4 ANALYSE DER BÖRSEN
4.1 KOMMUNIKATIONSTECHNISCHE DIMENSION
4.1.1 Kommunikationsmedium
4.1.2 Formalisierung der Eingaben
4.2 INFORMATIONSTECHNISCHE DIMENSION
4.3 ABLAUFTECHNISCHE DIMENSION
4.3.1 Inserate suchen
4.3.2 Inserate aufgeben
4.3.3 Inserate beantworten
4.3.4 Inserate l ö schen/ ä ndern
4.4 AUFBAUTECHNISCHE DIMENSION
4.5 ORGANISATORISCHE DIMENSION
4.5.1 Kosten und Finanzierung
4.5.2 Einzugsgebiet
4.5.3 Sprache
4.5.4 Aktualisierungsintervall
4.5.5 Chiffre
5 FAZIT
6 QUELLENANGABEN
6.1 LITERATURQUELLEN
6.2 INTERNETQUELLEN
1 Einleitung
Die Märkte und Unternehmen wachsen immer mehr zusammen. Geht man davon aus, daß einem Unternehmen immer nur eine gewisse Menge an Ressourcen zur Verfügung stehen, so wird deutlich, daß viele Unternehmen dem Wettbewerb nicht allein gewachsen sind. Vielfach verfügen sie nicht über das „Know-how“, um Vertretungen in anderen Regionen oder Ländern errichten zu können. Auch die hohen Kosten, insbesondere im Fixkostenbereich, die mit der Einrichtung einer eigenen Präsenz am Markt verbunden sind, wirken auf viele Unternehmen abschreckend.
Kann im Rahmen einer Kooperation dagegen auf die Infrastruktur bzw. das Know-how einer Partnerunternehmung zugegriffen werden, so sinken die Eintrittsbarrieren, Kosten und Risiken für den Zutritt zu neuen Märkten.
Die Produktlebenszyklen werden zudem zunehmend kürzer. Dies hat zur Folge, daß die Entwicklungs- und Fertigungszeiten für die Produkte deutlich verkürzt und daher die Kosten deutlich gesenkt werden müssen. Andererseits werden die Produkte immer komplexer, die benötigten Anlagen und Maschinen immer aufwendiger und teurer. Durch zwischenbetriebliche Kooperationen können Kosten und Zeit für Entwicklung, Fertigung und/oder Vertrieb reduziert und die Spanne des time-to-market deutlich verringert werden.
Weltweite Konzentrationsprozesse verstärken die Position der Großunternehmen. Diese verfügen über größere finanzielle, materielle und informationelle Grundlagen und können Leistungen anbieten, die von klein- und mittelständischen Unternehmen nicht erbracht werden können. Um eine Gegenmachtposition einnehmen zu können, bietet es sich für die klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) an, miteinander zwischenbetriebliche Kooperationen einzugehen. Dies ist ein wesentliches Mittel zur Sicherung und Festigung von Marktpositionen im immer härter werdenden Wettbewerb. Dadurch können die KMU einerseits ihre strukturbedingten Nachteile ausgleichen, anderseits ihre positiven Eigenschaften, wie die hohe Flexibilität und Schnelligkeit, miteinander vereinen und durch geschicktes Vorgehen unter Umständen die Vorteile der größeren Unternehmen egalisieren.
Kooperationen werden daher als zukunftsweisende Möglichkeit betrachtet, damit KMU ihre Innovationskraft und Flexibilität bewahren und gleichzeitig die notwendige kritische Größe erreichen können.
Bei Kenntnis dieser Vorteile muß die Frage gestellt werden, warum es meist nicht zu dem gewünschtem Ergebnis, der Kooperation, kommt.
Die Gründe für das Nichtzustandekommen von Kooperationen sind einerseits innerbetrieblich (intern) und andererseits außerbetrieblich (extern) zu suchen.
1.1 Interne Faktoren
Oftmals vermeiden die Unternehmen, wegen eines befürchteten Verlustes an Know-how, aus Angst vor Übervorteilung oder aufgrund der Annahme, daß man es „allein am besten kann“, die Kooperation. Sie sind nicht bereit, ihre hierarchischen Strukturen aufzugeben. Andere wiederum scheuen den Aufwand, der mit der vertraglichen und inhaltlichen Regelung von Kooperationen zusammenhängt oder sehen in jedem Partner einen potentiellen Mitbewerber.
Auf die internen Faktoren soll aber im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.
1.2 Externe Faktoren
Die Unternehmen haben mangels geeigneter Informationen, des öfteren nicht die Möglichkeit, einen geeigneten Partner zu finden. Mögliche Kooperationswerkzeuge sind den Unternehmen nicht bekannt bzw. sie werden noch als unausgereift betrachtet.
Wie können Unternehmen einen für sie geeigneten Kooperationspartner finden?
Ein mögliches Werkzeug zur Partnerfindung sind die Kooperationsbörsen. Diese ermöglichen nicht nur die Suche nach potentiellen Partnern in der Region, sondern je nach Reichweite der Börse auch in Deutschland, in Europa oder weltweit.
Kooperationsbörsen gibt es in vielen Bereichen, wobei folgende Formen am Häufigsten auftreten:
- Recycling-/Wertstoff-/Abfallbörsen
- Kooperationsbörsen in den Bereichen Handel, Dienstleistung und Produktion
- Existenzgründerbörsen
- Technologiebörsen
Inzwischen gibt es neben der papierbasierten Form, die in regelmäßigen Publikationen1 erscheint, auch die Möglichkeit der Vermittlung im Internet. Durch die Weiterentwicklung der Multimediatechnik und des Internets ist die Suche nach einem passenden Kooperationspartner stark vereinfacht worden.
Immer mehr Börsenanbieter präsentieren ihre Anzeigen anstatt als Veröffentlichung in Zeitungen, auf einer Webseite, um mit den Interessenten schneller und flexibler kommunizieren zu können.
1.3 Ziel der Arbeit
Im Rahmen dieser Seminararbeit sollen zunächst Börsen definiert, ihre Funktionsweise und die verschiedenen Formen, wie zum Beispiel Technologieoder Recyclingbörsen, vorgestellt und erläutert werden. Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit einer Analyse der Börsen. Dazu dienen eine Reihe von Kriterien, die einen Vergleich der Börsen ermöglichen.
Das Ergebnis dieser Arbeit soll eine Hilfestellung, sowohl für kooperationsinteressierte Unternehmen als auch für die Initiatoren von Kooperationsbörsen, sein. Einerseits kann sie dazu beitragen, die eigene Kooperationsbörse kritisch zu untersuchen, andererseits können sich die kooperationssuchenden Unternehmen aber auch Existenzgründer anhand der noch vorzustellenden Kriterien ein erstes Bild von den Börsen schaffen, und somit abschätzen, inwieweit ihr Inserat in den Börsen Erfolg haben wird.
2 Die Börse
2.1 Begriffsdefinition
„Zusammenfassend kann man eine Kooperationsbörse wie folgt definieren: Eine Kooperationsbörse ist eine Vermittlungsstelle, die kooperationsuchende Unternehmen zusammenführt. Eine Kooperationsbörse ist von ihrer Funktionsweise her ein Markt, auf dem Angebot und Nachfrage zusammentreffen“ ([KRE97]).
„Als Kooperation wird die echte zwischenbetriebliche Zusammenarbeit auf horizontaler oder vertikaler Ebene verstanden, demnach die freiwillig vereinbarte, eindeutig festgelegte und auf längere Dauer geplante Gemeinschaftsmaßnahmen (z.B. Patent- und Lizenzanzeigen oder Joint Ventures) von zwei oder mehreren Unternehmen außerhalb einer üblichen Geschäftsbeziehung, aber keine Vermittlungen von freien Kapazitäten, Lohnfertigungsaufträgen, Serviceleistungen sowie Import- und Exportanfragen!“ ([IHK99]).
Diese Definition der Kooperation, wie sie von der IHK benutzt wird, ist sehr eng gefaßt. Sie unterliegt einer Restriktion, die eine allgemeine Anwendung auf alle Börsen erschwert. Diese Restriktion ist die Festsetzung des Faktors Zeit. Es wird eine auf "Dauer geplante Gemeinschaftsmaßnahme" verlangt.
Häufig kommt es in der Praxis jedoch zu einmaligen Kooperationen, wie es z.B. in der Recyclingbranche (Recycling-/Abfallbörsen) der Fall ist. Für die Kooperation in diesen Börsen gelten andere Bedingungen, die durch die Definition nicht abgedeckt werden. Diese Börsen werden im Laufe der Arbeit vorgestellt und die Bedingungen erläutert.
Weiterhin wird in dieser Arbeit auch die einmalige, zeitlich begrenzte Kooperation im Rahmen aller Börsen zugelassen und folglich die zeitliche Restriktion aufgehoben.
Zudem ist im Laufe der Arbeit festgestellt worden, daß viele Börsen die Vermittlung von freien Kapazitäten anbieten. Auch dieser Punkt entspricht nicht der IHK Definition.
2.2 Funktionsweise einer Börse
Nachdem die Börse definiert ist, wird nachfolgend beschrieben, wie sie funktioniert. Dabei ist jedoch grundsätzlich zu beachten, daß es zwischen den einzelnen Börsen zum Teil Unterschiede in den Funktionsweisen gibt, so daß die Beschreibung allgemein gehalten wird.
Angeboten bzw. nachgefragt wird - je nach Börsenart - unterschiedliches, wie z.B. Erfindungen, Risikokapital, Technologien, Innovationen, Konzeptlösungen, Handelskooperationen oder Abfälle.
Die Börsen sind allgemein in zwei Bereiche, Kooperationsgesuche und Kooperationsangebote, aufgeteilt. Kooperationssuchende Unternehmen, die in der Börse inserieren wollen, können dies meist mit Hilfe eines "Online-Formulars" durchführen. Die Vorteile eines Online-Formulars sind einerseits die schnellere Möglichkeit der Bearbeitung des Inserates und anderseits die präzisere Zuordnungsmöglichkeit. Andere Möglichkeiten für die Abgabe eines Inserates sind Briefe, Faxe oder E-Mails, wobei die elektronische Form nach Möglichkeit zu bevorzugen ist!
Nachdem das Unternehmen bzw. der Benutzer mit der Börse Kontakt aufgenommen hat (siehe Abb.1), kann er in der Datenbank der Börse recherchieren. Findet er in der Datenbank den geeigneten Kooperationspartner, so kann er entweder direkt mit ihm in Kontakt treten, oder sein Anliegen wird von der Börse aus an den Inserenten weitergeleitet. Der Inserent nimmt dann Kontakt mit dem Unternehmen auf und es kommt zu ersten Kooperationsgesprächen.
Sollte das Unternehmen keinen geeigneten Kooperationspartner in der Datenbank vorfinden, so hat es die Möglichkeit in der Datenbank selbst zu inserieren und muß seinerseits darauf warten, bis ein anderes Unternehmen sich mit ihm in Verbindung setzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Funktionsweise einer Kooperationsbörse
Die Inserate, die in den Börsen aufgegeben werden, sollten Angaben über das Unternehmen, die Art des Kooperationswunsches oder eine Beschreibung des gewünschten Kooperationspartners enthalten.
Bei den Recyclingbörsen sollten die Besitzer eines Reststoffes diesen nach Art, Zusammensetzung, Menge, Anfallhäufigkeit und Transportregelung beschreiben. Genauso muß ein Nachfrager, der Reststoffe weiter- oder wiederverwenden möchte, verfahren.
Eingehende Inserate werden vom Börsenbetreiber in Anzeigenform gebracht und im Internet veröffentlicht. Bei den IHK -Börsen erscheint zudem die Anzeige in der Fachzeitung der IHK.
3 Arten von Börsen
Der folgende Abschnitt befaßt sich mit verschiedenen Börsenformen. Es wird beschrieben, welche Arten von Kooperationen in den jeweiligen Börsen vermittelt werden. Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Trennlinie, die nachfolgend zwischen den jeweiligen Börsen gezogen wird eigentlich nur in der Theorie klar ersichtlich ist! In der Praxis ist die Grenze fließend. Das bedeutet, daß Inserate in einer Kooperationsbörse durchaus auch in einer Technologie- oder Existenzgründerbörse zu finden sind. Aus diesem Grund ist es ratsam in verschiedenen Börsen zu inserieren.
3.1 Kooperationsbörse
In den klassischen Kooperationsbörsen werden Unternehmenskooperationen speziell in den Bereichen Handel, Dienstleistung und Produktion angeboten. Diese Kooperationen sind auf länger dauernde, zwischenbetriebliche Kooperation in horizontaler oder vertikaler Richtung ausgerichtet, jedoch nicht auf die Vermittlung von freien Produktionskapazitäten oder Lohnarbeiten.
- Handelskooperationen:
Hier werden beispielsweise Kooperationen von Handelsagenturen, Vertretern, Kooperationspartner für Handling, Logistik und zur Erweiterung des Vertriebsnetzes, aber auch Kooperationen für Einkaufsbörsen angeboten und nachgefragt.
- Dienstleistungskooperationen:
Hierbei handelt es sich überwiegend um langfristige Kooperationen im Bereich Marketing und Vertrieb, aber auch um vertikale Kooperation, z. B. im Hausbau (Tiefbauunternehmen und Architekten).
- Produktionskooperationen:
Es gibt Angebote/Nachfragen in allen Produktionsbereichen. Einerseits suchen Hersteller von bereits bestehenden Produkten Kooperationspartner zur Ausdehnung des Absatzprogramms für Produkte bzw. Produktgruppen auf der gleichen Wirtschaftsstufe (horizontalen Diversifikation) oder zur Ausdehnung der Leistungstiefe des Programms. „Es werden Produkte der Vorstufe (Vorstufen-D.) oder der Nachstufe (Nachstufen-D.) einbezogen (vertikale Diversifikation)“ ([GAB97]).
Andererseits gibt es auch viele Erfinder mit Produktideen, die Kooperationspartner für die Umsetzung ihrer Ideen suchen. Genau an dieser Stelle ist der Übergang zu den Technologiebörsen sehr unscharf. Aus diesem Grund sollten kooperationssuchende Unternehmen in diesem Bereich auch in den Technologiebörsen nach Kooperationspartnern Ausschau halten.
3.2 Technologiebörsen
„Märkte zu erhalten und neue Märkte zu erobern ist angesichts des weltweiten Technologiewettlaufs nur möglich, wenn Ideen rascher auf die Fließbänder gelangen. Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft bedeutet daher ständiges Bemühen um neue, bessere und kostengünstigere Produkte und Verfahren“ ([IHK99)]. Dies ist das Motto der Technologiebörsen.
Viele Unternehmen möchten technische Neuerungen durch Lizenzen erwerben, andere sind dagegen bestrebt, Patente, Lizenzen oder auch ungeschütztes technisches Wissen zum Verkauf anzubieten. Belebung des Technologietransfers durch Aktivierung dieses Angebots- und Nachfragepotentials ist das Ziel von Technologiebörsen.
In den Datenbanken der Technologiebörse werden nur Angebote/Nachfragen aufgenommen, die durch technische Verwertbarkeit bzw. Umsetzbarkeit im Sinne von Lizenzvergabe oder -verkauf, Weiterentwicklung, Herstellung oder Vertrieb eines fertigen technischen Produkts oder Verfahrens ausgezeichnet sind.
3.3 Softwarebörsen
Die Softwarebörse ist eine Plattform, auf der innovative Unternehmen und kleine Software-Entwicklungsfirmen ein anstehendes Software-Projekt ausschreiben, um schnell und effizient die richtigen Partner zu finden. Die Kooperationen, die stattfinden, sind meist speziell auf Lösungskonzepte im Bereich Programmierprobleme begrenzt. „Aus diesem Grund ist man leicht geneigt zu sagen, daß es sich bei Softwarebörsen nicht unbedingt um klassische Kooperationsbörsen handelt“.([KRE97]).
Da sich aber letztendlich zwei oder mehrere Firmen zusammentun, um ein Problem zu lösen, und es dadurch zu einer Kooperation kommt, sind die Softwarebörsen Bestandteil von Kooperationsbörsen.
3.4 Existenzgründerbörsen
Die Existenzgründerbörse dient dem Ziel, Existenzgründern den Schritt in die Selbständigkeit zu erleichtern, bei der Suche nach Partnern für eine gemeinsame Gründung zu helfen, sowie für bestehende Unternehmen Nachfolger und aktive Teilhaber zu vermitteln. Damit sollen neue Arbeitsplätze geschaffen und die mit den Betriebsaufgaben verbundenen Arbeitsplatzverluste vermieden werden.
Hierbei ist die Vermittlung rein finanzieller Beteiligungen z.B. stiller Teilhaberschaften ebenso ausgeschlossen wie eine Unternehmens- oder Immobilienvermittlung.
Eine andere Börsenform, die aus der Existenzgründerbörse heraus resultiert, ist die Risikokapital-Beteiligungbörse. Sie bietet innovativen, technologieorientierten Jungunternehmern eine Möglichkeit, Kontakte zu potentiellen Kapitalgebern, zur Finanzierung von Existenzgründungsvorhaben, herzustellen. Insbesondere Unternehmen und Kreditinstituten, sowie privaten und institutionellen Anlegern, wird mit dieser Börse ein Forum geboten, sich in neuen Marktfeldern zu engagieren.
Auf die Risikokapital-Beteiligungsbörse wird aber im Laufe dieser Arbeit nicht näher eingegangen.
3.5 Recycling-/Wertstoffbörsen
Häufig fallen bei der industriellen Produktion Reststoffe an, für die die Unternehmen einen Abnehmer suchen. Andere Unternehmen wiederum suchen vielleicht gerade diese Reststoffe, um sie als Sekundärrohstoffe in ihrem Produktionsprozeß einzusetzen. Das Fehlen eines funktionierenden Marktes für solche Stoffe stellt die Unternehmen aber oftmals vor scheinbar unlösbare Probleme.
Hierbei kann die Recyclingbörse zwischen einzelnen Unternehmen vermitteln, damit Abfälle und Reststoffe als Wirtschaftsgut in den Rohstoffkreislauf zurück- gebracht werden können, denn es gilt die Devise Betriebsabfall ist ein Betriebsproblem.
4 Analyse der Börsen
In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse vorgestellt, die sich aus der durchgeführte Analyse der Börsen ergeben. Diese Analyse ist anhand einer Referenzarchitektur (siehe [GRO98]), die Gliederungskriterien für die Börsen darstellt, durchgeführt worden. Die Referenzarchitektur hilft dabei, Börsen miteinander vergleichbar zu machen und soll zudem Anhaltspunkte geben, wie die bestehenden Börsen verbessert werden könnten.
Insgesamt wurden 62 Börsen untersucht. Die 62 Börsen teilen sich wie folgt auf:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Gruppe der Kooperationsbörsen sind auch zwei Softwarebörsen und die Internationale Holzbörse integriert. In die Untersuchung mit einbezogen wurden auch Börsen in Österreich und in der Schweiz, sowie zwei Recyclingbörsen aus den Vereinigten Staaten. Die Auswahl der insgesamt 62 Börsen unterlag keinerlei Restriktionen. Das bedeutet, daß sowohl regionale, nationale als auch internationale Börsen in die Untersuchung einbezogen wurden.
4.1 Kommunikationstechnische Dimension
„Ziel der Börse muß es sein, dafür Sorge zu leisten, daß eine offene Kommunikation für alle Kommunikationsmedien und für alle Kommunikationsformen möglich ist“([GRO98]).
4.1.1 Kommunikationsmedium
Als Kommunikationsmedium zwischen dem Benutzer und der Börse können, wie z.B. noch bei der ersten Börse in Deutschland, der IHK-Recyclingbörse (1974 gegründet) üblich, die klassischen Kommunikationsmedien wie Zeitungsinserate, Briefe und das Telefon genutzt werden, außerdem aber auch die neueren Technologien wie das Telefax, E-Mail oder generell das Internet.
Alle diese Kommunikationsmedien haben sicherlich ihre Vor- und Nachteile und aus diesem Grund auch ihr spezielles Einsatzgebiet. Inwieweit die Medien bei den Börsen Benutzung finden, wird folgend beschrieben.
Bei der Kooperationsanbahnung geht es darum, zunächst einen geeigneten Kooperationspartner zu finden. Das bedeutet, daß der Benutzer mit der Börse in Kontakt treten muß, um in der Datenbank der Börse den geeigneten Kooperationspartner zu suchen, oder gegebenenfalls in der Datenbank ein Kooperationsgesuch zu inserieren. Der einfachste und direkteste Weg, dies zu realisieren, ist die Benutzung des Internets. Bei allen untersuchten Börsen dient das Internet als Kommunikationsmediumbasis. Um den zweiten Platz hinter dem Internet als Kommunikationsmedium Nummer eins streiten sich das Telefon und das Fax. Während bei den Kooperationsbörsen das Fax mit 51,51% die Nase vor dem Telefon mit 39.39% hat sieht es bei den anderen Gruppen anders aus. Bei den Recyclingbörsen und Existenzgründerbörsen wird deutlich mehr zum Hörer gegriffen. Das Ergebnis jeweils Telefon zu Fax: ist 64,28% zu 35,71% bei der Recyclingbörse und 71,42% zu 42,85% bei der Existenzgründerbörse. Bei der Technologiebörse endet das Ergebnis mit einem Unentschieden. An dieser Stelle muß aber hinzu gefügt werden, daß sowohl das Telefon als auch das Fax bei den Börsen eine untergeordnete Rolle spielen und nur dazu dienen sollen, auf offene Fragen des Benutzers ein zu gehen. Zudem besteht bei einigen Börsen noch die Notwendigkeit auf diese Weise die Anzeigeformulare für das Inserat anzufordern. Jedoch erfolgt die Recherche in den Datenbanken ausschließlich online!
4.1.2 Formalisierung der Eingaben
„Während der Partnerfindung beschränkt sich die Kommunikation über die Börse im Wesentlichen auf die Inserierung von Gesuchen und Angeboten und die Reaktion auf bestehende Inserate“ ([GRO98]). Um die Daten für ein Inserat online einzugeben, sollten seitens der Börse Masken zur Verfügung gestellt werden. Der Benutzer sollte dann mit Hilfe von "Mußeingaben", in einigen bestimmten Feldern dazu gezwungen werden, aus einer Auswahl von Schlüsselwörtern zu wählen. Der Benutzer muß dann bestimmte Angaben, wie zum Beispiel das Geschäftsfeld, die Branche, die Mitarbeiterzahl usw. machen. Dazu müssen Felder vorhanden sein, in denen der Benutzer "frei" seinen Kooperationswunsch formulieren und Eigenangaben machen kann. Aus der Kombination von den "Mußeingaben" und den "freien" Feldern bekommt das Inserat einerseits ein Profil und anderseits kann die Börse die Inserate besser Kategorien und zuordnen. Während es bei allen Börsen die Möglichkeit gibt über freie Felder Einträge vorzunehmen, sind "Mußeingaben" noch keine Selbstverständlichkeit.
Bei den Kooperationsbörsen sind es ungefähr 54%, die über solche Kategorierungsmöglichkeiten verfügen. 75% der untersuchten Technologiebörsen benutzten solche Masken. Der Grund für die höhere Quote bei den Technologiebörsen ist wahrscheinlich die bessere Möglichkeit der Kategoriesierung. Denn Patente oder Lizenzerwerbe lassen sich besser handhaben als ein etwas ausgefallenerer Kooperationswunsch.
Über die Recyclingbörsen können keine konkreten Angaben gemacht werden, da bei fast allen Recyclingbörsen der Bereich Inserataufgabe mit Transaktionsnummer bzw. Paßwort geschützt ist. Aber man kann allgemein sagen, daß es bei den Recyclingbörsen zu einer sehr hohen Quote kommen muß, da der Besitzer eines Reststoffes in der Regel die Art, Zusammensetzung, Menge, Anfallhäufigkeit und Transportregelung des Reststoffes zu beschreiben hat.
Bei der Existenzgründerbörse liegt die Quote bei 50 %.
Der Grund für die niedrigen Quoten bei den Kooperations- und Existenzgründerbörsen ist der hohe Anteil von Regionalbörsen. Diese Börsen sind naturgemäß klein und die Zahl der Inserate beschränkt sich auf eine überschaubare Menge. Aus diesem Grund rentiert es sich für die Börsenbetreiber nicht, Masken mit Mußeingaben einzuführen, da der Verwaltungsaufwand für die Pflege und Aktualisierung einer geordneten Datenbank zu hoch und bei wenigen Inseraten ohnehin eine große Übersichtlichkeit gewährleistet ist.
4.2 Informationstechnische Dimension
Aus informationstechnischer Sicht muß es Ziel der Börse sein, Informationen auf eine übersichtliche Art und Weise dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. „Diese Informationen müssen schnell und einfach abrufbar sein. Zudem ist es von sehr großer Wichtigkeit, daß die bereitgestellten Informationen sicher und aktuell sind und Anspruch auf Völlständigkeit besitzen“ ([GRO98]).
Wie die Börsen diese an sie gestellten Erwartungen erfüllen und welche Möglichkeiten es gibt, die genannten Ziele zu erreichen, wird im Folgenden beschrieben.
Zunächst einmal muß man sich der Einfachheit halber die Börse wie einen Anzeigenmarkt einer Tageszeitung vorstellen, mit dem Unterschied, daß keine Autos oder PCs vermittelt werden, sondern Kooperationen. Beispiele für solche Kooperationsanzeigen können sein:
- Fachfirma, eingerichtet mit modernsten Maschinen, wie Plattensäge, Kantenumleimermaschine, Eck-Kopierfräse sucht zur Kapazitätsauslastung Aufträge zur Lieferung von zugeschnittenen und umleimten kunststoffbeschichteten Spanplatten von 5-40 mm Dicke.
- Metallbearbeitungsbetrieb mit angeschlossener Schweißerei und Lackiererei, tätig im Bereich Sondermaschinenbau, sucht Kooperationspartner zur Herstellung, Bearbeitung, Lackierung und Montage von Maschinenkomponenten
Um erst einmal eine "Grobübersicht" zu schaffen, müssen die Inserate seitens der Börse in „Angebote“ und „Gesuche“ unterteilt werden. Nach dieser ersten Unterteilung macht es Sinn, weitere Feinunterteilungen vorzunehmen. Möglichkeiten hierzu sind, dem Benutzer Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen seine Suche auf bestimmte Regionen (nach Postleitzahlen), Branchen, Stoffe (Metall, PVC) oder Gültigkeitsdatum einzugrenzen. Sehr sinnvoll ist auch die Möglichkeit, mit Hilfe einer internen Suchmaschine die Datenbank der Börse durchsuchen zu können. Bei einer großen Anzahl von Inseraten ist es von Vorteil die beiden erwähnten Vorgehensweisen, Baumdiagramm und Suchmaschine, zu kombinieren.
Die Auswertung der Analyse führte zu folgendem Ergebnis: 30% der Kooperationsbörsen besitzen die Kombination einer strukturierten Datenaufbereitung plus Stichwortsuche. Das ist ein Merkmal, welches auf größere Datenmengen hinweist. 30% haben eine unstrukturierte Datenaufbereitung. Hierbei handelt es sich meist um regionale Börsen. Bei den restlichen Börsen kommen die Suchmöglichkeiten in diversen Formen wie unstrukturiert/Stichwortsuche, strukturiert oder nur Stichwortsuche, vor.
Die Recyclingbörsen kommen auf ein viel höheres Ergebnis. Die Quote für die Kombination einer strukturierten Datenaufbereitung plus Stichwortsuche liegt bei knapp 65%. Der Grund für solch eine Datenaufbereitung ist die Verpflichtung des Inserenten seitens der Börse, die Art, Zusammensetzung, Menge, und Anfallhäufigkeit des Reststoffes anzugeben. All diese Informationen dienen dazu, eine Feinkategorisierung vorzunehmen, um später genau so fein suchen zu können.
Ein ähnliches Bild besteht bei den Technologiebörsen. Bei 75% von ihnen kann der Leser auf die kombinierte Suchmöglichkeit „strukturiert/Stichwortsuche“ zugreifen. Die anderen Suchkriterien sind von geringerer Bedeutung.
Anders sieht es bei den Existenzgründerbörsen aus. Bei 50% dieser Börsen liegt eine unstrukturierte Datenaufbereitung vor, gefolgt von knapp 34% „strukturiert/Stichwortsuche“. Der Grund dafür, daß bei der Hälfte von diesen Börsen die Anzeigen nur nach „Angebot“ und „Gesuch“ unterteilt werden und keine weitere Unterteilung vorgenommen wird, liegt im Charakter dieser Börsen. Die meisten von ihnen sind regionaler Natur mit einer kleinen Datenbank. Für solche Börsen ist es unrentabel weitere Unterteilungen vorzunehmen, weil es einerseits schwierig wird eingehende Inserate zuzuteilen, anderseits der Administrations- und Verwaltungsaufwand nicht in Relation mit den Einnahmen bzw. dem Budget stehen wird.
Nach dem ein Leser in der Börsendatenbank ein Inserat gefunden hat, das seiner Vorstellung entspricht, ist es für ihn von großer Bedeutung, daß das Inserat auch aktuell ist. Hier fängt das große Problem der Börsen an. Bei vielen Börsen bezahlt man einen Pauschalpreis pro Inserat, unabhängig davon, ob es zu einer Kooperation kommt oder nicht. Dies bedeutet für die Börse, daß sie sich immer wieder in bestimmten Zeitabständen mit den inserierenden Unternehmen in Kontakt setzen muß, um zu prüfen, ob das Inserat noch aktuell ist. Besser sind die zeitlich limitierten Inserate, die nach einer bestimmten Zeit automatisch aus der Datenbank gelöscht werden. Sinnvoll sind zeitliche Limits von drei bis maximal sechs Monaten, wie z.B. bei der Internationalen Holzb ö rse (vgl.[IHB99]).Jährliche Inserate, wie z.B. bei der Business Datenbanken GmbH (vgl.[BDG99]), erhöhen den Verwaltungsaufwand für die Aktualisierung und dienen deshalb nicht unbedingt der Aktualität. Wie genau die einzelnen Börsen ihre Anzeigen aktualisieren und wie sie dabei vorgehen, konnte im Rahmen dieser Untersuchung nicht festgestellt werden.
Neben der Bereitstellung von Informationen sollte es die Aufgabe der Börse sein, dem Leser die benötigten Information schnell zur Verfügung zu stellen und ihm dadurch einen hohen Komfort zu bieten. Mit „schnell“ ist gemeint, daß der Leser nicht ständig in den Datenbanken der Börse nach dem gleichen, nicht vorhandenen Inserat suchen muß. Ein Schritt in diese Richtung macht die Recyclingbörse Forschungsinstitut Kunststoff und Recycling GmbH (vgl.[FKR99]) Bei dieser Börse werden nach dem letzten Besuch neu hinzugekommene Einträge angezeigt. Der Leser spart dadurch viel Zeit und braucht an sich nur einmal die Datenbank komplett durch zu suchen.
Eine andere Möglichkeit ist das Weiterleiten von Informationen (Inseraten) anhand von Mailing-Listen. Der Benutzer gibt einmal an, über welche Art von Angeboten oder Gesuchen er gerne informiert werden möchte; die Börse sendet ihm daraufhin automatisch neu erstellte zutreffende Inserate zu. Solch eine Mailing-Liste wurde bei einer regionalen IHK (vgl.[SBH99]) beobachtet. Warum die beiden genannten Methoden, die durchaus die Effektivität erhöhen, nicht bei den anderen Börsen Einzug erhalten haben, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden.
Eine andere Art von Komfort bietet die Business Datenbanken GmbH. Auf Wunsch wird eine Matching-Recherche in dieversen Datenenbanken im Web durchgeführt. Das heißt der Benutzer erteilt der Business Datenbanken GmbH den Auftrag nach einem bestimmten Kooperationsangebot/-gesuch Ausschau zu halten. Daraufhin wird zuerst die eigene Datenbank (Volumen derzeit 42000 Kooperationswünsche nach eigenen Angaben) und dann in anderen Kooperationsbörsen nach dem Auftrag gesucht. Der Benutzer braucht sich folglich um nichts zu kümmern. Der Preis für die Matching-Recherche liegt bei 500 DM.
4.3 Ablauftechnische Dimension
Aus ablauftechnischer Sicht muß es die Aufgabe der Börse sein, Abläufe einfach und nachvollziehbar zu gestalten. Es sollten zwei Ziele insbesondere verfolgt werden:
- Größtmögliche Nutzung der Börse, also sprich viele Inserate und viele Leser
- Hohe Effektivität (möglichst viele Kooperationsvermittlungen)
Im Folgenden werden nur die Abläufe in der Börse beschrieben, an denen Personen beteiligt sind. Auf die internen Abläufe wird nicht speziell eingegangen!
Zur Kooperationsanbahnung müssen in erster Linie geeignete Partner gefunden und mit diesen Kontakt aufgenommen werden. Dazu müssen dem Benutzer nachstehende Verfahren zur Verfügung stehen. Diese Verfahren stellen eine Mindestanforderung dar und können von Fall zu Fall variieren.
4.3.1 Inserate suchen
Der Leser greift mit Hilfe des World Wide Web auf den Server der Börse zu und sucht den für ihn geeigneten Kooperationspartner in der Datenbank der Börse. Auf die verschiedenen Suchmöglichkeiten ist im vorherigen Kapitel (4.2) eingegangen worden. Nach der Recherche in der Datenbank werden dem Leser zutreffende Anzeigen angezeigt. Da alle untersuchten Börsen internetbasierte Börsen sind, kann bei ihnen eine Onlinesuche durchgeführt werden.
4.3.2 Inserate aufgeben
Um in diesen Börsen Inserate aufgeben zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist die Inserate online aufzugeben. In einem Menüpunkt „Inserat aufgeben“ kann der Benutzer sein persönliches Angebot bzw. Gesuch mit Hilfe von verschiedenen Masken (vgl. Kapitel 4.1.2) eingeben. Da eine Onlineeingabe die geringsten Kosten verursacht ist sie bei den Börsen sehr beliebt. 65.5% der Kooperationsbörsen, 75% der Technologiebörsen, knapp 70% der Recyclingbörsen und 50% der Existenzgründerbörsen benutzen diese Art der Inserateingabe. Andere Formen der Inserierung, die weniger benutzt werden, sind die Eingabe einer Anzeige per E-Mail, über einen Ansprechpartner (Telefon) oder mit Hilfe eines Telefaxgeräts. Bei der IHK ist es z.B. so geregelt (von der IHK-Technologiebörse abgesehen), daß der Benutzer die Anzeigenformulare erst einmal bei der IHK anfordern muß. Dies kann über die Mail-Adresse oder die Telefonnummer eines genannten Ansprechpartners erfolgen. Der Grund hierfür ist, daß die IHK die eingehenden Anzeigenformulare genaustens prüft und sie erst nach der Prüfung in die Datenbank stellt. Bei einer Onlineanzeigenaufnahme ist man bei der IHK wahrscheinlich der Meinung, daß weniger Reaktionszeitraum zur Verfügung steht, um auf fehlerhafte Anzeigen reagieren zu können. Die IHK will sich dadurch vorallem vor Anzeigen, die nicht mit der Philosophie im Einklang stehen, wie z.B. der Vermittlung von freien Kapazitäten oder einmaliger kurzer Kooperationen, schützen.
Eine andere Möglichkeit der Inserataufgabe, gibt es beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (vgl. [ZDB99]). In dieser Börse kann man das Anzeigenformular downloaden. Der Vorteil hierbei ist, daß der Benutzer in aller Ruhe die Gelegenheit hat, sich das Formular anzuschauen, und sich Gedanken über seine Einträge zu machen. Er braucht dann nicht immer wieder online zu gehen, um sich z.B. anzuschauen in welcher Kategorie sein Unternehmen angesiedelt ist. Diese Art der Eingabe erhöht den Komfort bei der Inserierung.
4.3.3 Inserate beantworten
Wird ein Inserat am Bildschirm angezeigt, so muß der Benutzer die Möglichkeit haben auf diese Anzeige reagieren zu können. Am Effektivsten und am Einfachsten ist es, wenn es einen R ü ckantwort button gibt. Der Leser kann dann direkt über die Börse mit dem Inserenten Kontakt aufnehmen. Diese Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme gibt es aber nur, wenn die Anzeige des Inserenten nicht chiffriert ist. Anderenfalls wird die Antwort zuerst an die Börse und dann erst von der Börse aus an den Inserenten weitergeleitet. Eine andere Möglichkeit des Antwortens besteht darin, daß der Leser einen angegeben Ansprechpartner anmailt und über diese Person mit dem Inserenten Kontakt aufnimmt. Dieses Verfahren wird in einigen regionalen Börsen praktiziert.
Im Rahmen dieser Untersuchung konnte festgestellt werden, daß bei den Kooperationsbörsen knapp 49% in Form eines schwarzen Bretts funktionieren. Das bedeutet, daß der erste Kontakt mit dem Inserenten bei fast allen Börsen direkt erfolgt. Bei 34% der Kooperationsbörsen wird der Kontakt über die Börse hergestellt. Der Grund für den höheren Anteil der Direktkontakte liegt darin, daß in den untersuchten Kooperationsbörsen wenig chiffriert wird. Denn es konnte festgestellt werden, daß die Abwicklung in Form von einer Weiterleitung mit einer Erhöhung der Chiffrierungen positiv korreliert.
Bei den Technologiebörsen ist das Bild umgekehrt. 50% der Anzeigen werden weitergeleitet und nur bei 37,5% kann der Benutzer direkt Kontakt aufnehmen. Die Ursache für die hohe Quote der Weiterleitung ist die hohe Chiffrierungsquote.
Bei den Recyclingbörsen dominieren die Direktkontakte wieder. Ungefähr 62% der Kontakte erfolgt direkt. Die Quote der Weiterleitungen liegt bei 24 Prozent.
Das Bild dreht sich in den Existenzgründerbörsen wieder zu Gunsten von den Weiterleitungen (50%) um. Die Blackboardmethode wird nur einmal angewendet. Auch in den letzt genannten Börsen kann die Abhängigkeit "Chiffre - Abwicklung" beobachtet werden.
Bei allen Börsen ergeben sich die restlichen Prozentzahlen zu 100%, wenn man die Abwicklung mit Hilfe eines Ansprechpartners hinzu zieht.
4.3.4 Inserate löschen/ändern
Jedem Inserenten soll die Möglichkeit gegeben werden, sein Inserat online neu zu bearbeiten bzw. zu löschen. Eine Möglichkeit der Löschung ist die Befristung der Anzeigenzeitintervalle seitens des Inserenten oder der Börse (drei oder sechs monatige Verträge). Nach Zeitüberschreitung wird dann die Anzeige automatisch vom System gelöscht. Dieses Verfahren wird Beispielsweise von der Innonet AG (vgl. [INN99]) oder von der Internationalen Holzb ö rse praktiziert.
Sehr selten wurde in dieser Untersuchung die online Bearbeitung beobachtet. Sie wird eigentlich nur von den drei Börsen M.U.T Ingenieurgesellschaft f ü r Umweltschutzberatung und Risikoabsch ä tzung GmbH (vgl. [MUT99]), Forschungsinstitut Kunststoff und Recycling GmbH und Plastpoint (vgl.[PLA99]) angewendet. Warum die online Bearbeitung nicht bei den anderen Börsen Einzug gehalten hat, ist nicht verständlich.
4.4 Aufbautechnische Dimension
„Das Kooperationswerkzeug soll bei der Anbahnung von Kooperationen zwei Funktionen erfüllen: Erstens sollen fremde Unternehmen durch die Bereitstellung einer öffentlichen Börse zusammengeführt werden, zweitens sollen in einem bestehenden Produktionsnetzwerk mögliche Lieferanten und Kunden gefunden werden“ ([GRO98]).
In jedem Fall ist eine Client-Komponente und eine Server-Komponente notwendig. Folgende Möglichkeiten einer Architektur können in Betracht gezogen werden:
- Client-Server Lösung mit einem Server
- Client-Server Lösung mit mehreren Servern
- Client-Server Lösung mit mehreren Servern und Middleware
Welche der drei genannten Lösungen bei den einzelnen Börsen Verwendung findet konnte nicht festgestellt werden, da es sich hierbei um betriebsinterne Daten der Börse handelt, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben.
4.5 Organisatorische Dimension
Die Zielsetzung der Börse sollte aus organisatorischer Dimension folgendermaßen aussehen. Durch die kooperationsunterstützenden Aspekte der Börse sollen Unternehmen sich organisatorisch an die neuen technischen Möglichkeiten anpassen und damit ihre Position im Wettbewerb verstärken oder verbessern können. Die kommunikationstechnische, informationstechnische und ablauftechnische Dimension sollte aber keinesfalls durch die organisatorischen Aspekte der Börse eingeschränkt werden.
Im folgendem werden die wichtigsten organisatorischen Aspekte einer Börse vorgestellt und anhand der durchgeführten Studie gezeigt, wie die einzelnen Börsen diese handhaben.
4.5.1 Kosten und Finanzierung
Eine Börse verursacht in der Entwicklung und später im Betrieb naturgemäß Kosten. Diese Kosten lassen sich in Entwicklungskosten (Hardware, Software, Personaleinsatz für die Programmierung und ...) und Betriebskosten (Personal, Administration der Datenbanken, Verwaltungskosten, ...) einteilen. Um die Kosten decken zu können, müssen ihnen auf der Gegenseite Einnahmen gegenüber stehen. Wie die Einnahmen der Börse entstehen bzw. wie die Börse finanziert wird, hängt in erster Linie vom Betreiber ab. Als Betreiber kann, wie es z.B. bei der IHK der Fall ist, eine Institution in Frage kommen, die ihre Börsen (Kooperations-, Technologie-, Recycling- und Existenzgründerbörse) als eine Zusatzleistung anbietet. Die Finanzierung dieser Börsen erfolgt in erster Linie durch öffentliche Mitteln.
Eine andere Variante ist das Betreiben einer Börse als eine Dienstleistung bzw. Unternehmung. Die Benutzer der Börse müssen dann für die Informationen, die sie aus der Börse beziehen, zahlen. Dabei kann es sich z.B. um Mitgliedsbeiträge oder Pauschalpreise handeln. Auf die diversen Formen der Zahlungsleistung wird später näher eingegangen.
Die Alternative zu der letzt genannten Möglichkeit der Betreibung, ist die Führung der Börse in Form eines eingetragenen Vereins. Ein Beispiel hierfür ist der Bundesverband f ü r Pharmazeutische Industrie e.V (vgl. [BPI99]). Diese
Börsen werden meist mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen finanziert. Bei den untersuchten Kooperationsbörsen handelt es sich um 45% Dienstleister/Unternehmer, 39% gehören der öffentlichen Hand, und 16% sind eingetragene Vereine.
Etwas anders sieht es bei den Technologiebörsen aus. Unter den untersuchten Technologiebörsen war kein Verein vorzufinden. Die Aufteilung hier: 62,5% sind Dienstleister und 37,5% sind Institutionen. Hierzu muß man aber anmerken, daß die beiden größten Datenbanken zwei Institutionen gehören, der IHK (vgl. [ULM99]) und Steinbeis-Europa-Zentrum (vgl. [SEZ99]).
Bei den Recyclingbörsen setzt sich der Trend weiter in Richtung Dienstleister/Unternehmen fort. Hinter knapp 79% der untersuchten Recyclingbörsen steht ein Unternehmen. Die Institutionen kommen auf 21%. Der Grund dafür, daß das Ergebnis für die Unternehmen so hoch ausfällt, hängt mit der Tatsache zusammen, daß in den Recyclingbörsen am meisten verdient werden kann. Denn Kooperationen können viel schneller, einfacher und mit weniger Problemen behaftet geschlossen werden, da es sich letztendlich um eine Zulieferer/Abnehmer Beziehung handelt. Denkbar wäre aber auch, daß in naher Zukunft mehr staatliche Einrichtungen dazu kommen, um gegen die zunehmenden ökologischen Probleme und die Knappheit an Ressourcen anzugehen.
Anders sieht es bei den Existenzgründerbörsen aus. Diese Börsen befinden sich in „öffentlicher Hand“. Über 85% sind Institutionen und weniger als 15% sind Unternehmen. Ein Grund für die hohe staatliche Präsenz ist, daß der Staat in den letzten Jahren Existenzgründer verstärkt fördern wollte und, wie es den Anschein hat, in Zukunft auch weiterhin tun wird.
Nachdem mögliche Betreiber einer Börse vorgestellt wurden, wird im Folgenden auf die Finanzierungsstruktur der Börsen eingegangen.
Es gibt viele Möglichkeiten eine Börse zu finanzieren. Sicherlich am Schönsten aus der Sicht des Benutzers, ist die kostenlose B ö rse. Solche Börsen können in Deutschland an sich nur aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Eine Finanzierung nur aus Werbemitteln kommt nicht in Frage, da die Börsen nicht die große Leseranzahl haben, wie beispielsweise eine Tageszeitung. Aus diesem Grund kann die Werbung nur als eine ergänzende Finanzierung in Frage kommen. Anders sieht es in den Vereinigten Staaten aus. Dort gibt es Börsen, die aus einem Sponsorenpool finanziert werden, wie beispielsweise die Recycle Net Corporation (vgl. [RNC99]). Für den Benutzer fallen dann keinerlei Kosten an.
Eine andere Finanzierungsart ist die Finanzierung der Börse durch Mitgliedsbeiträge. Sie kann aber auch wie die Werbeeinnahmen nur als eine Teilfinanzierng in Frage kommen, wie die durchgeführte Studie zeigt. Einzig die Europ ä ische Abfallhandels- und Informationsb ö rse (vgl. [EAI99]) wird anhand von Mitgliedsbeiträgen finanziert. Der Preis für die Mitgliedschaft beträgt einmalig 3600 DM. Das Geld wird aber zurückerstattet, wenn der neu eingetretene Benutzer zwei neu Mitglieder anwirbt.
Generell gibt es bei nur knapp 23% der Kooperationsbörsen eine Mitgliedspflicht. Hierbei ist berücksichtigt, daß die IHK -Börsen streng genommen nur für Mitglieder zugänglich sind, aber durch die Tatsache, daß die Firmen ohnehin IHK -Mitglieder sind, werden diese Börsen als nichtmitgliedspflichtige Börsen behandelt Bei den Technologiebörsen geht die Zahl der mitgliedspflichtigen Börsen noch weiter zurück. Sie liegt nur bei 12,5%. Ein ähnliches Bild gibt es bei den Existenzgründerbörsen. Unter ihnen ist keine mitgliedspflichtig. Der Grund für die niedrigen Quoten dieser Börsen liegt daran, daß es in diesen Börsen meist zu einer Kooperation kommt, die von längerer Dauer ist. Der Benutzer würde es wahrscheinlich als eine Hürde ansehen, sich zuerst durch eine Mitgliedschaft an die Börse zu binden, und zudem noch pauschal Beiträge für das Lesen oder Aufgeben von Inseraten zu zahlen.
Von einer anderen Art ist aber die Kooperation in den Recyclingbörsen. In dieser Börse kann es von einem Unternehmen aus betrachtet durchaus zu mehreren einmaligen (eventuell kurze) Kooperationen mit verschiedenen Kooperationspartnern kommen. Für diese Unternehmen ist es von Vorteil, über die Angebote bzw. Nachfragen innerhalb der Börse informiert zu sein. Auf Grund dessen wären sie durchaus bereit, durch eine Mitgliedschaft sich an die Börse zu binden. Das belegt die Studie. Knapp 43% der untersuchten Recyclingbörsen benötigen eine Mitgliedschaft.
Außer den genannten Einnahmequellen gibt es noch viele andere Wege, wie sich die Börsen finanzieren können. Bei einigen Börsen ist die Recherche in den Datenbanken kostenlos. Der Inserent muß pro Eintrag, die er in der Datenbank vor nimmt, einen Pauschalpreis, wie z.B. bei der Gesellschaft f ü r Innovation und Wissenstransfer mbH (vgl. [GIW99]), zahlen.
Bei der Wirtschaftsberatung OST-WEST (vgl. [WOS99]) beispielsweise ist das Suchen in den Anzeigen kostenlos. Kommt es aber zu einer Kooperation, ist ein Betrag von 250 DM an die Börse zu zahlen. Zudem werden für die Präsentation einer Anzeige monatliche Gebühren in Höhe von 100 DM erhoben.
Außer der bisher genannten Pauschalbeiträge gibt es noch die Möglichkeit einer variablen Finanzierung. Diese Finanzierung kann entweder gestaffelt nach Anzeige oder zeitabhängig erfolgen. Zeitabhängig berechnet z.B. die Voralberger Technologie Transfer Zentrum (vgl. [VTT99]) die Recherche in ihren Datenbanken. Von Datenbank zu Datenbank abhängig liegt der Preis für die Recherche bei 6 - 12 Schilling pro Minute.
Welche Finanzierungsart letztendlich die richtige ist, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Fest steht aber, daß in einer Börse mehrere Finanzierungsarten nebeneinander stehen können und erst durch deren Kombination eine solide finanzielle Basis für die Börse geschaffen wird.
4.5.2 Einzugsgebiet
Alle in dieser Studie untersuchten Börsen sind zwar internetbasiert und deshalb weltweit zugänglich, dennoch findet man nicht in jeder Börse internationale Anzeigen. Dies ist zum Teil auch nicht sinnvoll, wie beispielsweise in den Existenzgründerbörsen. Diese Börsen haben mehr regionalen höchstens nationalen Charakter. Ein anderes Beispiel sind die Recyclingbörsen. Wenn sich in diesen Börsen zwei Partner finden, kommt es zu einem Materialaustausch. Hier stellt sich die Frage, ob es für die Beteiligten aus transporttechnischen Gründen rentabel wäre, den Materialaustausch über große Distanzen durchzuführen.
Von den untersuchten Kooperationsbörsen haben 37,5% die deutschsprachigen Länder/national, 31,25% Europa, 18,75% Übersee und 12,5% regionale Orte als Einzugsgebiet. Bei den Technologiebörsen sieht das Bild folgendermaßen aus: 62,5% europaweit, 25% national/deutschsprachige Länder und 12,5% internationale Anzeigen.
Bei den Recyclingbörsen trifft das ein, was eingangs geschildert wurde. Das Transportproblem verhindert Kooperationen über zu lange Distanzen! In diesen Börsen sind die Anzeigen meist an deutschsprachige und westeuropäische Länder, mit folgender Aufteilung adressiert: deutschsprachige Länder/National mit 58,3% und europaweite Anzeigen mit 41,7%.
Noch klarer sieht es bei den Existenzgründerbörsen aus. In diesen Börsen regieren, wie zu erwarten, die regionalen Anzeigen. Die Einzugsgebiete dieser Börsen waren 42,85% regional und 28,57% national.
4.5.3 Sprache
Eng mit den Einzugsgebieten einer Börse verbunden, ist die Frage in welchen Sprachen der Inserent Anzeigen in einer Börse aufgeben kann. Eine Anzeige in einer multisprachigen Börse hätte wahrscheinlich größeren Erfolg, in nichtdeutschsprachigen Länder auf Aufmerksamkeit zu stoßen, als eine Anzeige auf Deutsch. Eine multisprachige Börse ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Börse europäisch bzw. international ausgerichtet ist. Nach der Muttersprache Deutsch, hat sich erwartungsgemäß Englisch als erste Fremdsprache durchgesetzt. Vereinzelt gibt es aber auch Börsen, in denen der Inserent auch auf italienisch oder französisch inserieren kann. Wieviel Prozent der Börsen die Möglichkeit einer Anzeigenaufgabe auf Englisch bieten, zeigen die folgenden Zahlen. In dieser Analyse sind die beiden amerikanischen Recyclingbörsen nicht mit einbezogen, da sie sonst das Bild verzerren würden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei fast allen Börsen müssen die Inserate von dem Benutzer selbst auf Englisch verfaßt werden. In dieser Hinsicht bietet die Wirtschaftsberatung OST-WEST einen besonderen Service. Im Preis für die Inserierung enthalten ist die Übersetzung des Inserates auf Englisch.
4.5.4 Aktualisierungsintervall
„Unter dem Aktualisierungsintervall wird der Zeitraum verstanden, in dem die Betreiber einer Börse ihre Anzeigen wieder auf dem neusten Stand bringen“ ([GRO98]). Der Idealfall, daß die Inserenten Ihre Anzeigen selbst ins Netz stellen und nach dem Kooperationsbeschluß wieder aus dem Netz entfernen, und damit größtmögliche Aktualität vorhanden ist, wurde noch bei keiner Börse realisiert.
Enttäuschend mußte im Laufe der Untersuchung festgestellt werden, daß die Börsen, aus nicht verständlichen Gründen keine konkreten Zeitangaben über Ihre Aktualisierungsintervalle machen! Solch eine Zusatzinformation würde sicherlich der Effektivität einer Börse dienen.
Allgemein kann aber behauptet werden, daß Börsen, die eine monatliche Gebühr für die Darstellung der Anzeigen im Web nehmen automatisch eine hohe Aktualität garantieren. Da die Unternehmen die Gebühr für den nachfolgenden Monat nicht mehr zahlen möchten, informieren Sie die Börse nach der eingegangenen Kooperation. Diese löscht darauf hin die Anzeige aus der Datenbank und es herrscht Aktualität.
4.5.5 Chiffre
Sinn des Chiffrerens ist es die Anonymität des Inserenten zu schützen. Viele Unternehmen haben einen erhöhten Bedarf anonym zu bleiben, damit mögliche Konkurrenten nicht über die laufenden Aktivitäten informiert werden.
Spitzenreiter beim Chiffren sind die Existenz- und Technologiebörsen. An dieser Börse möchten die Inserenten Ihr „Wissen“ besonders schützen. Bei knapp 72% der Existenz- und 62,5% der Technologiebörsen wird chiffriert.
Nicht ganz so hohe Anonymitätsansprüche bestehen bei den Kooperations- und Recyclingbörsen. Während bei den Kooperationsbörsen die Quote noch bei 39,39% liegt, geht sie bei den Recyclingbörsen auf knapp 22% zurück. Abschließend kann behauptet werden, daß der Rückgang der Chiffrerungsqoute in den genannten Börsen mit dem Rückgang des zu vermittelden Know-hows in den jeweiligen Börse positiv korreliert.
5 Fazit
Sinn und Zweck dieser Arbeit war es mögliche Kriterien vorzustellen, die es ermöglichen sollen, Börsen miteinander zu vergleichen und zu analysieren inwieweit die bestehenden Börsen die vorgestellten Kriterien erfüllen bzw. befolgen. Die Kriterien können als eine Art Checkliste benutzt werden, um Schwachstellen innerhalb einer Börse aufzuspüren und ggf. zu verbessern. Zudem sollte diese Arbeit einigen Börsenbetreibern Denkanstöße geben, um einerseits Ihre eigene Börse kritischer zu beobachten, und andererseits von der Konkurrenz in Sachen Komforterhöhung und Übersichtlichkeit zu lernen.
Es müßte festgestellt werden, daß die idealtypische Börse nicht existiert. Jede Börse hat auf seine Art und Weise Mängeln, aber auch Stärken. Es muß von Fall zu Fall unterschieden werden, inwieweit Verbesserungsmöglichkeiten sinnvoll sind. Es ist beispielsweise nicht nützlich, in einer regionalen Börse die Möglichkeit anzubieten, Inserate in verschiedenen Sprachen zu übersetzen...
Nachholbedarf haben vielen Börsen in Sachen Übersichtlichkeit, Navigation und Aufmachung der Internetseiten. Anstatt die Leser durch ein schönes Seitendesign für die Benutzung der Börse zu begeistern, wird der Leser sehr oft durch schlechte Navigationshilfen, aber auch durch ein schlechtes Seitenlayout entmutigt in den Datenbanken zu recherchieren.
Inwiefern diese Mängeln abgestellt werden und die in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren, wie z.B. Mailinglisten, bei einer Vielzahl der Börsen Einzug erhalten, kann nur die Zeit beantworten...
6 Quellenangaben
6.1 Literaturquellen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.2 Internetquellen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieser Arbeit über Börsen?
Der Zweck dieser Arbeit ist es, Kriterien vorzustellen, die es ermöglichen, Börsen miteinander zu vergleichen und zu analysieren, inwieweit bestehende Börsen diese Kriterien erfüllen. Sie dient als Checkliste zur Identifizierung von Schwachstellen und bietet Anregungen zur Verbesserung von Komfort und Übersichtlichkeit.
Was sind die internen Faktoren, die das Zustandekommen von Kooperationen verhindern?
Oftmals vermeiden Unternehmen Kooperationen aus Angst vor Know-how-Verlust, Übervorteilung oder der Annahme, "allein am besten" zu sein. Sie sind nicht bereit, ihre hierarchischen Strukturen aufzugeben oder scheuen den Aufwand vertraglicher Regelungen.
Was sind die externen Faktoren, die das Zustandekommen von Kooperationen verhindern?
Unternehmen haben oft mangels geeigneter Informationen nicht die Möglichkeit, einen passenden Partner zu finden. Mögliche Kooperationswerkzeuge sind unbekannt oder werden als unausgereift betrachtet.
Wie können Unternehmen über Kooperationsbörsen einen passenden Partner finden?
Kooperationsbörsen ermöglichen die Suche nach Partnern, je nach Reichweite, regional, national, europaweit oder weltweit. Durch die Nutzung von Online-Formularen, Datenbanken und Suchfunktionen können Unternehmen Kooperationsgesuche inserieren und Angebote finden.
Welche Arten von Börsen werden in dieser Arbeit unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Kooperationsbörsen (Handel, Dienstleistung, Produktion), Technologiebörsen, Softwarebörsen, Existenzgründerbörsen und Recycling-/Wertstoffbörsen.
Wie funktioniert eine Kooperationsbörse?
Unternehmen können Kooperationsgesuche oder -angebote in einer Datenbank inserieren. Interessenten können die Datenbank durchsuchen und entweder direkt mit dem Inserenten Kontakt aufnehmen oder die Börse als Vermittler nutzen.
Was sind Kooperationsgesuche und Kooperationsangebote?
Kooperationsgesuche sind Anfragen von Unternehmen, die einen Partner für eine bestimmte Kooperation suchen. Kooperationsangebote sind Anzeigen von Unternehmen, die eine Kooperation anbieten, z.B. in den Bereichen Handel, Dienstleistung oder Produktion.
Was sind die kommunikationstechnischen Dimensionen bei der Analyse von Börsen?
Die kommunikationstechnischen Dimensionen umfassen die Kommunikationsmedien (Internet, Telefon, Fax, E-Mail) und die Formalisierung der Eingaben (Nutzung von Masken mit Muss- und Freifeldern).
Was sind die informationstechnischen Dimensionen bei der Analyse von Börsen?
Die informationstechnischen Dimensionen umfassen die übersichtliche Bereitstellung von Informationen, schnelle und einfache Abrufbarkeit, Aktualität, Sicherheit und Vollständigkeit der Informationen. Zudem spielen Suchfunktionen eine wichtige Rolle.
Was sind die ablauftechnischen Dimensionen bei der Analyse von Börsen?
Die ablauftechnischen Dimensionen umfassen die einfache und nachvollziehbare Gestaltung der Abläufe, die größtmögliche Nutzung der Börse durch Inserate und Leser sowie eine hohe Effektivität durch viele Kooperationsvermittlungen. Dies umfasst auch das einfache Suchen, Aufgeben, Beantworten und Löschen/Ändern von Inseraten.
Was ist die aufbautechnische Dimension bei der Analyse von Börsen?
Die aufbautechnische Dimension beschreibt die Architektur der Börse, also die Client-Server-Lösung mit einem oder mehreren Servern, gegebenenfalls mit Middleware.
Was sind die organisatorischen Dimensionen bei der Analyse von Börsen?
Die organisatorischen Dimensionen umfassen Aspekte wie Kosten und Finanzierung der Börse, das Einzugsgebiet, die angebotenen Sprachen, das Aktualisierungsintervall der Inserate und die Möglichkeit der Chiffrierung.
Wie finanzieren sich Kooperationsbörsen?
Kooperationsbörsen können sich durch öffentliche Mittel, Mitgliedsbeiträge, Pauschalpreise pro Inserat, variable Gebühren oder eine Kombination dieser Finanzierungsarten finanzieren.
Warum ist das Aktualisierungsintervall der Inserate von Bedeutung?
Ein kurzes Aktualisierungsintervall gewährleistet, dass die angezeigten Inserate aktuell sind und nicht bereits veraltete Angebote oder Gesuche enthalten, wodurch die Effektivität der Börse gesteigert wird.
Was bedeutet Chiffrierung im Kontext von Kooperationsbörsen?
Chiffrierung bedeutet, dass die Identität des Inserenten geschützt wird, um Anonymität zu gewährleisten und zu verhindern, dass Wettbewerber Informationen über laufende Aktivitäten erhalten.
- Quote paper
- Reza Poorvash (Author), 1998, Aufbau eines "Kompetenzcenters Kooperationsbörsen" im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95322