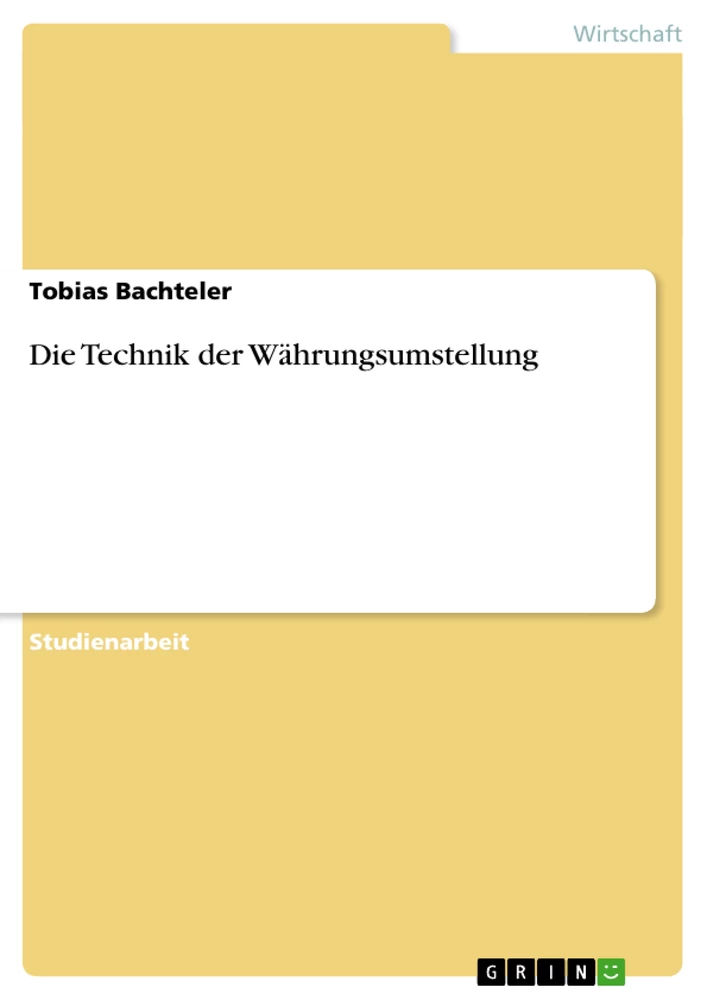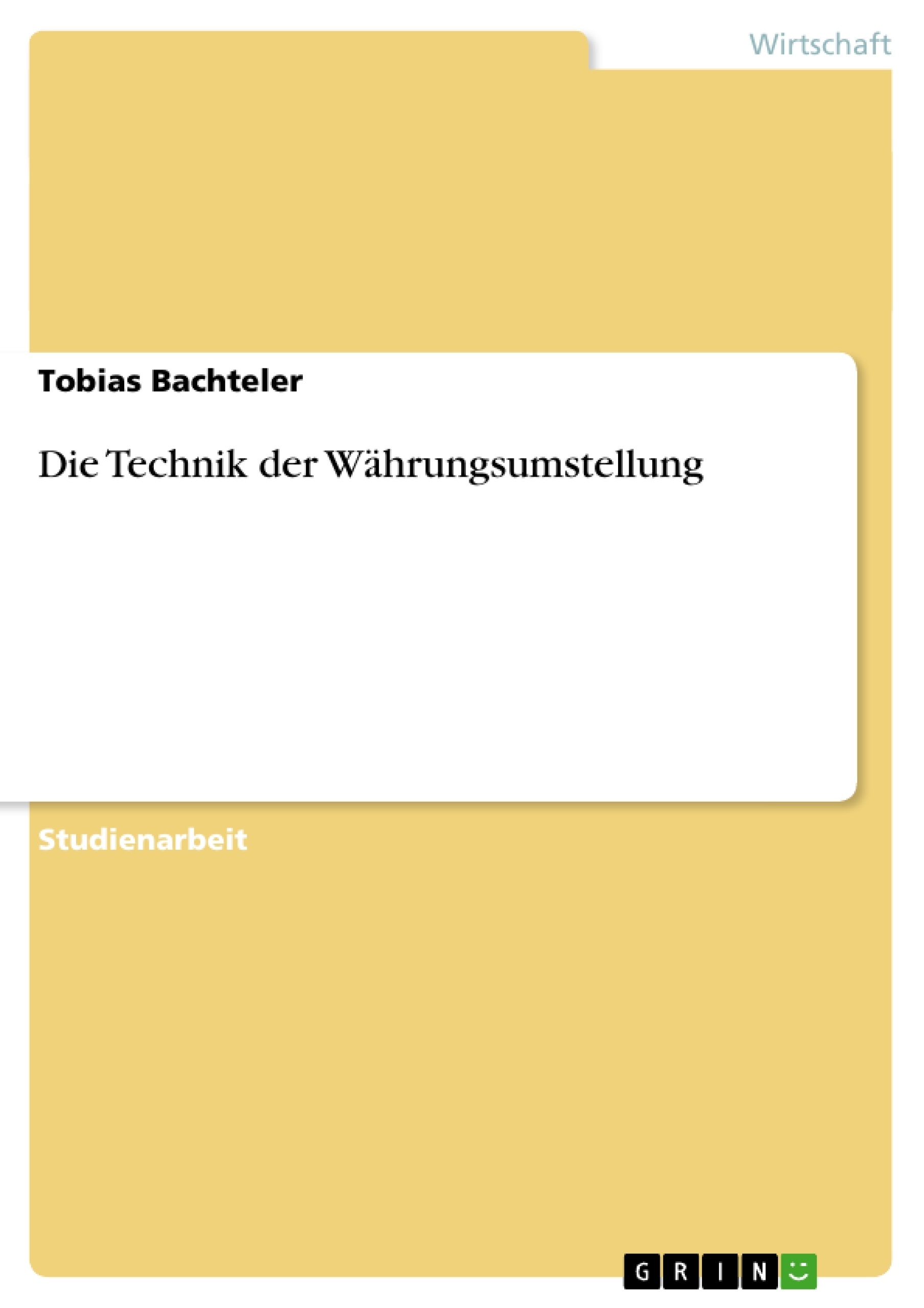Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
1. Umstellungsprozeß
2. Teilnehmerkreis
3. Verfahren zur Bestimmung der Kurse
4. Umrechnungskurse
II. Gesamtwirtschaftliche Untersuchung (Tobias Bachteler)
1. Rechtliche Rahmenbedingungen
a) Prinzip der rechtlichen Kontinuität der Verträge
b) Prinzip des rekurrenten Anschlusses
c) Prinzip der Erfüllung in der vereinbarten Vertragswährung
d) Internationale Fragen
e) „Kein Zwang, kein Verbot“
2. Umrechnungs- und Rundungsbestimmungen
a) Rundungsbestimmungen und Umrechnungskurse
b) Umrechnungsmethoden
c) Rundungsdifferenzen / Rückkonvertierungsproblem
d) Geringwertigkeitsproblem
3. Das neue Bargeld
a) Gestaltung
b) Jetzige Menge und zukünftiger Bedarf
c) Noten
d) Münzen
e) Münzgewinn und effektive Kosten 4. Einführung des Bargelds
a) Szenarien und Möglichkeiten
b) Vor-/Nachteile
c) Frontloading
d) Vorschläge und Meinungen
5. Problemstellungen bei Umstellung von z. B. Automaten, Kassen, Briefmarken
a) Umfang
b) Alternativen
c) Zeitbedarf für die Umstellung
d) Kosten
e) Briefmarken
6. Gesamtkostenabschätzungen der Umstellung
a) Zur Qualität der Kostenabschätzungen
b) Gesamtwirtschaftliche Kostenabschätzungen
c) Überleitung zu III. Unternehmensbezogene Untersuchung
III. Unternehmensbezogene Untersuchung (Christian Goetz)
IV. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Am 1. Januar 1999 begann die dritte Phase der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) mit der Einführung des Euro als Buchgeld.
Die Umstellung auf die neue Währung bringt zwei Seiten mit sich. Die eine berührt die Veränderung des wettbewerblichen und strategischen Umfelds von Unter- nehmen und der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und hat somit einen längerfristigen Charakter. Die andere behandelt die technischen Fragen. Die technische Umstellung umfaßt alle notwendigen Maßnahmen, um das Wirtschaften in der neuen Währung zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Umstellung, die sämtliche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche betrifft. Die einzelnen Aspekte dieser technischen Umstellung werden im folgenden näher untersucht.
1. Umstellungsprozeß
Die Verwirklichung der EWWU erfolgt in drei Stufen. Mit dem Jahreswechsel trat die 3. Stufe der EWWU in Kraft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Teilnehmerkreis
Am ersten Maiwochenende 1998 wurden die Gründungsteilnehmer der Währungs- union bestimmt. Auf den Vorschlag der Europäischen Kommission vom 25. März 1998 und (nach Anhörung des ECOFIN, des Rates der Wirtschafts- und Finanzminister der Mitgliedsländer) legte der Europäische Rat am 02.05.1998 folgende elf Teilnehmer fest, die von Anfang an, ab 1.1.1999, an der Währungsunion teilnehmen dürfen. Diese Entscheidung basierte auf den Konvergenzkriterien, die schon im Maastrichter Vertrag festgelegt worden waren.
Die elf Teilnehmerstaaten sind Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Spanien, Portugal, Irland und Finnland.
Die vier anderen Mitglieder der Europäische Union (EU), England, Dänemark, Schweden und Griechenland werden nicht zum 01.01.1999 an der Währungs- union teilnehmen. Während Griechenland aufgrund von Nichterfüllung der Konvergenzkriterien die Teilnahme verweigert wurde, standen die drei anderen Staaten freiwillig zurück. Allen vier Ländern steht der Beitritt zu einem späteren Zeitpunkt offen, die aktuellen Teilnahmekriterien bleiben bestehen. In England zum Beispiel zeichnet sich momentan die Tendenz ab, daß sowohl Politik wie auch Wirtschaft und Gesellschaft den nachträglich Beitritt 01.01.2002 befürworten.
3. Verfahren zur Bestimmung der Kurse
Der Euro ist eine eigenständige Währung, die einzelnen nationalen Währungen sind während der dreijährigen Übergangsphase lediglich nichtdezimale Unterein- heiten. Das bedeutet, genauso wie 10 Pfennig eine Untereinheit, nämlich ein Zehntel, einer DM sind, entspricht eine DM dem „1,95583stel“ eines Euro. Bis zum 31.12.1998 existierte der künstliche Währungskorb European Currency Unit (ECU), der sich aus einzelnen nationalen Währungen mit unterschiedlicher Gewichtung zusammensetzte. In der Ratsverordnung Nr. 1103/97 (Artikel 2) wurde festgelegt, daß zum Beginn der 3. Stufe der Währungsunion der ECU im Verhältnis 1:1 in den Euro übergeht.
Der ECOFIN - Rat legte am 02.05.1998 nicht nur die Teilnehmer für die EWWU fest, sondern auch die bilateralen Wechselkurse der einzelnen Teilnehmerländer, die allerdings erst ab dem 01.01.99 gelten sollten, also weiterhin flexibel waren im Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS). Die bilateralen Kurse der ohnehin sehr stabilen Paritäten des EWS dienten als Basis der Festlegung. Um etwaigen Kursschwankungen entgegenzuwirken und die Kurszielerreichung zum Jahresende hin zu garantieren, verpflichteten sich die Notenbanken diese Kurse zu verteidigen. Aufgrund der angesprochenen Stabilität stellte sich dies jedoch nie als problematisch dar.
Die Kurse der einzelnen nationalen Währungen zum Euro wurden erst am 01.01.1999 unwiderruflich festgelegt. Am 31.12.1998 um 11:30 Uhr wurde zum letzten Mal der Wert der Kunstwährung ECU bestimmt. Da an ihr beispielsweise auch das britische Pfund mit 13,4 % beteiligt war sowie die griechische Drachme und die dänische Krone, konnten die endgültigen Wechselkurse der teilnehmenden Währungen zum Euro nicht einfach aus dem aktuellen Stand des ECU übernommen werden. Sie mußten erst vom Einfluß dieser nicht teilnehmenden Währungen rechnerisch bereinigt werden, woraufhin der ECOFIN zu folgendem unwiderruflichen Ergebnis kam.
4. Umrechnungskurse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
II. Gesamtwirtschaftliche Untersuchung
1. Rechtliche Rahmenbedingungen
Die umfassenden Änderungen und Umstellungen in allen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Bereichen erfordern verläßliche und in allen Teilnehmerländern verbindlich geltende rechtliche Bestimmungen. Durch die Verabschiedung von zwei umfangreichen Euro-Verordnungen hat der Rat der EU dem Rechnung getragen und sämtliche relevanten Punkte geklärt.
a) Prinzip der rechtlichen Kontinuität der Verträge
Die erste Verordnung (VO 1103/97 EG) wurde bereits am 17.06.1997 verab- schiedet und gilt in allen 15 EU Mitgliedsstaaten, also auch in den vorerst nicht an der EWWU beteiligten. Sie enthält das sogenannte Prinzip der rechtlichen Kontinuität der Verträge. Dieses besagt generell, daß Inhalte von Verträgen nach der Umstellung auf die neue Währung weiterhin gelten. Insbesondere gilt dies für Zinssätze, Ablaufdaten und andere Bestimmungen, sowie für Lieferungs- und Leistungsverträge, in denen Zahlungen in einer der abgelösten Währungen vereinbart sind. Weder für den Gläubiger noch für den Schuldner entsteht durch den Euro das Recht, Verträge zu kündigen, zumal auch der sogenannte „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ nicht geltend gemacht werden kann. Diese Kontinuität der Rechtsordnung gilt auch für weitere Bereiche, wie z. B. Testamente, Gerichts- urteile und Verwaltungsakte, was eine umfassende Rechtssicherheit garantiert.
Sicherlich können Nachverhandlungen, wenn sich beide Vertragspartner darauf einigen, nach dem Prinzip der Privatautonomie vorgenommen werden. Dies st sogar wahrscheinlich, wenn die Grundlage von Verträgen durch die Umstellung weggefallen ist oder verändert wurde, wie z. B. der Diskontsatz der Deutschen Bundesbank.
b) Prinzip des rekurrenten Anschlusses
Die zweite Euro-Ratsverordnung (VO 974/98), verabschiedet am 03.05.1998, gilt erst seit dem 01.01.1999 und nur für die elf Teilnehmerländer an der Währungs- union. Sie definiert das Prinzip des rekurrenten Anschlusses, welches besagt, daß sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten auch über den 01.01.1999 hinaus bestand haben. Sollten während der dreijährigen Übergangszeit die Vertrags- partner nicht ohnehin schon ihre geschäftlichen Beziehungen auf den Euro umgestellt haben, so wird dies automatisch zum 01.01.2002 der Fall sein. Dies gilt z. B. für Mietverträge, Tilgungen, Löhne und auch für Gesetze.
Auch hierbei zwingt die Währungsumstellung die Vertragspartner nicht zu Neuverhandlungen, allerdings wird die Tatsache, daß vorher „runde“ DM Beträge durch die Umrechnung nun zu „krummen“ Euro Beträgen werden, wohl bei vielen Verträgen dieser Art eine Aktualisierung der Vertragsinhalte nahelegen.
c) Prinzip der Erfüllung in der vereinbarten Vertragswährung
Während des Übergangszeitraums regelt die zweite Verordnung ebenfalls das Grundprinzip der Erfüllung in der vereinbarten Vertragswährung. Alle vertraglichen Vereinbarungen, Gesetze, Urteile, Schenkungen und ähnliches sind also in der vereinbarten Währung zu erfüllen, es sei denn, die Vertragspartner verständigen sich im Sinne der Privatautonomie auf andere Regelungen. So kann beispiels- weise auch die Möglichkeit zur Zahlung in beiden Währungen vereinbart werden.
d) Internationale Fragen
Problematisch könnten Verträge mit Drittländern werden. Allerdings dürften auch im internationalen Recht die Prinzipien der rechtlichen Kontinuität und des rekurrenten Anschlusses für die nötige Rechtssicherheit sorgen. Schulden an einen ausländischen Vertragspartner, der auch nach dem 01.01.2002 auf Zahlungen in DM besteht, können danach prinzipiell auch in Euro beglichen werden. Es entstünde allerdings ein Problem, wenn die Wertentwicklung des Euro außergewöhnlich und unerwartet stark in die eine oder andere Richtung tendiert, was aber unter Beachtung der strengen Stabilitätskriterien äußerst unwahrschein- lich ist. Trotzdem wird geraten, sicherheitshalber einen Gerichtsstand innerhalb eines EWWU-Landes zu vereinbaren. Zusätzlich sollten bei Verträgen mit langer Laufzeit für bestimmte Fälle Diskontinuitäts- bzw. Kontinuitätsklauseln in den Vertrag aufgenommen werden.
e) „Kein Zwang, kein Verbot“
Um Unternehmen im „Euro-Land“ größtmögliche Freiheit zu gewähren, wurde das Prinzip „Kein Zwang, kein Verbot“ („no compulsion, no prohibition“) adoptiert, daß den Umstellungszeitpunkt innerhalb der dreijährigen Übergangszeit mit nur wenigen Ausnahmen freistellt. Darauf wird im zweiten, unternehmensspezifischen Teil der Arbeit noch tiefer eingegangen.
2. Umrechnungs- und Rundungsbestimmungen
Bei einer Währungsunion, an der elf Währungen der teilnehmenden Staaten in Euro umgerechnet werden müssen, bedarf es genauen Richtlinien für die Hand- habung der Umrechnung und der unvermeidlichen Rundungen. Diese vielfachen Regelungen mögen den Eindruck erwecken, unnötig genau und detailliert zu sein, sind aber durch den Umfang und die nötige Genauigkeit der Umstellungen durchaus gerechtfertigt.
a) Rundungsbestimmungen und Umrechnungskurse
Da sich bei der Umrechnung von Euro Beträgen in nationale Währungen und umgekehrt „krumme“ Beträge ergeben, muß gerundet werden. Es wird beim Euro auf den Cent gerundet, bei der DM auf den Pfennig usw. Bei der Lira beispiels- weise, die keine Untereinheit hat, wird auf die letzte Stelle gerundet. Wie üblich, wird auch hier kaufmännisch gerundet, d. h. abgerundet bei nachfol- gender Ziffer kleiner fünf und aufgerundet bei nachfolgender Ziffer größer oder gleich fünf.
Die in der Einleitung bereits dargestellten, unwiderruflichen Umrechnungskurse haben sechs signifikante Stellen, d. h. eine Ziffer vor dem Komma und fünf danach. Bei dem irischen Pfund, dessen Wert über dem eines Euro liegt, zählt die null vor dem Komma nicht als signifikante Stelle, er wird also mit sechs Nachkommastellen bestimmt. Der italienische Umrechnungskurs dagegen hat vier Vorkommastellen und folglich nur zwei Nachkommastellen.
Diese Kurse dürfen nie gerundet werden, um Ungenauigkeiten zu vermeiden. Außerdem sind die Kurse immer im Verhältnis nationale Währung zu Euro fest- gelegt. Inverse Kurse (also das Verhältnis Euro zu nationaler Währung) dürfen nicht gebildet werden, da sie zwangsläufig in manchen Fällen zu Rundungs- differenzen führen.
Beispiele:
1 Euro = 6,55957 Französische Francs Dieser Umrechnungskurs darf auf keinen Fall auf z. B. 6,6 oder 6,5596 gerundet werden.
1 Euro = 1,95583 DM Rechnerisch könnte man ebenso die DM als Basis nehmen und den Kehrwert bilden:
1 DM = 0,5112918... Euro = 0,511292 Euro (sechs signifikante Stellen)
Dieser inverse Kurs darf nicht gebildet werden, da er durch die durchgeführte Rundung in manchen Fällen Differenzen in den berechneten Ergebnissen zur Folge hätte.
b) Umrechnungsmethoden
Um einen Betrag aus einer nationale Währung in Euro umzurechnen, muß folglich der Betrag durch den Umrechnungskurs dividiert werden.
Beispiel:
1.000.000 Niederländische Gulden = ? Euro
1.000.000 : 2,20371 = 453.780,21609 Euro = 453.780,22 Euro Würde man zuerst den inversen Kurs bestimmen
1 Gulden = 0,45378022 Euro = 0,453780 Euro (sechs signifikante Stellen), käme man dagegen auf ein anderes Ergebnis:
1.000.000 * 0,453780 = 453.780 Euro Eine Differenz von 22 Cent!
Bei der Umrechnung eines Euro Betrags in eine der nationalen Währungen ist der Euro Betrag mit dem Umrechnungskurs zu multiplizieren. Auch hierbei können inverse Kurse zu Ungenauigkeiten führen und sind somit nicht erlaubt. (Ohne Beispiel)
Soll ein Betrag von einer nationalen Währung in eine andere umgerechnet werden, so muß ersterer nach obigen Regeln zuerst auf Euro und dieser dann weiter in die zweite Währung umgerechnet werden. Diese Rechenmethode wird triangulär genannt. Hierbei ist zu beachten, daß der Euro Betrag minimal auf drei Nachkommastellen gerundet werden darf, um kleinstmögliche Differenzen zu gewährleisten.
Wichtig ist, daß keine sogenannten Cross-Rates bestimmt werden dürfen, also Umrechnungskurse von zwei nationalen Währungen untereinander. Ein Paritätengitter mit allen elf alten Währungen und dem Euro ist bei den elf verbindlichen Kursen und der beschriebenen Rechenweise nicht nötig.
Allerdings sind andere Rechenmethoden für einzelne Umrechnungen erlaubt (beispielsweise über individuell bestimmte Cross-Rates), solange sie zum demselben Ergebnis wie der beschriebene Algorithmus führen. Mathematische Simulationen haben allerdings bewiesen, daß keine ebenfalls sechsstelligen Cross-Rates existieren, die immer das gleiche Ergebnis liefern.
Beispiel:
50.000 Spanische Peseten = ? Irische Pfund
50.000 : 200,482 = 249,398948 Euro = 249,399 Euro Rundung auf minimal drei Nachkommastellen! 249,399 Euro = ? Irische Pfund
249,399 * 0,787564 = 196,417674 Irische Pfund = 196,42 Irische Pfund
(Auf den Beweis der möglichen Ungenauigkeit von direkten Cross-Rates wird verzichtet.)
c) Rundungsdifferenzen / Rückkonvertierungsproblem
An folgendem Beispiel kann leicht gezeigt werden, wie Rundungsdifferenzen entstehen können.
Beispiel:
500 DM = ? Euro
500 : 1,95583 = 255,64594 Euro = 255,65 Euro
255,65 Euro = ? DM
255,65 * 1,95583 = 500,0079395 DM = 500,01 DM
Differenz 1 Pfennig!
Dieses Phänomen wird Rückkonvertierungsproblem genannt.
Dies kommt z. B. beim Einkauf im Supermarkt zum Tragen, wo inzwischen ja sowohl in DM als auch in Euro bezahlt werden kann. Bei einigen Produkten wird der DM Betrag durch die Rundung auf zwei Stellen geringfügig höher sein als sein Preis in Euro, bei einigen niedriger. Dies ist bei Großeinkäufen nicht relevant, da nach dem Gesetz der großen Zahl1 sich diese Abweichungen bei einer größer werdenden Anzahl von Positionen immer weiter ausgleicht.
Da dieses Gesetz bei einer bestimmten Auswahl an Produkten nicht greift, wenn man nämlich nur Artikel kauft, die in DM etwas teurer sind als in Euro, sich der Fehler also summiert (Summierungsproblem), wird dem Einzelhandel vorgeschlagen, diesem Problem mit folgender Methode zu begegnen.
Es wird eine Referenzwährung festgelegt, entweder DM oder Euro, in der die interne Kalkulation vorgenommen wird und die Preise verbindlich festgelegt werden. Die andere Währung, mit der die Preisauszeichnungen natürlich auch versehen sind, dient lediglich der Information des Kunden und nicht als Rechen- grundlage. D. h. also, wenn die neue Währung als Referenzwährung bestimmt wird, werden die DM Preise zwar bestimmt und dabei auch gerundet, doch unabhängig davon, in welcher Währung der Kunde am Ende bezahlt, werden die Einzelpreise auf jeden Fall in Euro addiert. Sollte der Kunde am Ende in Euro bezahlen, findet also überhaupt keine Rundung statt, bei Zahlung in DM wird nur der zu bezahlende Endbetrag in Euro umgerechnet und gerundet. Die maximale Rundungsdifferenz ist also bedeutend geringer, als wenn alle Produkte einzeln gerundet würden.
Besondere Relevanz gewinnt diese Methode bei Preisen von z. B. Benzin, Strom oder Wasser. Da auf einer Benzinrechnung nicht verschiedene Preise addiert werden, sondern nur einer multipliziert wird, akkumulieren sich hier mögliche Rundungsdifferenzen sehr schnell.
Beispiel:
1 Liter Benzin kostet 1,52 DM.
Dies entspricht 1,52 : 1,95583 = 0,77716 Euro = 0,78 Euro
Bei einer Tankfüllung von 50 Liter kann der Kunde entweder
50 * 1,52 DM = 76 DM oder
50 * 0,78 Euro = 39 Euro bezahlen.
Ein kluger Rechner würde diese Rechnung in DM begleichen, denn
76 DM = 76 : 1,95583 = 38,85818 Euro = 38,86 Euro, d. h. es hat sich bei diesem verhältnismäßig geringen zweistelligen Betrag schon ein Fehler von 14 Cent aufsummiert!
Würde die Tankstelle die DM als Referenzwährung festlegen, kostet das Benzin ab jetzt immer noch 1,52 DM oder 0,78 Euro (siehe obige Rechnung). Allerdings würde die Rechnung über 50 Liter Benzin jetzt auf jeden Fall in der Referenzwährung DM berechnet und erst der Endbetrag auf Euro umgerechnet, sollte der Kunde in der neuen Währung bezahlen.
50 Liter * 1,52 = 76 DM
76 DM = 38,86 Euro
Sicherlich ist auch diese Rechnung nicht frei von Rundungsdifferenzen, doch sind sie deutlich geringer.
Die Technik der Währungsumstellung
Diese trotzdem vorkommenden „fehlenden“ Pfennige oder Cents werden in Unternehmen buchhalterisch über ein Sonderkonto „Rundungsdifferenzen“ verbucht.
d) Geringwertigkeitsproblem
Das Geringwertigkeitsproblem umfaßt zwei Aspekte.
Zum einen ist die kleinste Einheit der neuen Währung 1 Cent, also beinahe der doppelte Wert eines Pfennigs. Bei sehr geringwertigen Produkten müssen hier also Preis- und/oder Mengenanpassungen vorgenommen werden. Zweitens zeigt sich mathematisch, daß die Rundungsdifferenzen prozentual größer sind, wenn immer kleinere Beträge umgerechnet werden. Dies liegt daran, daß immer auf den nächsten Cent gerundet wird. Bei diesen Größenordnungen können durchaus zweistellige prozentuale Verfälschungen die Folge sein. Dem kann damit begegnet werden, daß mit höherer Genauigkeit gerechnet wird, z. B. also nicht auf den nächsten Cent gerundet, sondern intern mit Bruchteilen von Cents weiterkalkuliert wird.
3. Das neue Bargeld
a) Gestaltung
Die Stückelung der neuen Euro Banknoten wird sehr ähnlich der DM Noten sein. Es werden 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro Scheine produziert, die EWWU- weit identisch sein werden. Die Münzen sind folgendermaßen gestückelt: 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent, 1 und 2 Euro. Während die Vorderseiten der neuen Münzen, die auch die Wertprägung enthalten, in allen elf Staaten gleich sind, werden die Rückseiten national individuell gestaltet. Deutschland zum Beispiel wird die Rück- seiten der 1, 2 und 5 Cent Münzen mit dem Eichenzweig versehen, die der 10, 20 und 50 Cent Münzen mit dem Brandenburger Tor und die der 1 und 2 Euro Münzen mit dem Bundesadler. Spanien beispielsweise versieht die Münzen mit dem Abbild des Königs.
Trotz dieser Individualisierung werden neben den Noten auch die verschiedenen Münzen in ganz Europa gelten. Es kann also ein Deutscher im Urlaub in Italien mit einer 1 Euro Münzen bezahlen, die den belgischen König abbildet.
Das Design des neuen Bargelds wurde durch zwei vom Europäischen Währungsinstitut (EWI) geleitete Gestaltungswettbewerbe entworfen. Die Vorschläge zur Notengestaltung des Österreichers Robert Kalina überzeugten die Jury, die Münzengestaltung wurde von dem Belgier Luc Luycx entworfen.
Die Euro Scheine bilden Zeitalter und Stile in der Geschichte Europas ab, auf jedem Schein wird eine Epoche dargestellt, geordnet nach der Abfolge in der Geschichte und dem Wert der Note. Die Klassik auf dem 5 Euro Schein, weiterhin die Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Eisen- und Glasarchitektur und die moderne Architektur des 20. Jahrhunderts auf der 500 Euro Note. Auf die Abbildung einzelner Prominenter oder nationaler Bauwerke wurde verzichtet, um Streitigkeiten bei der Auswahl der Motive vorzubeugen.
Wie auch schon die DM Scheine werden auch die neuen wieder durch folgende Merkmale an die Bedürfnisse sehbinderter Personen angepaßt: ihre unterschiedlichen Abmessungen, die deutlichen Hauptfarben, ihre Tasteigenschaften und ihre sehr deutlichen und groß abgebildeten Ziffern.
b) Jetzige Menge und zukünftiger Bedarf
Die Bundesbürger sind im Moment durchschnittlich mit etwas mehr als 30 Scheinen pro Person ausgestattet, also insgesamt mit 2,6 Mrd. Noten. Zusätzlich sind momentan 12 Mrd. automatengängige Münzen (10 Pf - 5 DM) im Umlauf. Für die Bundesrepublik werden seit Anfang diesen Jahres bis zum Ende der Übergangsphase am 31.12.2001 vier Mrd. Noten gedruckt und 12 Mrd. Münzen geprägt. Da davon nur 8,6 Mrd. automatengängige geplant sind, könnte in der Anfangsphase das Kleingeld sprichwörtlich mal knapp werden.
EWWU-weit werden 12 Mrd. Scheine gedruckt und 80 Mrd. Münzen gepreßt. Alle Scheine aufeinandergestapelt würden 1380 km in die Höhe reichen, während das Münzaufkommen ca. 300.000 t wiegt.
Die Festlegung der jeweiligen Auflage an Noten und Münzen pro Land beruht auf Schätzungen des EWI. Den nationalen Notenbanken steht es zu, diese Druck- und Prägeaufträge dann weiterzugeben um die Produktion fristgerecht bis zum 01.01.2002 sicherzustellen.
c) Noten
Der deutsche Bedarf an Euro Noten wird durch modernste drucktechnische Ver- fahren zur einen Hälfte von der Bundesdruckerei in Berlin gedeckt, zur anderen Hälfte von deren privatwirtschaftlichen Konkurrenz, der Firma Giesecke & Devrient in München. Der Druck begann mit der ersten Nullserie im Herbst 1998, der eigentliche Produktionsstart der jeweils zwei Mrd. Scheine war Anfang diesen Jahres, was zugleich die letzte Produktionsrunde für DM Noten bedeutete.
Die Kosten für die Neuproduktion liegen bei durchschnittlich 18 Pf pro Schein, was trotz des sehr großen Loses ein teurer Preis ist, mit dem man das aufwendige Druckverfahren zur Garantie der Fälschungssicherheit bezahlen muß. Unter Aus- nutzung mehrerer kostensenkender Effekte entsteht für die neuen Banknoten immer noch ein Kostenvolumen von ca. 470 Mio. DM für Deutschland. Die 2,6 Mrd. alten DM Scheine werden ab dem 01.01.2002 von den Landeszen- tralbanken eingezogen und vernichtet. Jeder Schein wird in 8000 Schnipsel gerissen und endet entweder als Brikett oder einfach im Müllsack auf der Deponie. Eine Bremer Umweltschutzfirma hat in einer Studie publiziert, daß sich die Schnipsel der alten Noten sehr gut als Kompostbeigabe im Biomüll eignen und sich nach 8 Wochen bereits aufgelöst haben würden.
d) Münzen
Testprägungen in der Prägeanstalt Berlin im August 1998 läuteten die Produktion der 12 Mrd. Münzen für die Bundesrepublik ein. 47.000 t oder 1.632 Güterwagen der Bahn veranschaulichen diese Menge. Nach der Testprägung von 71 Mio. Stück, die der Justierung und Optimierung der Werkzeugeinstellungen diente, wurden diese „Probe-Euros“ wieder eingeschmolzen. Parallel zur Notenproduktion begann dann in den fünf deutschen staatlichen Prägeanstalten Berlin, Stuttgart, München, Karlsruhe und Hamburg die Produktion der deutschen Euromünzen.
Einen ähnlichen Zeitplan verfolgen Frankreich und Belgien, die auch schon im vergangen Herbst mit Testprägungen begannen, während die anderen Länder der EWWU noch nicht ganz so weit sind.
Die Kosten für die deutsche Münzproduktion liegen bei 600 Mio. DM.
e) Münzgewinn und effektive Kosten
Vor der Währungsunion lag die Münzhoheit, d. h. das Recht, Münzprägungen in Auftrag zu geben, beim deutschen Finanzminister. Mit der Aufgabe der geldpoli- tischen Souveränität verlagerte sich diese Verantwortung auf die Deutsche Bundesbank, die mit Genehmigung der EZB nun Euromünzen pressen lassen kann.
Der Münzgewinn oder Seignorage ist die Differenz zwischen den Herstellkosten und dem Nennwert der jeweiligen Münze, denn die EZB kauft die Münzen den Prägeanstalten bzw. den einzelnen Staaten zu ihrem Nennwert ab und bringt sie dann in Umlauf. Da die Herstellkosten nur bei den geringwertigen Euromünzen, 1 und 2 Cent, über dem Nennwert liegen, wird durch die Prägung ein Gewinn erwirtschaftet, der dem Haushalt zufließt.
Sicherlich öffnet dies die Möglichkeit zum Mißbrauch, denn ein erhöhtes Produk- tionsvolumen würde auch die Seignorage steigern. Aus diesem Grund hat die Verteilung der Herstellungsvolumnia die EZB übernommen und den Teilnehmer- ländern entsprechend ihrem Bedarf zugeteilt. Luxemburg hat dementsprechend eine deutlich niedrigere Losgröße als die Bundesrepublik und folglich auch einen schmaleren Münzgewinn.
Die Kosten der Bargeldproduktion in Deutschland kann also aufgrund obiger Zahlen zu ca. 1 Mrd. DM summiert werden. Allerdings stellt dies eine sehr ein- dimensionale Sicht- und Rechenweise dar. Eine deutsche 100 DM Note hat eine durchschnittliche Lebenszeit von vier bis fünf Jahren, 10 DM und 20 DM Noten sind sogar nur ca. 1 ½ Jahre im Umlauf. Jährlich werden über 30% der DM Scheine ersetzt. Wenn man diese hohen regelmäßigen Verschleißkosten von der Kostensumme abzieht, bleibt insgesamt ein durchaus vertretbarer finanzieller Aufwand.
4. Einführung des Bargelds
a) Szenarien und Möglichkeiten
Zwei Termine sind bei der Einführung des neuen Bargelds von entscheidender Bedeutung. Erstens der Erstausgabetermin, in der aktuellen Planung der 01.01.2002, und zweitens die Dauer der Doppelwährungphase, die momentan auf sechs Monate, also bis zum 30.06.2002 angesetzt ist.
Die Länge dieser Phase, in der sowohl die nationalen Währungen als auch der Euro als Bargeld gesetzliche Zahlungsmittel sind, steht im Moment noch im Mittelpunkt einer Debatte. Auf dem EU Gipfel in Madrid 1995 wurde lediglich die maximale Dauer von sechs Monaten festgelegt. Sie könnte auch auf zwei Monate verkürzt werden, auf zwei Wochen oder sogar auf nur eine Nacht. Diese Sofortumstellung wird als Big Bang bezeichnet.
Eine Veränderung des Erstaugabetermins ist unwahrscheinlich, da die dreijährige Dauer mit den knappen Produktionskapazitäten der nationalen Notenpressen und Prägeanstalten begründet wird, die eine zügigere Bereitstellung des Bargelds nicht ermöglichen können.
Auch die Frage, wer den Umtausch vornehmen soll, ist noch nicht endgültig geklärt. Selbstverständlich werden die Banken die Hauptlast zu tragen haben. Aber auch der Handel, der voraussichtlich bis zum 28.02.2002 auf DM auch DM Bargeld als Wechselgeld herausgeben wird, danach aber nur noch Euro, wird dadurch zum Umtausch der Währungen beitragen.
b) Vor- und Nachteile
Die Vorteile des Big Bangs liegen auf der Hand. Die Kostenbelastung aller Unternehmen, vom Ein-Mann-Krämerladen bis hin zum Großkonzern, wird deutlich gesenkt, da die Dauer des Doppelaufwands verkürzt wird. Große Einzelhändler, Banken, die Post, Nahverkehrsbetriebe und ähnliche nehmen täglich tonnenweise Münzen ein. Die getrennte Zählung, Aufbewahrung, Transport, zusätzlicher Tresorraum usw. bedeuten sehr hohe Zusatzkosten.
Hingegen spricht sich selbstverständlich die automatenbetreibende Industrie gegen einen Big Bang aus. Ein Umstellung der Automaten in Deutschland und Europa in so kurzer Zeit ist schlichtweg unmöglich. Zudem stellt die Bereitstellung des Bargelds vorab, d.h. vor dem 01.01.2002, das sogenannte Frontloading, ein Problem dar, auf das im folgenden Abschnitt noch tiefer eingegangen wird. Das Argument, bei einer „Blitzumstellung“ habe die Bevölkerung keine Zeit, sich an das neue Geld zu gewöhnen, erweist sich jedoch bei näherem Hinsehen als hohl, da schon während der dreijährigen Übergangszeit das Bewußtsein für den Euro entwickelt wird. Zumal ist es eine Tatsache, daß bei der Verfügbarkeit beider Währungen in bar diejenige vorwiegend benutzt wird, die bekannt ist. Das Euro Bargeld wird also - unabhängig von der Dauer der vorangegangenen Doppel- währungsphase - erst ab dem Datum, ab dem die DM nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel ist, vollständig genutzt werden.
c) Frontloading
Wie schon im vorigen Abschnitt angesprochen bedeutet Frontloading die vorge- zogene Ausgabe von Euro Bargeld vor dem 01.01.2002. Um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten und das schnellstmögliche Ersetzen der nationalen Währung zu ermöglichen, werden nach dem Willen der EZB, der Kommission und der Bundesbank die Kreditinstitute, der Handel und Werttrans- portunternehmen schon zum Jahresende hin mit ausreichenden Mengen an Bargeld versorgt werden.
Momentan wird jedoch sogar ein noch weiterreichendes Frontloading debattiert. Der Europäische Handel fordert, auch die Verbraucher im vorhinein mit Bargeld zu versorgen, um die Doppelwährungsphase effektiv verkürzen zu können. Allerdings wird dieser Vorschlag von der EZB und der Kommission noch blockiert.
d) Vorschläge und Meinungen
Im Folgenden sind verschiedene Vorschläge und Meinungen zu diesen Fragen und Alternativen aus der aktuellen Debatte aufgezeigt.
EU-Währungskommissar Yves-Thibault de Silguy erklärt die prinzipielle Offenheit der Kommission für eine frühere Einführung des Bargelds. Unter der Voraus- setzung, daß alle elf Teilnehmer zustimmen, würde die Kommission zügig einen Vorschlag erstellen.
Alexandre Lamfalussy, der ehemalige Präsident des EWI, forderte eine Verkür- zung des Ausgabezeitraums und der Doppelwährungphase, da zu der geplanten Zeit ohnehin saisonspezifische Hochbelastungen wie das Weihnachts- und anschließende Umtauschgeschäft sowie in vielen Unternehmen die Inventur anstehen.
Ein darauf aufbauender Vorschlag, der auch von Belgiens Finanzminister JeanJacques Viseur mitgetragen wird, beinhaltet ein Vorziehen der Bargeldausgabe in das Jahr 2001, zum Beispiel auf den 01.03. oder den 01.10.
Sprecher des Bundesfinanzministeriums ließen allerdings verlauten, daß derartige Vorschläge nicht realisierbar seien, da auch bei Vollauslastung der Kapazitäten die Geldproduktion ca. drei Jahre in Anspruch nehme.
Auch der ECOFIN will aus organisatorisch-technischen Gründen keine Zustimmung zu einer verfrühten Bargeldeinführung geben.
Ebenso hält Herr Edgar Meister, Direktoriumsmitglied der Deutschen Bundesbank, eine Terminänderung nicht für angebracht, da eine nennenswerte Fristverkürzung nur mit erheblichem Aufwand möglich sei.
Das Magazin Wirtschaftswoche wirft eine andere Sichtweise auf. Auf dem EU Gipfel in Madrid 1995 wurde die Übergangszeit von drei Jahren festgelegt, da Lobbyisten damals mit dem Argument der Kapazitätsgrenzen eine Mindestproduktionsdauer von drei Jahren errechneten. Zusätzlich hätten Sparkassen und Genossenschaftsbanken auf eine langsame Umstellung gedrängt, um nicht von Großbanken überrollt zu werden.
Die Redakteure allerdings untersuchten diese Produktionsbedingungen genauer und kamen zu folgendem Ergebnis. Die Produktionsdauer für die in Deutschland vorgesehenen 12 Mrd. Münzen wäre nur dann wirklich drei Jahre, wenn aus- schließlich die fünf staatlichen Prägeanstalten, mit ihrer durchschnittlichen Jahreskapazität von ca. 800 Mio. -1 Mrd. Stück miteinbezogen würden. Maßnahmen wie eine Zusatzproduktion im Ausland, selbstverständlich bei gleichen Qualitätsstandards, oder die Einrichtung von Schichtarbeit und Überstunden - alles betriebswirtschaftliche Möglichkeiten, die die Gesamtdauer deutlich verkürzen könnten - würde im öffentlichen Dienst keine Chance zur Realisation gegeben.
Was den Notendruck anbelangt, so stellt Giesecke & Devrient in München immer- hin eine privatwirtschaftliche Konkurrenz zur Berliner Notenpresse dar. Auch hier gibt es bei der aktuellen Kapazitätsgrenze von maximal 1,2 Mrd. Scheinen pro Jahr noch Spielraum nach oben, so Unternehmenssprecher. Die Produktions- erfüllung von vier Mrd. Noten wäre demnach auch in kürzerer Frist realisierbar. Die Wirtschaftswoche bemängelt die Inflexibilität der Teilnehmerstaaten und deren Produktionen, da eine Fristverkürzung, der Willen aller vorausgesetzt, sehr wohl möglich wäre.
5. Problemstellungen bei Umstellung von Automaten und Kassen
a) Umfang
Um die Größenordnung der nötigen Umstellung von beispielsweise münzbetriebenen Automaten und Kassen zu verdeutlichen, werden im Folgenden nun einige Zahlen aufgezeigt.
In Deutschland sind etwas mehr als zwei Mio. gewerbliche Automaten und ca. 800.000 von Gemeinden und Kommunen, also ungefähr drei Mio. Automaten, aufgestellt, in den übrigen zehn Teilnehmerländern nochmal etwa fünf Mio. In deutschen Unternehmen werden ungefähr eine Mio. Registierkassen benutzt, es gibt 34.000 Geldautomaten und 80.000 Terminals am Point of Sale. Auf neueren Computertastaturen gibt es inzwischen vereinzelt das Euro Symbol. Mit Einfüh- rung des Euro werden neue Münzzählgeräte ebenso benötigt wie zusätzlicher Tresorraum, Möglichkeiten zur getrennten Aufbewahrung sowie zum Transport der beiden Währungen. Die nötige Geldmenge wird sich beispielsweise in Handels- unternehmen deutlich erhöhen.
b) Alternativen
Die Betreiber all dieser Automaten und Kassen hoffen auf die weitere Verbreitung von Geld-, Kredit-, Telefonkarten und ähnlichem, um dem Problem der Neuein- stellung bzw. dem Ersetzen aus dem Weg zu gehen. Dieser Trend wird sich sicherlich weiterhin fortsetzen, doch ein Grund zur Beruhigung stellt das noch nicht dar. Von Deutschlands 30 Mio. Geldkarten werden momentan nur 5% genutzt.
c) Zeitbedarf für die Umstellung
Nach Schätzungen von Verbänden wird die Umstellung aller Automaten und Kassen in Deutschland mindestens zwei Monate in Anspruch nehmen. Paul Gauselmann, Vorsitzender des Verbands Deutscher Automatenindustrie beklagt, daß repräsentative Muster der neuen Münzen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Zwischen den Münzen der vielen Prägeanstalten in Europa, die jetzt gerade mit der Produktion beginnen, gibt es geringfügige Unterschiede, die aber nicht übersehen werden dürfen, da die national unterschiedlich gestalteten Münzen in ganz Europa verwendet werden dürfen. Verbindliche Muster aller Münzen von allen Prägeanstalten werden frühestens Ende 1999 vorhanden sein, was die Umstellungsvorbereitungen natürlich aufhält.
Die Umrüstarbeiten sind sehr zeitaufwendig, da die elektronischen Prüfer umpro- grammiert, Programme für alle Automaten produziert und dann einzeln umgestellt werden müssen. Die Lobby dieser Industrie spricht sich selbstverständlich gegen die aktuell diskutierten Fristverkürzungen zur Bargeldeinführung aus. Zugute kommt den Herstellern der Automaten und Kassen, daß die meisten von ihnen ohnehin als Exporteure tätig sind und dadurch bereits Erfahrung im Umgang mit ausländischen Währungen sammeln konnten. Bei den neueren elektronischen Prüfern ist die Umstellung auch deutlich einfacher als bei den mechanischen.
d) Kosten
Die Umstellkosten pro Automat werden vom Bundesverband der automatenbetrei- benden Industrie auf 60 bis 800 DM geschätzt, was Gesamtkosten in Deutschland von 800 Mio. DM bedeutet. Allein die Umstellung der Zigarettenautomaten wird ca. 500 Mio. DM verschlingen. Der Bundesverband der deutschen Verpflegungs- und Vending Unternehmen rechnet mit Umsatzeinbußen von 50% in den ersten 6 Wochen nach der Einführung, was Mindereinnahmen von 500 Mio. DM bedeutet.
Im Einzelhandel werden sich die Kosten pro Registrierkasse auf 400 bis 500 DM belaufen, noch ca. 75% aller im Moment benützten Kassen warten noch auf ihre Umstellung. Ähnlich der Situation bei den Automaten müssen hierbei manchmal nur die Software, bei einigen allerdings auch die Hardware adaptiert werden. Da große Unternehmen der Branche ihre Kassen normalerweise alle drei bis vier Jahre austauschen, werden sich die jährlich geplanten Ersatzinvestitionen von 750 Mio. DM durch die neue Währung um etwa 155 Mio. DM erhöhen.
e) Briefmarken
Der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel kündigte bei der Eröffnung des Hauses der Philatelie in Bonn an, daß auf Euro lautende Briefmarken erst zum Jahresbeginn 2002 eingeführt werden. Allerdings werde es keine EWWU-weit geltenden Briefmarken geben, sondern weiterhin deutsche mit einem Nennwert in Euro. Die sich ergebende Preistransparenz bei den einzelnen Postunternehmen wird diese allerdings früher oder später zur Preisharmonisierung zwingen.
6. Gesamtkostenabschätzungen der Umstellung
a) Zur Qualität der Kostenabschätzungen
Kostenabschätzungen der Umstellung werden zur Zeit vielfach veröffentlicht, sowohl von Unternehmen, wie auch von Branchenverbänden und anderen Instiutionen zur gesamtwirtschaftlichen Situation. Allerdings muß die Einschrän- kung gemacht werden, daß diese Summen lediglich zur Bestimmung der richtigen Größenordnung dienen können. Die verschiedenen Schätzungen differieren zum Teil beträchtlich voneinander, wie die Beispiele im folgenden Abschnitt zeigen werden.
Dafür lassen sich folgende Gründe erkennen: Zum einen fehlt die Erfahrung mit Projekten, die so umfassend sind und ein so großes Gebiet betreffen, was die Kalkulationen natürlich erschwert bzw. eine exakte, gesamtwirtschaftlich oder auch nur betriebliche Vorausberechnung fast unmöglich macht. Viele der bereits veröffentlichen Summen mußten später aktualisiert werden, meistens nach oben. Dazu kommt ein weiterer Beweggrund. Wie aus den vorigen Abschnitten zu entnehmen, sind noch einige Debatten aktuell im Gange und verschiedene Aspekte der Währungsumstellung nicht abschließend geklärt. Es ist in dieser Situation naheliegend, Kostenabschätzungen in die eine oder andere Richtung derart zu gestalten, daß sie auch als Argument für den Betroffenen in der jewei- ligen Debatte benutzt werden können und die Interessenlage angemessen unterstreichen. Neben diesem Lobbyismus ist zusätzlich zu beachten, daß vor allem Unternehmen die Herausgabe möglichst exakter Aufstellungen manchmal allein aus Wettbewerbsgründen vermeiden wollen.
Die folgenden Zahlen sind unter diesen Prämissen zu betrachten.
b) Gesamtwirtschaftliche Kostenabschätzungen
Eine Schätzung der Gartner Group, eine US-amerikanische Beratungsgesell- schaft, beziffert die weltweiten EDV Kosten für die Umstellung auf den Euro und im gleichen Zug die Lösung des Jahr-2000-Problems mit 600 Mrd. US $. Davon entfallen 40 bis 80 Mrd. DM auf die Bundesrepublik. Das Bonner Institut für Mittelstandsforschung (IFM) dagegen errechnet für Deutschland eine Summe von 21,5 Mrd. DM, wovon 90% auf den Mittelstand entfallen. Herr Hermann-Josef Lamberti, ehemaliger Geschäftsführer von IBM Deutschland kommt auf einen Betrag von 30 bis 40 Mrd. DM. Die Europäische Kommission, deren Schätzung aufgrund ihrer Position etwas zurückhaltender ausfällt, nennt als Richtwert für jedes Teilnehmerland 0,25% des jeweiligen Bruttosozialprodukts und für Deutsch- land 12 Mrd. DM.
Alleine die Bargeld Umstellkosten werden sich wie bereits angesprochen auf etwa 600 Mio DM summieren.
Der Einzelhandelsverband rechnet für die existierenden 425.000 Einzelhändler schon mit etwa 32 Mrd. DM, wenn die Doppelwährungsphase tatsächlich sechs Monate dauern wird.
Die Bankvereinigung beziffert den Aufwand für das Kreditgewerbe mit 19 Mrd. DM, während die HypoVereinsbank lediglich auf 10 Mrd. DM Kosten für ganz Deutschland kommt.
Klar ist, daß die Umstellung vor allem für Banken, Versicherungen, die Telekom und die Post sehr kostspielig wird. Die Deutsche Bank plant unternehmensinterne Aufwendungen von 350 Mio. DM.
Laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG rechnen Europas größte Unter- nehmen inzwischen mit Gesamtkosten von umgerechnet gut 140 Milliarden Mark. Das seien knapp 70 Prozent mehr, als bei der Schätzung 1997 angegeben worden sein.
Generell kann man folgenden Rahmen abstecken. Große Unternehmen im Finanzsektor müssen mit dreistelligen Millionenbeträgen rechnen, außerhalb dieser Branche tendenziell mit zweistelligen Millionensummen.
Kommunen dagegen können eher aufatmen. Neuere Berechnungen korrigieren die alten Ergebnisse nach unten. Eine Stadt wie Chemnitz wird beispielsweise ca. 300.000 DM aufwenden müssen, um euro-fit zu werden, was im Rahmen des Haushaltes noch aufzubringen ist.
c) Überleitung zu III. Unternehmensbezogene Untersuchung
Wie leicht zu erkennen ist, kann man diese Schätzungen wohl kaum als exakt bezeichnen, doch dienen sie mit Sicherheit dazu, ein Vorstellung der Größenordnung zu geben, in der die wirklichen Kosten, die teilweise wohl auch im Nachhinein nie bestimmt werden können, liegen werden.
Genauer als die gesamtwirtschaftlichen Schätzungen sind die Kalkulationen von Unternehmen, auf die im zweiten Teil der Arbeit noch näher eingegangen wird.
IV. LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
Brückner, Michael: Der Euro - Was Sie bei der Währungsumstellung wissen und tun müssen, Falken Taschenbuch, Niedernhausen, Taunus, 1998
Cohn-Bendit, Daniel und Duhamel, Olivier: Euro für alle, Dumont, Köln, 1998
Europäisches Parlament in Zusammenarbeit mit DIHT (Hrsg): Ratgeber Euro, Bonn,1997
Islinger, Robert: Ratgeber Euro, Mosaik, München, 1998
Jungblut, Michael: Wenn der Euro rollt..., Ueberreuter, Wien, 1996
Mittendorfer, Roland und Hörhan, Gerald B.: Was kommt nach dem Euro?, Ueberreuter, Wien, 1998
Müller, Henrik: Kursbuch Euro, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1997
Rieß, Stefan: Euro - 100 Fakten, die Ihr Geld retten, Heyne, München, 1997
Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln: Nr. 4, 20.01.1999, S. 13 und Nr. 55 Jg. 1998, S. 12
Horizont - Zeitung für Marketing, Werbung und Medien: Nr. 23, 04.06.1998, S. 22
Spiegel Nr.18, 27.04.1998, S. 100ff. Feiern für den Euro und S. 114ff. Der schwere Abschied
Wirschafttswoche Nr. 3, 14.01.1999, S. 26 Technisch machbar
Internetlinks:
www.eic.de
www.euro-aktuell.de www.bundesbank.de www.deutsche-bank.de
www.europa.eu.int und weitere EU Sites www.ispo.cec.be/y2keuro
[...]
Häufig gestellte Fragen zum "Inhaltsverzeichnis"
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die einen Titel, ein Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es dient der akademischen Analyse von Themen.
Was ist die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)?
Die EWWU ist eine Wirtschaftsunion, deren dritte Phase am 1. Januar 1999 mit der Einführung des Euro als Buchgeld begann.
Welche Länder nahmen anfänglich an der Währungsunion teil?
Die ursprünglichen elf Teilnehmerstaaten waren Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Spanien, Portugal, Irland und Finnland.
Wie wurden die Umrechnungskurse zwischen dem Euro und den nationalen Währungen festgelegt?
Der ECOFIN-Rat legte am 2. Mai 1998 die bilateralen Wechselkurse der einzelnen Teilnehmerländer fest. Die endgültigen und unwiderruflichen Kurse wurden am 1. Januar 1999 festgelegt, nachdem der ECU (European Currency Unit) bereinigt wurde.
Was ist das Prinzip der rechtlichen Kontinuität der Verträge im Zusammenhang mit der Euro-Einführung?
Dieses Prinzip (VO 1103/97 EG) besagt, dass die Inhalte von Verträgen auch nach der Umstellung auf den Euro weiterhin gültig bleiben. Insbesondere gilt dies für Zinssätze, Ablaufdaten und andere Bestimmungen.
Was ist das Prinzip des rekurrenten Anschlusses?
Das Prinzip des rekurrenten Anschlusses (VO 974/98) besagt, dass alle Forderungen und Verbindlichkeiten auch über den 01.01.1999 hinaus Bestand haben. Bestehende geschäftliche Beziehungen werden automatisch zum 01.01.2002 auf den Euro umgestellt, sofern dies nicht bereits früher geschehen ist.
Was bedeutet das Prinzip der Erfüllung in der vereinbarten Vertragswährung?
Während des Übergangszeitraums sind alle vertraglichen Vereinbarungen in der vereinbarten Währung zu erfüllen, es sei denn, die Vertragspartner einigen sich auf andere Regelungen.
Welche Umrechnungs- und Rundungsbestimmungen galten bei der Euro-Einführung?
Es wurden spezifische Richtlinien für die Umrechnung von Euro in nationale Währungen und umgekehrt festgelegt. Krumme Beträge müssen gerundet werden, und die Umrechnungskurse durften nie gerundet werden. Inverse Kurse waren verboten, da sie zu Ungenauigkeiten führten.
Was ist das Rückkonvertierungsproblem?
Das Rückkonvertierungsproblem beschreibt die Differenzen, die beim Umrechnen von einer nationalen Währung in Euro und anschließend wieder zurück in die nationale Währung entstehen können.
Was ist das Geringwertigkeitsproblem?
Das Geringwertigkeitsproblem umfasst die Tatsache, dass die kleinste Einheit des Euro 1 Cent ist (fast das Doppelte eines Pfennigs) und dass Rundungsdifferenzen prozentual größer sind, wenn kleinere Beträge umgerechnet werden.
Wie sahen die neuen Euro-Banknoten und -Münzen aus?
Die Banknoten gab es in den Stückelungen 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. Die Münzen gab es als 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro. Die Vorderseiten der Münzen waren einheitlich, die Rückseiten wurden national gestaltet.
Was versteht man unter "Frontloading"?
Frontloading bezeichnet die vorgezogene Ausgabe von Euro-Bargeld vor dem 1. Januar 2002, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Welche Probleme gab es bei der Umstellung von Automaten und Kassen?
Es gab Bedenken hinsichtlich der Umstellung von Millionen von Automaten und Kassen in kurzer Zeit, insbesondere aufgrund der Verfügbarkeit von Mustern der neuen Münzen und des Zeitbedarfs für die Umrüstung.
Wie hoch wurden die Gesamtkosten der Umstellung geschätzt?
Die Kostenschätzungen für die Umstellung variierten stark, von einigen Milliarden bis zu Hunderten von Milliarden D-Mark, je nach Quelle und berücksichtigten Faktoren.
- Arbeit zitieren
- Tobias Bachteler (Autor:in), 1999, Die Technik der Währungsumstellung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95314