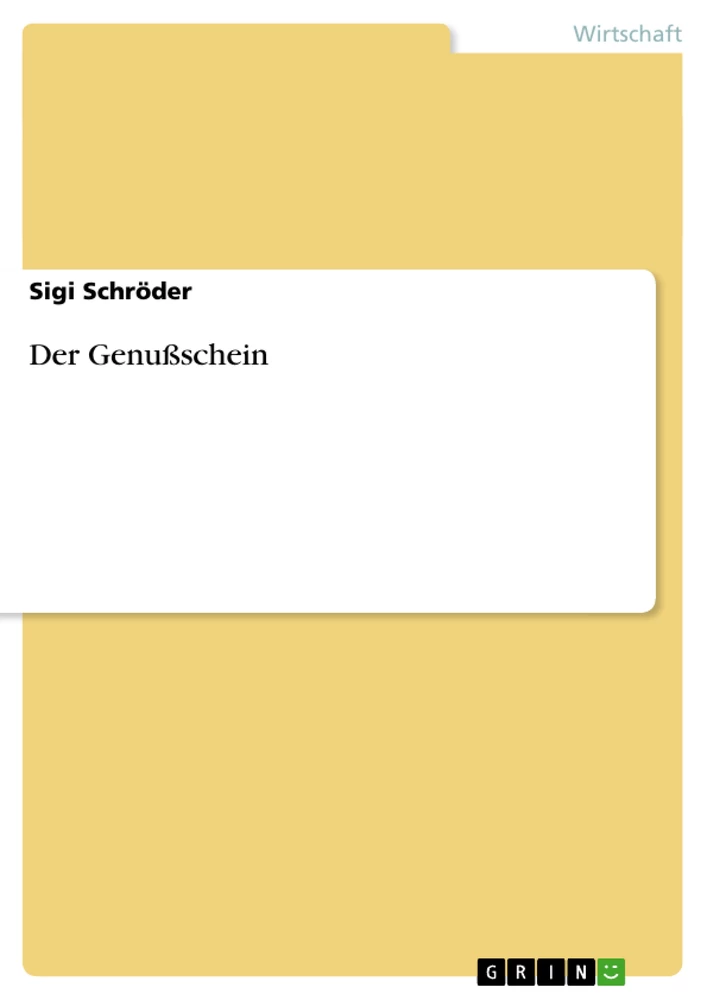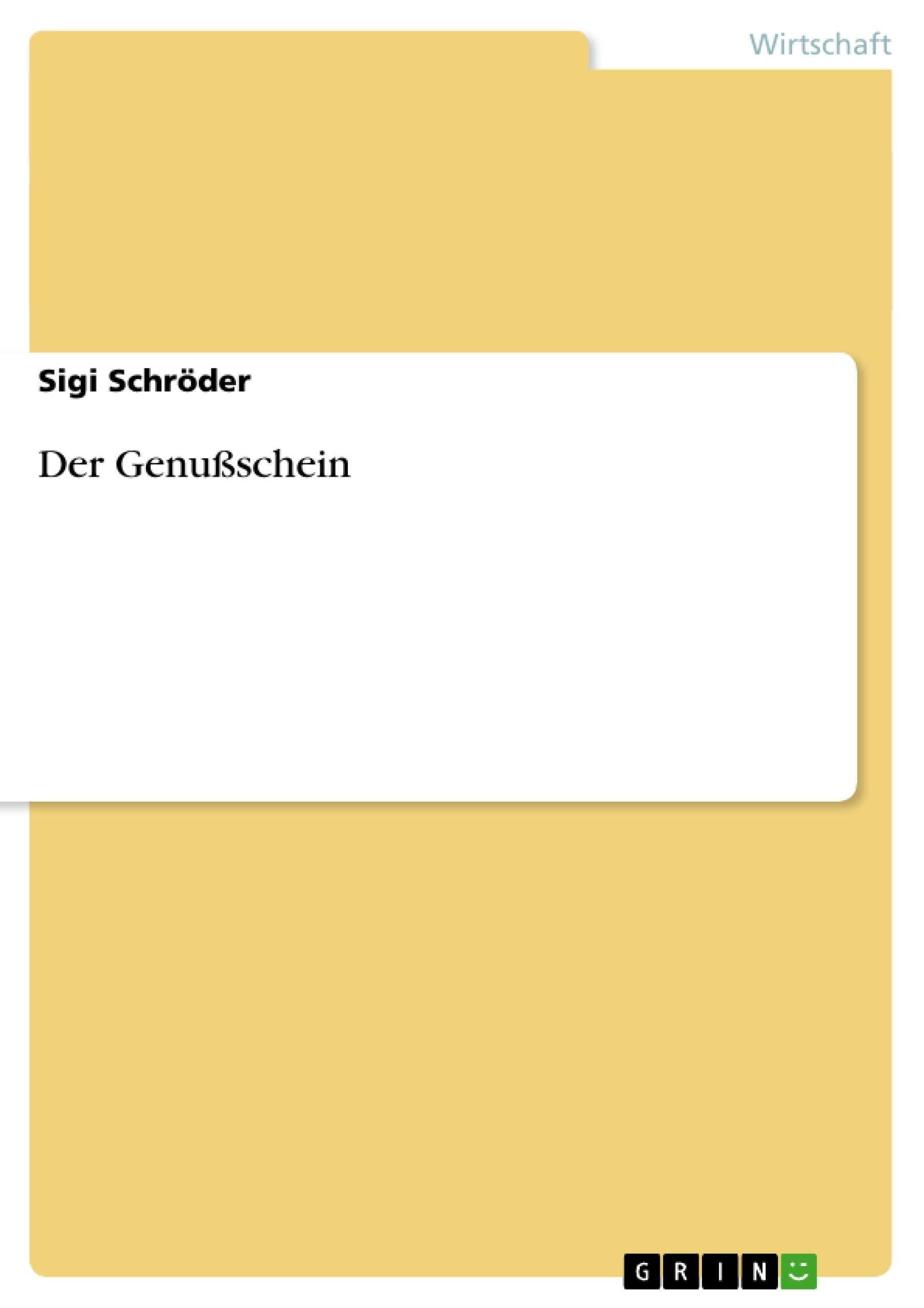Inhaltsübersicht:
1. Einführung
1.1 Historischer Ursprung des Genußscheins
1.2 Wiederentdeckung des Genußscheins Mitte der 80er Jahre
2. Die Begünstigung des Genußscheins durch die Novelle des Kreditwesengesetz von 1985
2.1 Die Rolle des haftenden Eigenkapitals für Kreditinstitute
2.2 Der Genußschein im Kreditwesengesetz -ein Beispiel für seine mögliche Ausgestaltung
3. Die Emission von Genußscheinen und deren formale Rechtsnatur
3.1 Emissionsformen bei Genußscheinen
3.2 Genußrechte -Mitgliedschafts- oder Gläubigerrechte
3.3 Steuerrechtliche Aspekte der Genußscheine
4. Arten von Genußscheinen -eine systematische Übersicht ihrer inhaltlichen Rechtsnatur
4.1 Der Anspruch auf Vergütung der Kapitalüberlassung und seine Ausprägungen
4.2 Der Anspruch auf Kapitalrückzahlung
4.2.1 Der Anspruch auf Rückzahlung vor Liquidation
4.2.1.1 Anknüpfungstatbestände für Gewinn- und Verlustgrößen
4.2.2 Der Anspruch auf Rückzahlung bei Liquidation
4.4 Immaterielle Rechte der Genußscheine
5. Fazit
1. EINFÜHRUNG
1.1 Historischer Ursprung des Genußscheins
Genußscheine existieren bereits seit weit mehr als einhundert Jahren. Als der erste Genußschein gilt der im Dezember des Jahres 1858 in Frankreich ausgegebene Gründergenußschein des Suez-Kanals. Die Anzahl dieser Emission betrug damals gerade 100 Stück.
Historisch waren Genußscheine als Abfindungen für Aktionäre bei zeitlich limitierten Konzessionsgesellschaften, im Falle von Sanierungen, Fusionen oder Abwicklungen von Gesellschaften gedacht, wenn zwar nicht feststand, aber damit gerechnet wurde, daß noch künftige Erträge anfallen würden. Den Aktionären wurde das Mitgliedsrecht entzogen und die Nennwerte ihrer Aktien bereits vor Auflösung der Gesellschaft zurückerstattet zuzüglich eines Scheins, der dem Inhaber die Teilhabe an weiteren Gewinnen sicherstellte; der Genußschein war geboren, ein Wertpapier das damals nur "Genuß", weil lediglich Gewinnanteil und keinen Verlustanteil erbrachte. Dies hat sich im Laufe der Zeit dahingehend geändert, daß Genußscheine durchaus auch in den "Genuß" von Verlustanteilen kommen können.
Während -zumindest in Deutschland- der Name Genußschein beibehalten wurde, wird in der Schweiz der neutralere und somit präzisere Name "Partizipationsschein" verwendet, der eben auf jenen Umstand der gewinn- wie verlustbringenden Teilhabe abstellt.
Einen Höhepunkt erlebte der Genußschein als Fremdfinanzierungsinstrument in den Inflationszeiten der 20er Jahre. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, daß Gewinnanteile einer Gesellschaft nicht an den fixen Nominalbetrag einer Währung gebunden sind und daher sowohl dem Nutzungsentgelt für die Überlassung des Genußrechtskapitals als auch dem Rückzahlungsbetrag gegebenenfalls die Wirkung einer Indexierung beikommt.
1.2 Wiederentdeckung des Genußscheins Mitte der 80er Jahre
Danach geriet der Genußschein zunehmend in die Bedeutungslosigkeit. Als ein Grund hierfür mag das Aufkommen der stimmrechtslosen Vorzugsaktie als Konkurrenzinstrument zu nennen sein. Inwieweit diese dem Genußschein Konkurrenz zu machen in der Lage ist soll noch ausgeführt werden.
Erst durch die Novelle zum Kreditwesengesetz von 1985 erlebte das Genußrechtskapital seine Renaissance. Von 4 börsennotierten Genußscheinen von Industrieunternehmen im Gesamtmarktwert von 400 Mio DM im Jahre 1984 stieg die Zahl der Emittenten bis Ende 1987 auf 23. Der Gesamtmarktwert verzehnfachte sich auf über 4 Mrd. DM. Verstärkt traten Kreditinstitute als Emittenten von Genußscheinen in Erscheinung. Ihr Anteil am Volumen des Genußsscheinmarktes betrug 2,3 Mrd. DM, verteilt auf nicht weniger als 12 Emittenten. Die Bedeutung der KWG-Novelle für Kreditinstitute soll im Folgenden erläutert werden.
2. DIE BEGÜNSTIGUNG DES GENUßSCHEINS DURCH DIE NOVELLE DES KREDITWESENGESETZES VON 1985
2.1 Die Rolle des haftenden Eigenkapitals für Kreditinstitute
Zum Verständnis der Bedeutung dieser Gesetzesänderung für die Attraktivität der Genußrechtsemissionen von seiten der Banken ist es wichtig, zunächst die Bedeutung des haftenden Eigenkapitals aufzuzeigen. Das Aktivgeschäft eines Kreditinstitutes hängt nämlich vom zur Verfügung stehenden Eigenkapital ab. Die Höhe dessen bestimmt, in welchem Ausmaß Sicherheiten für die eingegangenen Verbindlichkeiten -also die Einlagen der Sparer- zur Verfügung stehen. Nur im Rahmen dieser Sicherheiten dürfen Spareinlagen entgegengenommen und in Form des Aktivgeschäftes als Kredite auch wieder ausgegeben werden. Dem Schutz der Einleger verpflichtet, überprüft die Bankenaufsicht gemäß § 10 (1) KWG dies regelmäßig.
Die Änderung des Kreditwesengesetzes von 1985 beinhaltet nun die Aufnahme des Genußkapitals in den Katalog des bankenrechtlich haftenden Eigenkapitals. Dies bedeutet konkret, daß Kreditinstitute erstmals durch die Emission von Genußscheinen ihr Eigenkapital aufstocken konnten. Allerdings war dies an gewisse Voraussetzungen gebunden. So mußten die emittierten Genußscheine insgesamt sechs Ausstattungsmerkmale aufweisen, um den Anforderungen des Kreditwesengesetzes zu entsprechen.
Allein diese Formulierung gibt bereits einen entscheidenden Hinweis über das Wesen der Genußscheine: nämlich daß es den Genußschein schlechthin gar nicht gibt. So findet sich denn auch tatsächlich keine gesetzmäßige Definition über das, was unter dem Begriff "Genußschein" auftritt bzw. auftreten kann. Die Bedingungen eines jeden Genußschein können also individuell gestaltet werden. Über ihre gängigsten Ausprägungen aber später mehr. In verschiedenen Gesetzen (neben dem KWG auch das EStG und das KStG) wird allerdings auf Genußscheine Bezug genommen. Einiges Wichtige davon soll hier beispielhaft behandelt werden.
2.2 Der Genußschein im Kreditwesengesetz -ein Beispiel für seine mögliche Ausgestaltung-
Zurück zum Kreditwesengesetz und dessen Auflagen, wie sie im § 10 (5) dargelegt sind. Sie verdienen eingehendere Betrachtung, weil hier eine Form der Genußscheinbedingungen festgelegt ist, welche durch die Vielzahl der von Banken vorgenommenen Emissionen so oder in ähnlicher Weise in der Praxis relativ häufig anzutreffen sein wird. Ein Blick auf den aktuellen Kurszettel der FAZ belegt das deutliche Übergewicht der von Kreditinstituten emittierten Scheine gegenüber denen der Industrieunternehmen.
Demnach sind Genußrechtsverbindlichkeiten genau dann dem haftenden Eigenkapital zuzurechnen wenn sie
1. "bis zur vollen Höhe am Verlust teilnehmen und im Verlustfalle Zinszahlungen aufgeschoben werden können." So der Wortlaut des Gesetzes. Bei Emission eines Genußscheines stellen die Zeichner desselben der emittierenden Unternehmung / dem Kreditinstitut also einen Nominalbetrag zur Verfügung, für welchen im Gegensatz zur klassischen Anleihe kein vertraglicher Rückzahlungsanspruch besteht. Das Nutzungsentgelt für die Kapitalüberlassung kann in Form von Zinszahlungen gegeben sein, auf die aber -hinsichtlich ihrer Fälligkeit- ebensowenig ein Rechtsanspruch besteht. Welche anderen Möglichkeiten existent werden können, sowie die Definition des Verlustbegriffes werden noch im Folgenden zu behandeln sein.
2. Es muß vereinbart sein, daß das Genußrechtskapital im Konkursfalle oder bei Liquidation des Instituts erst nachrangig bedient wird. Der Genußscheininhaber findet sich also in einer Art Gläubigerposition wieder, die aber eine ähnlich schwache wie die des Eigenkapitalgebers darstellt; erst nach Bedienung aller übrigen Gläubiger erhält der Genußrechtsgläubiger einen (wenn überhaupt noch vorhandenen) Anteil an der Konkursmasse.
3. Das Genußkapital muß dem Kreditinstitut für insgesamt mindestens fünf Jahre zur Verfügung gestellt worden sein und
4. auch nicht vor Ablauf von zwei Jahren fällig werden oder aufgrund des Vertrages fällig werden können. Hier zeigt sich wieder, daß der Genußschein der klassischen Form von Eigenkapital doch nicht ganz entspricht, bzw. entsprechen muß. Eigenkapital steht dem Unternehmen in der Regel nämlich unbegrenzt zur Verfügung, eine Vielzahl von Genußscheinen ist hingegen von vornherein in der Laufzeit begrenzt bzw. mit einem Kündigungsrecht sowohl des Emittenten wie auch (eher seltener) des Gläubigers ausgestattet.
5. Schließlich erläßt das Kreditwesengesetz die Auflage, daß der Vertrag über die Überlassung von Genußkapital keine sogenannten Besserungsabreden enthalten darf, durch welche dem Gläubiger eine Wiederauffüllung seines durch Verluste geschmälerten Rückzahlungsanspruchs durch Gewinne zugesichert wird, die nach mehr als vier Jahren nach Fälligkeit dieses Rückzahlungsanspruches anfallen. Wichtig zu bemerken ist hier, daß der Genußschein also nicht nur in seiner Verzinsung bzw. dem Kapitalüberlassungsentgelt (um den an Anleihen erinnernden Begriff zu umgehen) vom Gewinn des Emittenten abhängig ist, sondern auch die Tilgungshöhe keineswegs festgeschrieben sein muß. Es ist auch nicht vonnöten, daß der Emittent insolvent wird, so daß die Rückzahlung gänzlich ausfallen müßte, sondern schon durch laufende Verluste kann diese belastet werden.
Der 6. Anforderungspunkt besagt weiterhin noch, daß die potentiellen Zeichner der Genußscheine bei Vertragsabschluß ausdrücklich und schriftlich darüber zu informieren sind, daß weder die Verlustteilnahme nachträglich zum Nachteil des Emittenten (hier: des Kreditinstituts) geändert, die nachrangige Bedienung im Liquidationsfalle beschränkt, noch Laufzeiten oder Kündigungsfristen verkürzt werden dürfen. Auch kann sich das Institut einen vorzeitigen Rückerwerb vertraglich vorbehalten.
Folgerung aus dieser Darstellung: Genußkapital ist also hinsichtlich seiner Risikobeteiligung in einer Vielzahl von Fällen dem haftenden Eigenkapital gleichzusetzen.
Wie schon oben erwähnt, stellen die hier aufgezeigten Ausstattungsmerkmale nicht den Prototyp des Genußscheins dar, sondern lediglich eine Möglichkeit der Ausgestaltung, die aber auch unter Berücksichtigung des noch zu untersuchenden § 8 (3) Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes als gängig bezeichnet werden dürfte.
3. DIE EMISSION VON GENUßSCHEINEN UND DEREN FORMALE RECHTSNATUR
Nachdem im vorangegangenen Abschnitt anhand der Genußscheine der Kreditinstitute ein erstes Beispiel für diese seit Mitte der 80er Jahre wieder relativ attraktive Kapitalbeschaffungsmaßnahme (zumindest aus Sicht des Emittenten) gegeben wurde, sollen an dieser Stelle die für die Emission dieser Wertpapiere relevanten Charakteristika und daraus Folgerungen über ihren formalen Rechtscharakter, also die Art und Weise der Gestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen Emittent und Erwerber wie es im Emissionszeitpunkt begründet wird, aufgezeigt werden, bevor sich im folgenden Kapitel eine systematische Übersicht über mögliche Klassifikationen und damit den inhaltlichen Rechtscharakter von Genußscheinen anschließt.
3.1 Emissionsformen bei Genußscheinen
Als Anlaß einer Emission von Genußscheinen ist in erster Linie die Beschaffung von Kapital zu nennen. Der Ersterwerber des Genußscheins leistet eine Einzahlung und erhält dafür als Gegenleistung das wie auch immer gestaltete Genußrecht. Genußrechte können aber auch als Entgelte für nicht quantifizierbare und nicht-monetäre Leistungen gewährt werden. Die Einbringung von Patenten, Erfindungen, Konzessionen, Lizenzen oder know-how wird hier angeführt. Im Gegenzug können Genußscheine auch nicht- monetäre Ansprüche beinhalten, wie zum Beispiel das Recht, Einrichtungen des Emittenten zu nutzen.
Ferner besteht die Möglichkeit, Genußscheine als Mitarbeiterbeteiligungen auszugeben. Das Vermögensbildungsgesetz bezieht Genußscheine mit ein, das Einkommensteuergesetz erwähnt sie im § 19a (3) 3. EStG ausdrücklich als Form der Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmern.
Zum besseren Verständnis ist es von Bedeutung die Begriffe "Genußschein" und "Genußrecht" zu unterscheiden. Genußrechte sind vertraglich abgeleitete Ansprüche des Genußberechtigten gegen den aus der Genußrechtsverbindlichkeit Verpflichteten. Erst wenn diese Rechte in einer selbständigen Urkunde verbrieft werden spricht man von einem Genußschein. Im Laufe der Zeit ist insbesondere in Steuerrechtsvorschriften der Begriff "Genußschein" durch den Begriff "Genußrecht" ersetzt worden, um zu verdeutlichen, daß die steuerliche Relevanz von Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Genußrechten nicht von der Verbriefung abhängt. Da für die Entstehung der Genußrechte ihre Verbriefung unerheblich ist, hat der Genußschein nur deklaratorischen Charakter. Gesetzliche Vorschriften über die Form des Genußscheins finden sich ebensowenig wie über die Art und Inhalte der Genußrechte. Allerdings kann vereinbart werden, daß zur Geltendmachung der Genußrechte die Innehabung des Genußscheins -sofern denn ein solcher ausgestellt wurde- erforderlich ist. Ist dies der Fall, dann wird der Genußschein von der reinen Beweissicherungsurkunde zum Wertpapier. Als solches kann er nun hinsichtlich der Art, in der die Person des Berechtigten aus dem Genußschein bestimmt wird, unterschieden werden: Beim Inhaberpapier ist derjenige der Berechtigte, der Eigentümer der Urkunde, bzw. des Genußscheins ist. Ist der Genußschein als Orderpapier emittiert, so wird durch die Klausel "für mich an Order von " der jeweils Berechtigte definiert. Der Genußschein kann auch den Berechtigten namentlich festlegen, so daß es sich um ein sogenanntes Rektapapier handelt.
Genußrechte sind nur in seltenen Fällen individuell ausgehandelte Verträge. Meist bestimmt der Emittent einseitig den Inhalt für eine ganze Tranche von Genußscheinen. Dies ist auch eine Voraussetzung für eine Teilnahme am Börsenhandel. Erfüllen die von einer Unternehmung emittierten Genußscheine nämlich die Wertpapiereigenschaft und ist darüber hinaus jeder Genußschein mit den gleichen Rechten versehen, so handelt es sich bei diesen Stücken um Effekten, welche lediglich nach Stückzahl, Betrag und Gattung, also ohne Ansehung des Stückes selber, handelbar sind. Allenfalls solche Genußscheine, die die Effekteneigenschaft aufweisen, kommen für einen Börsenhandel in Betracht. Genußscheine, die Inhaberpapiere sind, können nach den Anforderungen des § 36 Börsengesetz zum amtlichen Handel, gemäß § 73 (1) BörsG zum geregelten Markt zugelassen werden. Ersteres kommt aufgrund der strengen Zulassungsvoraussetzungen natürlich nur für die großen Aktiengesellschaften in Frage. In diesen Fällen werden die Genußscheine auch meist auf direktem Wege, also ohne Zwischenschaltung einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft emittiert. Die Genußscheine werden dem anlagesuchenden Publikum unmittelbar zur Zeichnung angeboten. Von der indirekten Inanspruchnahme des organisierten Kapitalmarktes spricht man hingegen dann, wenn eine der erwähnten Kapitalbeteiligungsgesellschaften die Genußscheine zeichnet, die sich ihrerseits über den Kapitalmarkt mit Risikokapital refinanziert. Der Weg über die Beteiligungsgesellschaft, die hier als Sammelstelle für Risikokapital fungiert, kommt für solche Unternehmen in Frage, denen der direkte Weg an den Kapitalmarkt aufgrund eines zu geringen Emissionsvolumens versperrt bleibt.
Als spezielle Formen von Genußscheinen, die Wertpapiere darstellen, werden die Gewinnschuldverschreibung und die Wandelschuldverschreibung genannt.
Die Gewinnschuldverschreibung -auch als Gewinnobligation bezeichnet- gewährt dem Inhaber das Recht auf ein erfolgsabhängiges Nutzungsentgelt für seine Kapitalüberlassung. Dieses ist an eine Dividendenausschüttung gekoppelt und kann sowohl mit einem festen Basiszins, als auch einer vollständigen Gewinnabhägigkeit ausgestattet sein. Diese partielle oder totale Gewinnabhängigkeit ist ausschlaggebend dafür, daß eine Anlehnung an den Genußschein allgemein angenommen wird.
Die Wandelschuldverschreibung ermöglicht den potentiellen Zeichnern innerhalb einer bestimmten Frist unter Aufgabe der Schuldverschreibung Aktien des Emittenten zu erwerben. Je nach rechtlicher Stellung der Gläubiger ist der Unterschied zwischen einer Wandelschuldverschreibung und einem sogenannten Wandelgenußschein nicht immer deutlich. Sicherlich ist nicht jede Wandelschuldverschreibung zu Recht unter den Genußschein zu subsumieren, da sie allein aufgrund der Wahlmöglichkeit des Inhabers die Wandlung vorzunehmen oder zu unterlassen noch klare "Fremdkapitalrechte" beinhalten kann. Dennoch wird die Wandelschuldverschreibung im Zusammenhang mit Genußscheinen aufgeführt und soll auch hier daher nicht unerwähnt bleiben. Die Nähe zum Genußschein kann durch die Tatsache begründet werden, daß Wandelschuldverschreibungen ihren finanziellen Anreiz eben aus dem Erwerb eines Anspruchs auf Risikokapital, sprich Aktien des Emittenten, anstelle von festgelegten Tilgungsleistungen beziehen, aber in der Phase vor der Wandlung noch Fremdkapital sind und ebenso wie der Genußschein keine Einflußmöglichkeiten gewähren.
Zu unterscheiden ist ferner, ob der Genußschein als Nominalpapier oder Quotenpapier emittiert werden soll. Genußscheine, die auf einen Nennwert lauten werden als Nominalpapiere bezeichnet. Ein Nennwert kann beim Genußschein folgende Funktionen haben: Er kann einerseits die von den Inhabern zu erbringende Leistung kennzeichnen, also die "Einlage", gegen welche der Inhaber das Genußrecht erwirbt, sofern diese monetär quantifizierbar ist, aber auch einen Rückzahlungsanspruch wertmäßig ausdrücken und als Berechnungsgrundlage für eventuelle Minderungen dieses Wertes dienen. Lautet ein Genußschein hingegen auf einen prozentualen Anteil am jährlichen Gewinn, am Liquidationsüberschuß oder bei Aktiengesellschaften auf ein Vielfaches der Aktiendividende, so handelt es sich um ein Quotenpapier. Dieses bietet sich dann an, wenn die Einlage der Genußberechtigten, für die das Genußrecht gewährt wird, immaterieller Art oder schwer bestimmbar ist. Als Beispiel für eine solche Einlage wird die Einbringung von Patenten in das Unternehmen bezeichnet.
Als ein weiteres wichtiges Merkmal bezüglich der Emission des Genußscheins ist die rechtsformunabhängige Emission zu nennen. Im Gegensatz zur klassischen Aufnahme von Risikokapital durch die Beteiligungsform der Aktie, welche den Aktiengesellschaften vorbehalten bleibt, können auch kleinere und mittelständische Kapital- wie Personengesellschaften, ebenso wie öffentlich-rechtliche Anstalten, insbesondere die schon erwähnten Kreditinstitute, den Genußschein nutzen. Es ist auch darauf hinzuweisen, daß Genußscheine nicht notwendigerweise börsennotiert sein müssen und in vielen Fällen auch nicht sein können, da ihnen die oben erläuterte Eigenschaft der Effekten fehlt. Die Rechtsform des Emittenten allein sagt aber noch nichts über die Möglichkeit einer Börsennotierung aus. Auch nicht- börsenfähigen Emittenten wie z.B. GmbHs (für deren Anteile ja bekanntlich kein organisierter Markt existiert) ist es möglich, Genußscheine an der Börse zu handeln, so geschehen durch die Alldephi GmbH, Tochterunternehmen der niederländischen Philips, im Jahre 1989.
Die Voraussetzungen für eine Emission sind demgemäß auch nur bei der Aktiengesellschaft im Aktiengesetz -und zwar durch den § 221 (3) AktG- geregelt. So müssen einer Genußscheinemission mindestens 3/4 des vertretenen Grundkapitals im Rahmen der Hauptversammlung zustimmen, um diese wirksam zu beschließen. Sind mehrere Gattungen von Aktien vorhanden, so bedarf der Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Aktionäre jeder Gattung. Den Aktionären muß gemäß der §§ 221 (4) und 186 AktG ein Bezugsrecht auf den Erwerb der Genußscheine eingeräumt werden.
3.2 Genußrechte --Mitgliedschafts- oder Gläubigerrechte ?
Bei diesem Bezugsrecht handelt es sich lediglich um ein Instrument zur Verhinderung der Kapitalverwässerung, nicht jedoch zum Erhalt eines bestimmten Stimmrechtsanteil, denn Genußscheine haben ihrer Natur nach kein Mitspracherecht. Die Aktionärsrechte können aber durch die Emission von Genußscheinen dahingehend beeinflußt werden, daß den Genußrechtsgläubigern Anteile am Liquidationsüberschuß zugestanden werden und somit ein zusätzlicher Anspruch auf ein und dieselbe Vermögensmasse zu Lasten des Aktienkapitals geschaffen wird. Wird in Genußscheinen das Recht auf Wandelung in Aktien verbrieft, so ist das Bezugsrecht ohnehin obligatorisch.
Der weit gefaßte Gestaltungsspielraum, in dem sich die Genußscheine bewegen, hat dennoch dazu geführt, daß sich in Rechtslehre, Rechtsprechung und Wirtschaftspraxis eine dahingehend feste Begriffsbestimmung herausgebildet hat, daß Genußscheine als schuldrechtliche Ansprüche gegen eine Unternehmung qualifiziert werden. Der Definition als "haftendes Eigenkapital" zum Trotz verbriefen Genußscheine -wie im 2. Abschnitt unter der Analyse des 2. Absatzes des § 10 (5) KWG bereits dargelegt- ihrer Rechtsnatur nach Gläubigerrechte. Diese heute vorherrschende Meinung wurde teilweise angezweifelt und kontrovers diskutiert. Man sah den Tatbestand eines Beteiligungsrechtes erfüllt, genau dann, wenn Genußscheine kein Forderungsrecht auf einen festen Geldbetrag beinhalteten, sondern weil sie vielmehr eine Beteiligung am Jahresgewinn und Liquidationsüberschuß vermittelten. Dieser Ansicht wurde jedoch generell nicht gefolgt. Die Tatsache, daß Genußrechte keine Mitgliedschaftsrechte sind ist nach herrschender Meinung unbestritten. Eine Mitgliedschaft entsteht nämlich nur durch den Erwerb von Anteilen des Gesellschaftsvermögens, insbesondere ist hierzu bei Kapitalgesellschaften eine Einlage auf das gezeichnete Kapital erforderlich.
Da dies bei den Genußrechten nicht der Fall ist, sie aber einen Leistungsanspruch gegen eine Unternehmung beinhalten, welcher seinerseits nur aus einem Mitgliedschaftsrecht oder einem Gläubigerrecht hergeleitet werden kann, muß man den Genußschein folglich unter letzteres subsumieren. Es liegt dementsprechend auch kein Gesellschaftsvertrag zwischen Emittent und erstem Erwerber der Genußscheine vor, wie dies bei der Mitunternehmerschaft der Fall ist, da ein gemeinsamer Zweck, den beide Parteien verfolgen, nicht vorliegt. Die Rechtsbeziehung zwischen der Unternehmung und dem Genußscheininhaber ist lediglich auf einen Leistungsaustausch ausgerichtet. Das Interesse der Unternehmung besteht darin, gegen die Entrichtung einer Vergütung Kapital (oder auch eine andere Leistung) zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das Interesse des Genußscheininhabers bezieht sich darauf, für die Kapitalüberlassung eine Vergütung zu erhalten.
Bei diesen Gläubigerrechten handelt es sich um Ansprüche, die typischerweise als Vermögensrechte eines Gesellschafters bezeichnet werden. Beispiele hierfür wären:
-Recht auf Anteil am Gewinn
-Recht auf Anteil am Liquidationsüberschuß
-Sonstige Rechte, wie z.B.: -Bezugsrechte
-Umtauschrechte
-Auslosungsrechte
-Benutzungsrechte
also solche, die auf materielle Ansprüche abzielen, im Gegensatz zu Verwaltungsrechten, die die Genußrechte nicht enthalten dürfen. Inhaber von Genußrechten können somit nicht in das Innenverhältnis einer Gesellschaft eingreifen, Genußrechte sind keine Stimmrechte oder Leitungsrechte. Dem steht allerdings nicht entgegen, daß den Genußberechtigten Informations- und Kontrollrechte auf vertraglicher Basis eingeräumt werden können.
Ein Vergleich des Genußscheins mit der kumulativen Vorzugsaktie mag das Problem der fehlenden Mitgliedschaftsrechte verdeutlichen: Der kumulativen Vorzugsaktie sind nämlich die Mitgliedschaftsrechte in Form der Stimmrechte auch vorenthalten, diese können aber im Gegensatz zum Genußschein dann aufleben, wenn in einem Jahr die Dividendenzahlung ganz oder teilweise ausgefallen ist und auch im folgenden Jahr keine oder nur teilweise Dividendenzahlungen erfolgen, die nicht für die Nachzahlung der Ausfälle ausreichen. Der Vorzugsaktionär ist demgemäß besser gestellt als der Genußrechtsgläubiger, welcher bei Zahlungsausfällen keine Möglichkeit hat seine Position innerhalb der Unternehmenspolitik wirksam zu vertreten. Die stimmrechtslose Vorzugsaktie kann insoweit als Konkurrenzprodukt zum Genußschein betrachtet werden.
Die Emission von Genußrechten begründet also Gläubigerrechte. Diese entstehen durch einen schuldrechtlichen Vertrag zwischen der ausgebenden Unternehmung und dem ersten Erwerber, dem Zeichner der Genußscheine. Dieser Vertrag ist dadurch gekennzeichnet, daß die durch ihn fixierten Bedingungen (Genußscheinbedingungen) eine dauernde Rechtsbeziehung zwischen dem Genußberechtigten und der Unternehmung anstreben. Es sind verschiedene Untersuchungen vorgenommen worden, welcher Art das Rechtsverhältnis zwischen Genußscheinausgeber und -inhaber ist und ob es sich auf einen bestimmten schuldrechtlichen Vertragstyp zurückführen läßt. Mögliche Ansatzpunkte einer Charakterisierung des Genußrechtsverhältnisses wurden durch Vergleiche mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der stillen Gesellschaft und dem partiarischen Darlehen erreicht. Der Genußrechtsvertrag ähnelt nach herrschender Meinung diesen Konstruktionen ohne sich eindeutig unter einen bestimmten schuldrechtlichen Vertragstyp subsumieren zu lassen. Eine exakte Unterscheidung und Einordnung bleibt den Juristen vorbehalten.
Einen Übergang auf den folgenden Abschnitt -der steuerlichen Behandlung von Genußscheinen- soll die Frage der Bilanzierung der gewährten Genußrechte beim Emittenten darstellen. Genußscheine verbriefen wie schon dargelegt Gläubigerrechte. Trotzdem ist eine Unterscheidung nötig, ob das Genußrechtskapital bilanzrechtlich als Eigenkapital oder Fremdkapital anzusetzen ist. Der hier relevante § 266 (3) HGB gibt keine Antwort, sondern es bestimmt sich die Einordnung nach der jeweils konkreten Ausgestaltung der Genußscheine. Eine exakte Einordnung im Sinne der idealtypischen Merkmale Vermögens- und Erfolgsanspruch, Haftung, Verfügbarkeit und Leitungsbefugnis ist bei Genußscheinen sicherlich nicht gegeben. Es ist der Vorschlag gemacht worden, das Kapital dahingehend zu charakterisieren, inwieweit es Risikokapital oder Nicht-Risikokapital darstellt. In der Regel wird Genußkapital je nach Ausgestaltung dann unter ersteres fallen. Nach der handelsgesetzlichen Unterscheidung in Eigen- und Fremdkapital gilt für die Genußscheine aber das Folgende: Ist eine Rückzahlung vereinbart, und zwar vor der Liquidation des Unternehmens, so handelt es sich unabhängig von Laufzeit und Rangrücktritt des Genußscheins um Fremdkapital und ist als Verbindlichkeit zu bilanzieren. Liegt hingegen kein Rückzahlungsanspruch vor oder ergibt sich die Rückzahlung nur aus zukünftigen Jahresüberschüssen oder Liquidationsüberschüssen, so ist das Genußrechtskapital als dem "Eigenkapitalposten ähnlich" anzusetzen. Diese Einschränkung muß deshalb gemacht werden, weil das Genußkapital nicht unter Eigen- bzw. Fremdkapital subsumiert werden sollte. Vielmehr sollte ein weiterer Bilanzposten zwischen "Eigenkapital" und "Sonderposten mit Rücklageanteil" eingeschoben werden, der das Genußkapital nach den dargestellten Rückzahlungsmodalitäten gesondert aufsplittet, um dem Bilanzleser die zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirksamen Zahlungsansprüche der Kapitalgeber zu verdeutlichen. Insbesondere muß erkennbar gemacht werden, daß auch Nicht- Gesellschafter Risikokapital zur Verfügung gestellt haben, welches am Liquidationsüberschuß partizipiert. Ist das Genußkapital vorzeitig zurückzuzahlen, so sind mögliche Rückzahlungsansprüche, die vor Ablauf der nächsten fünf Jahre wirksam werden können, ebenso auszuweisen.
Es ist also wie gesehen möglich, durch Ausschluß des Anteils am Liquidationserlös (und somit der Einbeziehung des Anspruchs auf vorzeitige Rückzahlung) dem Genußschein die Qualität des Fremdkapitals zu geben. Die steuerlich relevante Rechtsfolge dessen wird nunmehr aufgezeigt.
3.3 Steuerrechtliche Aspekte der Genußscheine
Genußscheine sind trotz ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung und fehlender gesetzlicher Kodifizierung Gegenstand verschiedener Steuergesetze. Die für Emittenten wie Erwerber wichtigsten sollen in diesem Abschnitt kurz beleuchtet werden. Aus der Sicht des Emittenten (sofern es sich bei diesem um eine Kapitalgesellschaft handelt) ist der § 8 (3) Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes von entscheidender Bedeutung. Im § 8 KStG wird nämlich die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens der Gesellschaft bestimmt, wobei festgelegt wird, daß Ausschüttungen jeder Art auf Genußrechte, mit denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös der Gesellschaft verbunden ist, das Einkommen nicht mindern, also voll zu versteuern sind. Hieraus geht hervor, daß die bezeichnete Rechtsfolge dieser Vorschrift nur dann eintritt, wenn beide Voraussetzungen gemeinsam vorliegen. Im Umkehrschluß bedeutet dies aber: Liegt aufgrund der Vertragsausgestaltung eines konkreten Genußrechts nur eine der beiden Voraussetzungen vor, so sind die Vergütungen an die Genußberechtigten als Betriebsausgaben vom zu versteuernden Einkommen abziehbar. Recht auf Beteiligung am Gewinn ist dann gegeben, wenn keine Zahlungen einer erfolgsunabhängigen Vergütung vereinbart worden sind. Das Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös liegt genau dann nicht vor -und das muß das Bestreben der Emittenten sein, wenn sie das Genußkapital steuerlich als Fremdkapital deklarieren wollen-, wenn ein Anspruch auf Rückzahlung vor Liquidation verbrieft ist. Diesr Anspruch kann nun seinerseits durchaus als ein erfolgsabhängiger, also gegebenenfalls um laufende Verluste verminderter Anspruch definiert werden.
Bei Personengesellschaften bestimmt der § 15 (1) 2. EStG, daß die Einkünfte aus Gewerbebetrieb die Gewinnanteile der Gesellschafter miteinschließen. Ein Genußscheininhaber ist aber, wie oben bereits dargelegt wurde, nicht als ein Gesellschafter oder Mitunternehmer anzusehen. Die auf die Genußrechte entfallenden Ausschüttungen sind daher stets als Betriebsausgaben abzusetzen und mindern das zu versteuernde Einkommen des Emittenten.
Um die Sicht des Genußscheininhabers zu berücksichtigen, sind die Einkünfte, die aus dem Genußschein realisiert werden, hinsichtlich ihrer Besteuerung zu untersuchen. Der § 20 (1) 1. EStG subsumiert die Bezüge aus Genußrechten den Einkünften aus Kapitalvermögen, wenn mit ihnen das Recht am Gewinn und Liquidationserlös einer Kapitalgesellschaft verbunden ist. Für all jene Fälle, in denen es sich bei dem Verpflichteten um eine Personengesellschaft handelt oder das Anrecht auf Anteil am Liquidationserlös ausgeschlossen ist, fungiert der § 20 (1) 7. EStG als eine Art Auffangvorschrift. Die Einnahmen aus den Genußrechten sind auch dann Einkünfte aus Kapitalvermögen, wenn entweder die Rückzahlung des eingebrachten Kapitals oder ein Nutzungsentgelt für die Überlassung des Kapitals vereinbart worden ist, auch wenn die Höhe des Entgelts von einem ungewissen Ereignis abhängt. Diese Rechtsvorschrift schließt also die wohl häufigsten Fälle mit ein, in denen das Genußrecht ohne Anteil am Liquidationserlös und somit als steuerliches Fremdkapital seitens der Unternehmung emittiert wird.
Bereits bei den Emissionsanlässen wurde bereits die Möglichkeit der Beteiligung von Mitarbeitern mittels Gewährung von Genußrechten aufgezeigt. Überläßt ein Unternehmen Vermögensbeteiligungen -und hierunter fallen sowohl börsennotierte (nach § 19a (1) 3. EStG) wie unverbriefte Genußrechte am Unternehmen des Arbeitgebers (nach § 19a (1) 11. EStG)- unentgeltlich oder verbilligt an Arbeitnehmer im Rahmen des gegenwärtigen Dienstverhältnisses und wird dadurch keine Mitunternehmerschaft begründet, so hat der Begünstigte den finanziellen Vorteil nach § 19a (1) EStG nur dann als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zu versteuern, wenn dieser 300,- DM pro Jahr oder den halben Wert der Vermögensbeteiligung übersteigt.
In diesen Zusammenhang gehören auch die im Rahmen der Anlage von vermögenswirksamen Leistungen erworbenen Genußrechte. Das Vermögensbildungsgesetz fördert unter anderem die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen in sogenanntem Produktivvermögen. Zu diesem zählen auch Genußrechte und zwar ebenso börsennotierte und als Wertpapiere verbriefte (§ 2 (1) 1.f VermBG), wie unverbriefte (§ 2 (1) 1.l VermBG). Der Erwerber der Genußrechtsanteile hat die Möglichkeit eine staatliche Sparzulage zu erhalten, sofern sein zu versteuerndes Einkommen eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreitet.
4. ARTEN VON GENUßSCHEINEN --EINE SYSTEMATISCHE ÜBERSICHT IHRER INHALTLICHEN RECHTSNATUR--
Die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Genußscheinarten und ihre Ausgestaltungen, insbesondere die im Kreditwesengesetz genannten, sind, um es noch einmal hervorzuheben, nur Beispiele für das, was unter dem Begriff "Genußschein" am Kapitalmarkt auftreten kann. Die bereits aufgezeigten Ausgestaltungsmöglichkeiten stellen sicherlich die in der Praxis relevantesten dar. Der mehrmalige Bezug auf Rechtsvorschriften ist hier somit ein Versuch sich an ein Wertpapier anzunähern, dem eine gesetzliche Definition nicht zukommt. Dieser große Freiraum bei der Gestaltung von Genußrechten ermöglicht es dem Emittenten, eine seinen konkreten Bedürfnissen entsprechende Ausstattung vorzunehmen. Dabei ist eine Vielzahl von Varianten denkbar, deren Bandbreite Gegenstand der in diesem Abschnitt vorgenommenen Systematisierung sein soll. Dabei sollen diejenigen Rechte und Ansprüche der Genußscheininhaber (das, was Genußscheine inhaltlich an Ansprüchen begründen) aufgezeigt und klassifiziert werden, die diesen am häufigsten gewährt werden.
Die wichtigsten den Genußrechtsinhabern gewährten Ansprüche sind der Anspruch auf Vergütung der Kapitalüberlassung und der Anspruch auf Kapitalrückzahlung. Daneben existieren weitere Vermögensrechte, wie die bei der Untersuchung der Gläubigerstellung bereits erwähnten Bezugsrechte, Umtausch- und Auslosungsrechte, sowie Benutzungsrechte. Auch mögliche immaterielle Rechte der Genußscheininhaber sollen in die hier vorgenommene Klassifizierung miteinbezogen werden.
4.1 Der Anspruch auf Vergütung der Kapitalüberlassung und seine Ausprägungen
In der Mehrzahl der Fälle werden Genußrechte gegen die Überlassung eines Kapitalbetrages gewährt. Auch bei der Einlage nicht-monetärer Vermögensgegenstände, wie Rechte, Patente oder Lizenzen in das Unternehmen wird hierfür ein laufendes -also nicht nur am Ende der Genußrechtslaufzeit, falls diese zeitlich begrenzt ist- Entgelt zu zahlen sein. Die Regelungen bezüglich dieses Entgelts können sowohl die Höhe desselben, wie auch die Zeitpunkte, zu denen es zu zahlen ist, betreffen. Letzteres läuft darauf hinaus, daß in den Bedingungen der Genußscheine definiert werden muß, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt (das kann z.B. der Dividendentermin der Aktien sein) überhaupt zu einer Zahlung der Vergütung kommt oder ob diese ausfällt.
Die Kenngröße, die bei Genußscheinen der Zahlung von Kapitalüberlassungsentgelten zugrunde liegt, ist der Unternehmenserfolg, der sich in der Regel im handelsrechtlich ausgewiesenen Periodenergebnis niederschlägt. Mögliche Regelungen des Anspruchs auf Vergütung werden im Hinblick auf die Erfolgsabhängigkeit untersucht. Dabei zeigt sich, daß die Vergütung erfolgsunabhängig oder erfolgsabhängig sein kann. Eine erfolgsunabhängige Vergütung erinnert stark an Zinszahlungen auf klassisches Fremdkapital, wie sie bei Krediten und den allgemein gebräuchlichen Formen der Anleihe praktiziert werden. Dennoch kann auch diese Form der Vergütung dem Genußschein zugerechnet werden. Als erfolgsunabhängig gilt eine Vergütung immer dann, wenn sie
a) entweder in ihrer gesamten Höhe wie ein Zins festgeschrieben ist oder
b) nur eine garantierte Mindestverzinsung beinhaltet.
Im zweiten Fall ist nur die "Zusatzverzinsung" an Erfolgsfaktoren gekoppelt. Die garantierte Basisverzinsung in der zweiten Variante liegt niedriger als der "feste Zins" im Fall a), weil im Fall b) auch die Möglichkeit einer Teilnahme am Erfolg miteinbezogen ist. Bei einem genügend hohen Unternehmenserfolg ist die Gesamtvergütung in b) höher als in a), rein theoretisch unbegrenzt. Gleichzeitig kann sie aber nicht unter den Mindestsatz fallen. Als Vergütung wird in der Variante b) stets der jeweils höhere Betrag aus den beiden Alternativen "Grundverzinsung" oder "erfolgsanteilige Verzinsung" ausgewählt und gezahlt. Die genannte Form der erfolgsanteiligen Zusatzvergütung mag hier unpassend unter den Oberbegriff der "erfolgsunabhängigen Vergütung" untergeordnet sein. Im Allgemeinen ist aber eine Vergütung insgesamt auch dann als erfolgsunabhängig anzusehen, wenn sie nicht unter einen Mindestbetrag absinken kann, somit quasi "nach unten hin" fix ist und sich die Erfolgsabhängigkeit nur "nach oben hin" auswirkt.
Bei den erfolgsabhängigen Vergütungen unterscheidet man in mittelbare und unmittelbare Erfolgsabhängigkeit. Von einer mittelbaren Erfolgsabhängigkeit spricht man immer dann, wenn eine feste Vergütung (Verzinsung) vereinbart ist, die aber nur dann zum Tragen kommt, wenn ein ausreichender Unternehmenserfolg erreicht wurde. Hierbei ist die fixe Vergütung also die Obergrenze, unter die sie aber abhängig vom Erfolg bis auf 0, dem totalen Vergütungsausfall, absinken kann. Man wählt aus den beiden Alternativen "Grundverzinsung" oder "erfolgsabhängiger Anteil" also stets den jeweils niedrigeren Betrag und schüttet diesen an die Genußrechtsinhaber aus. Es handelt sich um den Gegensatz zu der erfolgsunabhängigen Variante b) :"Nach oben hin" ist die Vergütung limitiert, "nach unten hin" aber variabel. Es kommt also auf das "nach unten hin" an, ob man von erfolgsabhängiger oder erfolgsunabhängiger Vergütung spricht.
Eine vergleichbare Konstruktion ist beim Fall a) der unmittelbaren Erfolgsabhängigkeit zu beobachten:
a) Hier ist der Vergütungsanspruch zwar vollständig erfolgsabhängig, allerdings bei einem bestimmten Höchstbetrag limitiert. Dieser liegt wesentlich höher als die "fixe Obergrenze" im eben genannten Beispiel der mittelbaren Erfolgsabhängigkeit. Dort wird die Höchstgrenze schon ab einem relativ niedrigen Periodenerfolg erreicht, während hier nur ab einem außergewöhnlich hohen Erfolg die konstante Vergütung eintritt. Eine weitere Möglichkeit der unmittelbaren Erfolgsabhängigkeit ist der folgende Fall:
b) Die Vergütung ist dann unmittelbar erfolgsabhängig, wenn sie ausschließlich von der Höhe des Periodenerfolges E abhängt. Hier nun sind weder Ober- noch Untergrenzen gegeben, die Vergütung wird als eine lineare Funktion V(E) ausgedrückt.
c) Schließlich ist die Variante denkbar, daß eine Mindestvergütung unter der Bedingung vereinbart wird, daß dieses Minimum nur dann gezahlt wird, wenn der Erfolg dafür ausreicht. Die Vergütung fällt also bei einem negativen Periodenerfolg aus, beträgt bei niedrigem Erfolg nur einen entsprechenden Anteil des Minimums, ab dem als ausreichend definierten Erfolg genau die Mindestvergütung und ist bei darüber hinausgehendem und somit hohen Periodenerfolgen schließlich wieder uneingeschränkt erfolgsabhängig.
Sowohl bei der mittelbaren Erfolgsabhängigkeit, als auch im Fall c) der unmittelbaren Erfolgsabhängigkeit kann eine Verpflichtung der emittierenden Unternehmung auf Nachzahlung der Vergütung bestehen, wenn in Perioden mit zu geringem oder negativem Erfolg die Vergütung ausgefallen ist.
Das hier Dargestellte noch einmal in einer Übersicht (nach Zupancic):
Ausgestaltungsmöglichkeiten des Anspruchs auf Vergütung der Kapitalüberlassung:
Anspruch auf:
a) erfolgsunabhängige Vergütung
- garantierte, fixe Verzinsung
- fixe Verzinsung, oder Anteil am Periodenerfolg, falls dieser höher
b) erfolgsabhängige Vergütung
b1) mittelbar
- fixe Verzinsung, falls Erfolg dafür ausreicht
b2) unmittelbar
- ausschließlich Anteil am Periodengewinn
- Mindestverzinsung, falls Erfolg ausreicht, evtl. höher
- Anteil am Gewinn bis zu einem Höchstbetrag
4.2 Der Anspruch auf Kapitalrückzahlung
Beim Anspruch auf Kapitalrückzahlung unterscheidet man die Ausgestaltungsmöglichkeiten "Anspruch auf Rückzahlung vor Liquidation" und "Anspruch auf Rückzahlung bei Liquidation". Die beiden Fälle beziehen sich dementsprechend auf Genußrechte, die zeitlich begrenzt bzw. unbegrenzt vereinbart wurden. Beide Varianten werden ebenfalls nach dem Kriterium der Erfolgsabhängigkeit systematisiert.
4.2.1 Der Anspruch auf Rückzahlung vor Liquidation
Zuerst wird der Fall der begrenzten Laufzeit oder der Kündigung eines Genußrechts betrachtet, so daß es zu einer Kapitalrückzahlung vor Liquidation kommen muß. Da Genußscheine meist als Eigenkapitalersatz dienen, haben sie in der Regel lange oder unbegrenzte Laufzeiten. Das schließt jedoch nicht aus, daß sie mit einem Kündigungsrecht seitens des Emittenten (in seltenen Fällen auch seitens des Gläubigers) ausgestattet sein können. Bei begrenzten Laufzeiten handelt es sich meist um das sogenannte steuerlich bedingte Kündigungsrecht. Dieses besagt, daß der Emittent zur Kündigung der Genußrechtsverbindlichkeiten berechtigt ist, wenn in der Bundesrepublik Deutschland eine Rechtsvorschrift zum Nachteil der steuerlichen, insbesondere körperschaftsteuerlichen Behandlung des Genußkapitals erlassen wird. Damit will sich der Emittent die Option vorbehalten, das Genußkapital, das sonst für ihn stark an Attraktivität verlieren würde, zu tilgen, wenn die auf den Genußschein zu entrichtende Vergütung nicht mehr als Betriebsausgabe abgesetzt werden kann.
Das in den meisten Genußrechtsverträgen gegen Gewährung des Genußrechts eingezahlte Kapital wird in den geschilderten Fällen im laufenden Geschäftsbetrieb -also nicht erst bei Liquidation- fällig und muß nun zurückerstattet werden. Damit stellt sich das Problem, in welcher Höhe eine Rückzahlung zu erfolgen hat.
Eine erfolgsunabhängige Rückzahlung des Genußkapitals liegt dann vor, wenn die Zahlung in ihrer absoluten Höhe festgelegt ist, die Tilgung somit nicht um eventuelle laufende Verluste (über deren Definitionsweisen noch später mehr) der Vorperioden gemindert oder um solche Überschüsse erhöht ist und auch der Unternehmenswert zum Zeitpunkt der Tilgung unberücksichtigt bleibt. Auch eine solche Ausgestaltung, die schon an die der klassischen Anleihe erinnert, kann noch unter den Begriff "Genußschein" subsumiert werden, da ja in Verbindung mit dieser Rückzahlungsvariante ein ausschließlich erfolgsabhängiges Kapitalnutzungsentgelt verbunden sein kann.
Die zweite Möglichkeit der erfolgsunabhängigen Kapitalrückzahlung beinhaltet, daß der Rückzahlungsbetrag an einem hohen Unternehmenswert im Rückzahlungszeitpunkt partizipiert, gleichzeitig aber auch ein Mindestbetrag festgeschrieben ist. Die Rückzahlung ist also "nach unten hin" fix, "nach oben hin" variabel. Wie schon bei der Nutzungsvergütung ist das "Nach unten hin" der Maßstab für Erfolgsabhängigkeit oder, wie in diesem Fall, Erfolgsunabhängigkeit.
Die erfolgsabhängige Rückzahlung ist wieder in mittelbare und unmittelbare Erfolgsabhängigkeit zu unterteilen. Man spricht von einer mittelbaren Erfolgsabhängigkeit in den Fällen, da ein ex ante festgelegter Rückzahlungsbetrag durch einen auf den jeweiligen Genußschein entfallenden Verlustanteil gemindert wird. Auf die möglichen Verlustbegriffe wird noch gesondert einzugehen sein. Hier ist der maximal mögliche Rückzahlungsbetrag also definitiv bekannt, er kann jedoch vermindert oder, bei genügend großem Verlust auch völlig ausfallen. Eine weitere Variante der mittelbaren Erfolgsabhängigkeit besteht in der Bindung der Rückzahlung an einen in der Rückzahlungsperiode erwirtschafteten Unternehmenserfolg. Die Rückzahlung darf dann nur in den Fällen erfolgen, insofern der Rückzahlungsbetrag den Periodenerfolg nicht überschreitet. Hier ist im Unterschied zum ersten Fall nur der Gesamterfolg der jeweiligen Periode maßgeblich und nicht ein theoretisch aus mehreren Perioden sich ergebender Verlustanteil eines Genußscheins. In dem zuletzt geschilderten Beispiel kommt oft das sogenannte Auslosungsrecht des Genußscheins zum Tragen. Dies besagt, daß aus der gesamten Genußscheintranche einzelne Stücke bzw. Genußscheininhaber durch Auslosung ermittelt werden, welche die Rückzahlung ihrer Anteile aus dem jeweiligen Periodenerfolg verlangen können.
Der Anspruch auf Kapitalrückzahlung vor Liquidation ist dann unmittelbar erfolgsabhängig, wenn er ausschließlich von der Höhe des Unternehmenswertes im Tilgungszeitpunkt abhängt. Auch hier besteht die Möglichkeit einen Höchstbetrag der Rückzahlung zu vereinbaren. Übersteigt der Unternehmenswert eine im voraus bestimmte Höchstgrenze, so wird nur ein fixer Rückzahlungsbetrag erstattet.
In den Fällen, da sich der Rückzahlungsbetrag in Abhängigkeit vom Unternehmenswert bestimmt, ist in den Genußscheinbedingungen festzulegen, wie dieser Wert zu errechnen ist sowie die Art und Weise der Abhängigkeit vom Unternehmenswert. Ist der Emittent der Genußscheine eine Aktiengesellschaft, deren Anteile am Kapitalmarkt gehandelt werden, so kann der Unternehmenswert auf Basis des Aktienkurses bestimmt werden. Eine weitere wenn auch aufwendigere Methode besteht in den Wertermittlungsvorschriften des Steuerrechts. Diese sind demnach nur empfehlenswert, wenn sie ohnehin zur Bestimmung von Besteuerungsgrundlagen herangezogen werden müssen.
Abschließend die Ausgestaltungsmöglichkeiten des Anspruchs auf Kapitalrückzahlung vor Liquidation in einer Ü bersicht (nach Zupancic):
Anspruch auf:
a) erfolgsunabhängige Rückzahlung
- fester Rückzahlungsbetrag
- fester Rückzahlungsbetrag oder Anteil d. Unternehmeswertes, falls dieser höher
b) erfolgsabhängige Rückzahlung
b1) mittelbar
- feste Rückzahlung gemindert um Verlustanteil
- feste Rückzahlung, falls Periodengewinn ausreicht (Auslosung)
b2) unmittelbar
- Rückzahlung nur abhängig von Unternehmenswert
- Rückzahlung bis zu einem Höchstbetrag abhängig vom Unternehmenswert
4.2.1.1 Anknüpfungstatbestände für Gewinn-/Verlustgrößen
Eine Möglichkeit zur Bestimmung des Unternehmenswertes, wie er für die Anknüpfung von Rückzahlungsgrößen vor Liquidation zum Tragen kommen könnte, wurde soeben aufgezeigt. Bei der im Folgenden noch zu besprechenden Rückzahlung bei Liquidation ist der Hauptanknüpfungstatbestand für Auszahlungshöhen im Liquidationsüberschuß zu sehen. Dieser wird im allgemeinen bezeichnet als die Summe der Erlöse, die bei der Auflösung des Unternehmens aus dem Verkauf des gesamten Betriebsvermögens erzielt werden, abzüglich der zu tilgenden Verbindlichkeiten.
Wesentlich unklarer ist hingegen, was unter den Anknüpfungsgrößen “Gewinn“ bzw. “Erfolg“ und “Verlust“ genau zu verstehen ist und wie diese zu quantifizieren sind. Gerade im Zusammenhang mit der soeben angesprochenen erfolgsabhängigen Vergütung der Kapitalüberlassung und der erfolgsabhängigen Kapitalrückzahlung vor Liquidation sind es diese Größen, die die tatsächlich erfolgende Ausschüttung im wesentlichen bestimmen.
Ebenso wie die Bedingungen einer Genußscheinemission frei wählbar sind, so gibt es auch für die Definition des Begriffes “Gewinn“ oder “Periodenerfolg“, der für die Bestimmung der Höhe der Vergütung von Bedeutung sein soll, keine verbindlichen Vorgaben. Die Größe “Periodenerfolg“ kann sich an Erfolgskennzahlen orientieren, die für andere Zwecke ermittelt werden, so zum Beispiel aus dem externen Rechnungswesen das handelsrechtliche oder steuerrechtliche Periodenergebnis oder aus dem internen Rechnungswesen das Betriebsergebnis. Eine Unterscheidung zwischen den möglichen Anknüpfungsgrößen wird im Zusammenhang mit dem Verlustbegriff dargestellt. Sie gilt sinngemäß (nur mit anderem Vorzeichen) auch für den Gewinn.
Es besteht ferner die Möglichkeit, eine Erfolgsgröße eigens zur Bestimmung der Vergütungsansprüche ebenso wie die Art der Abhängigkeit der Vergütung von dieser Größe zu definieren. Diese angesprochene Art der Abhängigkeit wird, sofern das handelsrechtliche Periodenergebnis die Grundlage bildet, oft in der Form ausgestaltet, daß sich die Ausschüttung der Genußberechtigten an der den Gesellschaftern zukommenden Ausschüttung orientiert. Als ein weiteres Beispiel für die Bestimmung des Gewinns sei der Konzernjahresüberschuß vor Steuern genannt, der seinerzeit von der Bertelsmann AG als Grundlage ihrer Genußscheinemission angewandt wurde. Die Höhe des Gewinnanteils, der auf die Genußscheininhaber entfiel, ergab sich aus der Höhe der Gesamtkapitalrendite, dargestellt als Quotient aus dem angesprochenen Konzernjahresüberschuß und der Konzernbilanzsumme.
Die Ermittlung eines auf den Genußschein entfallenden Verlustanteil, also eines negativen Periodenergebnisses, leitet sich aus der Art und Weise der Ermittlung des Periodengewinns ab. Wenn festgelegt ist, wie der für die Erfolgsanteile des Genußkapitals maßgebliche Gewinn zu errechnen ist, dann ist damit im Umkehrschluß auch der Verlustbegriff geklärt.
Bezüglich der Minderung der Vergütung der Kapitalüberlassung besteht ein Verlust in einer nichtgeleisteten Ausschüttung. Auch hier wird gemäß der jeweils geltenden Genußscheinbedingungen ein Anteil des Periodenverlustes auf das Genußkapital entfallen, wodurch die Vergütung gemindert wird oder gänzlich ausfällt. Wird der Erfolg zum Beispiel durch das handelsrechtliche Periodenergebnis bestimmt, so kann der Verlust gleichmäßig auf das ausgewiesene Risikokapital, also Gesellschaftereinlagen und Genußkapital, verteilt werden und sowohl die Kapitalnutzungsvergütung wie eine eventuell fällige Rückzahlung mindern. Der Begriff “Periodenverlust“ erlaubt im wesentlichen drei Interpretationen:
a) Verlust = negatives Betriebsergebnis. Dieses liegt vor, wenn die betriebsbedingten Aufwendungen die betriebsbedingten Erträge übersteigen. Für einen Außenstehenden, was der Genußscheininhaber in der Regel ist, ist hier selten exakt nachzuvollziehen, welche Aufwendungen und Erträge betriebsbedingt sind.
b) Verlust = Jahresfehlbetrag. Der Jahresfehlbetrag hingegen ist für das breite Publikum aus der Gewinn- und Verlustrechnung ersichtlich. Er stellt das um außerordentliche, periodenfremde und betriebsfremde Aufwendungen und Erträge erweiterte Betriebsergebnis dar.
c) Verlust = Bilanzverlust. Der Bilanzverlust ist allgemein definiert als das Jahresergebnis (hier: Jahresfehlbetrag), das um Entnahmen und Einstellungen in die Rücklagen ergänzt wird. Ob bei Vorliegen eines Jahresfehlbetrages vorhandene Rücklagen dergestalt zu Gunsten der Genußrechtsgläubiger aufgelöst werden, daß sich der Jahresfehlbetrag vermindert, das Bilanzergebnis ausgeglichen oder sogar positiv ausfällt (und so eine Verlustzuweisung vermieden bzw. eine Gewinnausschüttung ermöglicht wird), liegt im Ermessen des Emittenten.
Wie sich zeigt, ist für die potentiellen Genußscheininvestoren nicht nur genaue Kenntnis der Genußscheinbedingungen und der Verlustanknüpfungstatbestände vonnöten, sondern es können darüber hinaus teilweise nur vertiefende Analysen der Unternehmenszahlen die konkrete Basis für die Berechnung von möglichen Gewinnen oder Verlusten aus den Genußscheinen liefern. Ob dies dem Durchschnittsanleger möglich ist, ist mehr als fraglich.
Die Minderung des Rückzahlungsbetrages und die daraus resultierende Verlustteilnahme des Genußscheins kann sich aus einer Aufsummierung aller während der Genußscheinlaufzeit angefallenen anteiligen Periodengewinne und Periodenverluste, sowie der Saldierung derselben ergeben. Reichen die aufgelaufenen Gewinne nicht zur Kompensierung der Verluste, so wird der (fällige) Rückzahlungsbetrag um die entsprechende Größe gekürzt. Auch wird die Variante als denkbar genannt, daß laufende Verluste gegen die Kapitalposition der Genußrechte direkt (ohne daß der Rückzahlungsanspruch zu diesem Zeitpunkt fällig sein muß) ausgebucht werden können. Dies ist nur unter den Umständen möglich, da das Genußkapital mit begrenzter Laufzeit bzw. Kündigungsrecht ausgestattet ist. In diesen Fällen wird der Buchwert des Genußkapitals nämlich mit dem geltenden Rückzahlungsbetrag angesetzt, welcher dann entsprechend gekürzt wird. Deshalb kann sich eine Teilnahme an laufenden Verlusten hier nicht auf nichtrückzahlbares Genußkapital beziehen.
4.2.2 Der Anspruch auf Rückzahlung bei Liquidation
Es ist möglich Genußscheine derart auszugestalten, daß sie keine Rückzahlung vorsehen und kein vorzeitiges Kündigungsrecht weder seitens des Emittenten noch des Gläubigers enthalten. Ferner ist es denkbar, daß ein solches Kündigungsrecht zwar besteht, aber keine berechtigte Partei davon Gebrauch macht. In solchen Fällen endet das Genußrecht erst mit der Auflösung des Unternehmens, also bei dessen Liquidation. In den meisten Fällen wird es sich dabei nicht um die Auflösung eines rentablen und liquiden Unternehmens sondern um eine aus Gründen der Überschuldung oder Illiquidität “erzwungene“ Auflösung, sprich einen Konkurs handeln. Es muß nun festgelegt werden, wie die Genußrechtsgläubiger in dieser Situation zu behandeln sind und welche Rechte sie gegebenenfalls gegen die Unternehmung herleiten können. Die möglichen Ausstattungsvarianten, die ein Genußschein erfahren kann, sehen für diesen Fall meist eine der folgenden Spielarten vor.
Wiederum ist der Anspruch auf Kapitalrückzahlung bei Liquidation erfolgsabhängig oder erfolgsunabhängig denkbar.
Als erfolgsunabhängig wird ein Anspruch auf einen bereits bei Emission des Genußscheins in seiner Höhe absolut festgelegten Geldbetrag bezeichnet. Dieser fixe Betrag ist vergleichbar mit den aus einer gezeichneten “ewigen“ Anleihe bzw. einem “auf ewig“ (sprich: bis zur Liquidation) gewährten Kredit resultierenden Rückzahlungsansprüchen, die ebenfalls unabhängig von der gegenwärtigen finanziellen Situation des Unternehmens existieren. Der wohl relevanteste Unterschied zu den Tilgungsansprüchen des klassischen Fremdkapitals besteht bei den Genußscheinen in ihrem Rangrücktritt gegenüber diesen Ansprüchen. Man spricht von einer nachrangigen Verbindlichkeit seitens des Unternehmens. Das bedeutet, daß im konkreten Liquidationsfall die Ansprüche der Genußverbindlichkeiten erst nach Befriedigung der sogenannten erstrangigen Gläubiger berücksichtigt und bedient werden. Das sagt auch schon Wichtiges über den wirtschaftlichen Wert einer solchen nachrangigen Forderung aus; Sie wird ungeachtet ihres juristisch eindeutig bestehenden Anspruchs auf uneingeschränkte Zahlung der Tilgungsleistung kaum Aussicht auf Durchsetzung dieses Anspruchs beinhalten, weil erfahrungsgemäß die vorhandene Konkursmasse längst aufgezehrt ist.
Die Variante der erfolgsabhängigen Rückzahlung ist wiederum in mittelbare und unmittelbare Erfolgsabhägigkeit zu unterteilen.
Mittelbar erfolgsabhängig ist eine Rückzahlung in den Fällen, da zwar ex ante ein fixer Rückzahlungsbetrag vereinbart wurde, welcher aber nur dann auch zu zahlen ist, wenn ein ausreichender Liquidationsüberschuß erzielt wird, der für diese Zahlung ausreicht. Es wird also stets der geringere Betrag aus den Alternativen “festgelegte Tilgung“ und “Anteil des Liquidationsüberschusses“ ausgezahlt.
Die unmittelbar erfolgsabhängige Rückzahlung liegt vor, wenn in den Genußscheinbedingungen der Rückzahlungsbetrag R nur als Funktion des Liquidationsüberschusses L in der Form R=R(L) definiert ist. Hier besteht nicht nur von wirtschaftlicher Seite, sondern auch aus juristischer Sicht höchste Unsicherheit über die Höhe der Rückzahlung. Sie kann bei keinem oder nur sehr geringem Überschuß gleich bzw. annähernd gleich Null betragen, aber auch bei genügend großen Liquidationsüberschüssen (die wohl praktisch kaum vorkommen dürften) eine beachtliche Höhe erreichen, theoretisch sogar unendlich hoch sein.
Ebenfalls als unmittelbar erfolgsabhängig gilt eine Mindestrückzahlung, die nur unter der Bedingung zu erfolgen hat, daß ein ausreichender Liquidationsüberschuß realisiert wird. Das bedeutet, daß unterhalb des für die Mindestrückzahlung bestimmten Überschusses nur ein Anteil des dann vorliegenden Überschusses gezahlt wird, im Extremfall auch nichts, nämlich dann, wenn überhaupt kein Liquidationsüberschuß erzielt wurde. Erreicht der Überschuß eine gewisse Höhe, wird die Mindestrückzahlung gewährt. Der Begriff “Mindest“ weist schon darauf hin, daß bei genügend hohen Überschüssen auch ein über dem Minimum liegender Anteil gezahlt wird, der sich nun wiederum als vom Überschuß abhängige Größe bestimmt.
Die dritte Variante der unmittelbar erfolgsabhängigen Rückzahlung liegt vor, wenn der Rückzahlungsbetrag direkt vom Liquidationsüberschuß abhängt, aber ab einer bestimmten Höhe desselben nicht mehr daran partizipiert. Es handelt sich also um eine Höchstbetragsregelung bezüglich der möglichen Rückzahlungshöhen. Zu klären ist in diesem Zusammenhang noch das Problem, daß nicht nur die Genußrechtsgläubiger allein einen Anspruch auf eine -wie auch immer gestaltete- Teilhabe am Liquidationsüberschuß haben. Sie treten vielmehr in Konkurrenz zu den Anteilseignern, bei der Aktiengesellschaft zu einer Vielzahl von Aktionären. In welchem Verhältnis diese Ansprüche der Genußsscheininhaber zu den Ansprüchen der Gesellschafter aus dem Liquidationsüberschuß stehen, richtet sich nach den Genußscheinbedingungen, wie sie im Einzelfall festgeschrieben worden sind. Es werden hier drei Fälle unterschieden, wie die Ansprüche der Genußscheininhaber gestaltet sein können: nämlich
a) prioritätisch, das heißt, der Genußberechtigte wird in seinen Ansprüchen vor den Ansprüchen den Gesellschafter berücksichtigt.
b) paritätisch, also den Gesellschafter gleichgestellt, was zur Folge hat, das der Liquidationsüberschuß ohne Bevorrechtigungen verteilt wird, und schließlich
c) posterioritätisch, was bedeutet, daß die Ansprüche aus den Genußscheinen erst nach der Befriedigung der Gesellschafteransprüche berücksichtigt werden.
In der Praxis liegt vornehmlich der prioritätische Anspruch vor, so daß aus dem gesamten Liquidationserlös zuerst die Gläubiger, dann die Genußrechtsinhaber und schließlich die Anteilseigner bedient werden.
Die aufgeführten Möglichkeiten der Gestaltung des Anspruchs auf Kapitalüberlassungsentgelt und Rückzahlung vor bzw. bei Liquidation des Unternehmens können sämtlich bei Genußscheinen vorkommen. Mit einer Ausnahme ist auch jede Kombination dieser Möglichkeiten denkbar. Die Ausnahme besteht in der Kombination einer festgeschriebenen Vergütung der Kapitalüberlassung und einer gleichermaßen festgeschriebenen Kapitalrückzahlung. Bei dieser Kombination ist nämlich keine Erfolgsteilnahme des Genußscheins mehr gegeben. Da der Genußschein dies aber als sein hervorstechendes Wesensmerkmal beinhaltet, kann in einem solchen Fall das zugrundeliegende Wertpapier nicht mehr als “Genußschein“ bezeichnet werden, sondern fällt vielmehr unter die Kategorie einer Schuldverschreibung mit begrenzter oder unbegrenzter Laufzeit (je nachdem ob die fixe Rückzahlung vor oder erst bei Liquidation des Unternehmens fällig wird).
Abschließend die Ü bersicht der Ausgestaltungsmöglichkeiten des Anspruchs auf Kapitalrückzahlung bei Liquidation (nach Zupancic):
Anspruch auf:
a) erfolgsunabhängige Rückzahlung
- fester Rückzahlungsbetrag
b) erfolgsabhängige Rückzahlung
b1) mittelbar
- feste Rückzahlung, falls Liquidationsüberschuß ausreicht
b2) unmittelbar
- Rückzahlung ausschließlich abhängig vom Liquidationsüberschuß
- Mindestrückzahlung nur, falls Liquidationsüberschuß ausreicht, aber auch höher möglich
- Rückzahlung vom Liquidationsüberschuß abhängig, aber Höchstgrenze festgelegt
4.3 Weitere Vermögensrechte
Neben den soeben dargestellten wesentlichsten materiellen Rechten der Genußberechtigten existieren noch weitere Vermögensrechte, die den Genußscheininhabern zugebilligt werden können. Hier ist an erster Stelle das Bezugsrecht zu nennen. Durch Bezugsrechte haben Genußscheininhaber Anspruch auf den Bezug neuer, von der Unternehmung emittierter Wertpapiere. Bezugsrechte haben die Aufgabe, diejenigen Kapitalgeber, die Anspruch auf erfolgsabhängige Zahlungen haben, vor einer Verwässerung ihrer Ansprüche zu bewahren, denn je mehr Erfolgsanteilsberechtigte Ansprüche auf eine bestimmte Summe erheben, umso schwächer wird die Position eines jeden Einzelnen. Eine Verwässerung findet dann statt, wenn neues Kapital aufgenommen wird, dessen Kapitalgeber für die Erlangung der gleichen Rechte, wie die bereits bestehenden, weniger als den aktuellen Wert dieser Rechte aufwenden müssen. Das klassische Beispiel für eine solche Situation ist die Emission junger Aktien unterhalb des aktuellen Börsenkurses der Altaktien. Den Altaktionären wird ein den Vermögensnachteil ausgleichendes Bezugsrecht zugebilligt. Doch auch Genußscheininhaber haben Nachteile (wenn auch nur Vermögensnachteile und keine Nachteile durch Verminderung des Stimmrechtsanteils) aus der Tatsache, daß der Zuwachs des Unternehmenswertes (gekennzeichnet durch die tatsächliche Einlage der neuen Kapitalgeber) geringer ist, als der Zuwachs der Nominalansprüche dieser Kapitalgeber. Es verändert sich das Verhältnis zwischen den zu verteilenden Erträgen und der Verteilungsbasis (in Form der neu hinzugekommen Nominalansprüche plus den bestehenden Ansprüchen) zu Lasten der bisherigen Kapitalgeber.
Im Gegensatz zu Aktionären besteht für Genußscheine kein gesetzliches Bezugsrecht. Zum Schutz der Genußscheininhaber vor der erwähnten Verwässerung ihrer Ansprüche bedarf es der vertraglichen Gewährung eines Bezugsrechts. Das Bezugsrecht der Genußscheine kann sich prinzipiell auf alle Wertpapieremissionen auf Risikokapitalbasis der betreffenden Unternehmung beziehen, also Gesellschaftsanteile (bei Aktiengesellschaften problematisch, da Bezugsrechte der Aktionäre Vorrang haben), Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder andere Genußscheine.
Ein weiteres dem Bezugsrecht ähnliches Vermögensrecht der Genußberechtigten kann das Umtauschrecht sein. Hierbei besteht das Recht zwar keine neuen Wertpapiere des Emittenten im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu erwerben, sondern den bereits bestehenden Genußschein gegen andere Wertpapiere der Unternehmung zu tauschen. Das können insbesondere bei Genußscheinen mit begrenzter Laufzeit die im Rahmen der Anschlußfinanzierung ausgegebenen neuen Genußscheine sein, aber auch Aktien der Gesellschaft, wenn ein Genußschein in Form des Wandelgenußscheins begeben wurde. Dem Inhaber dieser Genußscheine wird das Recht eingeräumt, die zugrunde liegenden Aktien innerhalb einer bei Emission der Genußscheine festgelegten Frist, in einem bestimmten Verhältnis unter Zuzahlung eines bestimmten Betrages im Eintausch gegen den Genußschein zu beziehen.
Ferner ist das sogenannte Auslosungsrecht zu nennen. Dadurch wird den Genußscheininhabern im Zuge des mittelbar erfolgsabhängigen Anspruchs auf Kapitalrückzahlung vor Liquidation das Recht eingeräumt, ihre jeweiligen Genußscheine aus einem angefallenen Gewinn zur Einlösung auslosen zu lassen.
Als letztes Vermögensrecht, das den Genußrechtsgläubigern eingräumt werden kann, ist das Benutzungsrecht zu nennen. Dieses Recht kann zum einen das Recht auf Vergütung der Kapitalüberlassung ersetzen, in den meisten Fällen aber tritt es als zusätzliches Recht neben diesem auf. Der Genußscheininhaber kann durch sein Benutzungsrecht Unternehmenseinrichtungen oder Unternehmensleistungen nutzen. Dies kann gänzlich ohne Entgelt, aber meist nur zu günstigeren als den marktüblichen Konditionen gewährt werden. Ein solches Benutzungsrecht ist nur dann praktikabel, da der Kreis der Genußberechtigten klein und überschaubar ist und wird in den Fällen, da relativ große Tranchen von Genußscheinen von Emittenten mit hoher Kapitalnachfrage am Markt platziert werden, wohl eher ausgeschlossen sein.
4.4 Immaterielle Rechte der Genußscheine
Genußrechte verbriefen keine mitgliedschaftlichen Rechte und können dementsprechend den Genußscheininhabern auch keine Verwaltungsbefugnisse zugestehen. Dennoch besteht ein berechtigtes Interesse der Risikokapitalgeber, was die Genußrechtsgläubiger ihrer Natur nach sind, an einer Überwachung der für sie relevanten Unternehmensvorgänge. Um diesen Interessen zu entsprechen ist es möglich, Genußscheine mit zwei wesentlichen immateriellen Rechten auszustatten, die die Sicherung und Kontrolle der vermögensrechtlichen Ansprüche gewährleisten sollen. Diese Rechte sind nur auf Basis des individuellen Genußrechtsvertrages zu gewähren und nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es handelt sich hierbei um
a) das Recht auf Teilnahme an der Gesellschafterversammlung mit eventuell beratender Stimme, sowie
b) ein Kontrollrecht, welches einem stillen Gesellschafter gemäß § 233 HGB zusteht.
Das Teilnahmerecht ist nicht dahingehend zu verstehen, daß die Genußscheininhaber in die innere Organisation der Gesellschaft eingebunden wären, sondern sie sind lediglich als Beobachter anzusehen. Sie erhalten auf diese Weise Einblick in die Geschäftspolitik der Unternehmung und sind so in der Lage, eine Aufsicht über die Wahrung ihrer vermögensrechtlichen Ansprüche auszuüben. Meist bleibt es bei der reinen Beobachterrolle der Genußscheininhaber. Es kann aber darüber hinaus dem Genußschein das Recht einer beratenden Stimme zuerkannt werden. Sie wird nur in Ausnahmefällen durch Zustimmung der Gesellschafterversammlung erteilt und gilt auch dann nur auf eine Einzelentscheidung beschränkt, ist also in der Praxis von zu vernachlässigender Bedeutung.
Eine weitere Art des Kontrollrechts, nämlich das des stillen Gesellschafters nach § 233 HGB, kann dem Genußschein vertraglich zuerkannt werden. Dieses Recht beinhaltet im wesentlichen die Möglichkeit, eine abschriftliche Mitteilung des Jahresabschlusses zu verlangen und dessen Richtigkeit unter Einsicht der Geschäftsbücher und Papiere zu prüfen. Auch hier gilt das schon zum Benutzungsrecht Angemerkte sinngemäß: Emittiert eine Unternehmung Genußscheine in zahlenmäßig großen Umfang an ein relativ breites Publikum von Anlegern, so ist die Aufnahme von Kontrollrechten in die Genußscheinbedingungen als eher problematisch zu beurteilen. Sicherlich kann dann nicht jedem Genußberechtigten die Möglichkeit Geschäftsbücher einzusehen gewährt werden, um zu verhindern, daß Konkurrenzunternehmen lediglich durch Erwerb eines Genußscheins Einblick in die Lage des Unternehmens bekämen. Die Ausübung solcherart verwaltungsähnlichen Rechte sollte deshalb nur einem oder wenigen Vertretern der Gemeinschaft aller Genußscheininhaber vorbehalten bleiben. Abschließend ist zu diesem Punkt zu bemerken, daß die Gewährung von immateriellen, in die Unternehmensverwaltung Eingriff nehmenden Rechten in der Praxis eine eher untergeordnete Rolle spielen wird und nur bei individuell ausgehandelten Genußrechten zwischen der Unternehmung und dem Genußberechtigten zum Tragen kommen wird.
5. FAZIT
Nach allem, was bis zu dieser Stelle über Genußscheine gesagt wurde, wird es schwierig, ein klares und eindeutiges Fazit zu ziehen und in wenigen prägnanten Sätzen das Wesen der Genußscheine zusammenfassend darzustellen. Zu vielschichtig sind die Möglichkeiten, den Genußschein mit unterschiedlichsten Rechten in einer Vielzahl von Kombinationen auszugestalten.
Eindeutig ist aber, daß Genußscheine Urkunden sind, die Genußrechte verbriefen. Genußrechte sind schuldrechtliche Ansprüche gegen eine Unternehmung, die typische Vermögensrechte darstellen. Genußrechte dürfen jedoch keine Verwaltungsrechte enthalten. Die Emission von Genußscheinen ist an keine Rechtsform gebunden. Daraus ergeben sich die offensichtlichen Vorteile für den Emittenten, die in der Aufnahme von risikotragendem Kapital ohne Gewährung von Mitgliedschaftsrechte bestehen. Die Aufwendungen für dieses Kapital können bei entsprechender Gestaltung der Genußscheine zudem noch steuermindernd geltend gemacht werden. Den Vorteilen der Emittenten stehen aber korrespondierend die Nachteile der Erwerber der Genußscheine gegenüber. Deren Rechtsposition ist abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung der Genußrechte, die in den allermeisten Fällen von der Unternehmung einseitig nach deren Bedürfnissen vorgenommen wird. Es existieren keine Rechtsvorschriften, die den Schutz der Genußberechtigten in irgendeiner Form gewährleisten, etwa durch gesetzliche Definition des Genußrechtes. Es werden dadurch besondere Anforderungen an den Erwerber von Genußscheinen gestellt, der mehr als bei jedem anderen Wertpapier Emissionsbedingungen, Ausgestaltungsmerkmale sowie Gewinn- und Verlustanknüpfungsgrößen zu prüfen hat.
Abschließend lassen sich Genußscheine also als für Anleger in doppeltem Sinne risikobehaftete Papiere charakterisieren: Ihre Wertentwicklung ist mehr oder minder abhängig von Unternehmenserfolgen, über die ohnehin Unsicherheit herrscht, und darüber hinaus besteht die zusätzliche Unsicherheit eine gesetzlich nicht geschützte Rechtsposition einzugehen, zu deren Risikoeinschätzung ein erheblicher Aufwand und auch nicht zu vernachlässigender Sachverstand vonnöten ist.
Literatur: Kanders, G.: Bewertung von Genußscheinen, Duncker & Humblot, Berlin 1991
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Ursprung des Genußscheins?
Genußscheine existieren seit über 100 Jahren, wobei der erste im Jahr 1858 in Frankreich für den Suez-Kanal ausgegeben wurde. Sie dienten ursprünglich als Abfindungen für Aktionäre bei zeitlich begrenzten Konzessionsgesellschaften oder in Sanierungsfällen.
Warum erlebte der Genußschein Mitte der 80er Jahre eine Wiederentdeckung?
Die Novelle zum Kreditwesengesetz von 1985 (KWG) ermöglichte es Kreditinstituten, Genußscheine als haftendes Eigenkapital anzuerkennen, was ihre Attraktivität erhöhte.
Welche Rolle spielt das haftende Eigenkapital für Kreditinstitute?
Das haftende Eigenkapital begrenzt das Aktivgeschäft von Kreditinstituten und dient als Sicherheit für eingegangene Verbindlichkeiten (z.B. Spareinlagen). Die Bankenaufsicht überwacht dies.
Welche Voraussetzungen müssen Genußscheine erfüllen, um als haftendes Eigenkapital im Sinne des KWG anerkannt zu werden?
Genußscheine müssen u.a. bis zur vollen Höhe am Verlust teilnehmen, im Konkursfall nachrangig bedient werden, dem Institut mindestens fünf Jahre zur Verfügung stehen, und keine Besserungsabreden enthalten.
Gibt es eine gesetzliche Definition des Genußscheins?
Nein, es gibt keine allgemeingültige gesetzliche Definition. Die Bedingungen können individuell gestaltet werden, wobei jedoch verschiedene Gesetze (KWG, EStG, KStG) Bezug auf Genußscheine nehmen.
Welche Emissionsformen gibt es bei Genußscheinen?
Genußscheine können zur Kapitalbeschaffung, als Entgelt für nicht-monetäre Leistungen oder als Mitarbeiterbeteiligungen ausgegeben werden.
Was ist der Unterschied zwischen Genußschein und Genußrecht?
Genußrechte sind die vertraglich abgeleiteten Ansprüche. Erst wenn diese Rechte in einer selbständigen Urkunde verbrieft werden, spricht man von einem Genußschein. Die Verbriefung ist für die Entstehung der Rechte unerheblich.
Sind Genußrechte Mitgliedschafts- oder Gläubigerrechte?
Genußrechte sind ihrer Rechtsnatur nach Gläubigerrechte. Sie verbriefen keinen Anspruch auf Mitgliedschaft in der Unternehmung.
Wie werden Genußrechte beim Emittenten bilanziert?
Es wird unterschieden, ob das Genußrechtskapital bilanzrechtlich als Eigenkapital oder Fremdkapital anzusetzen ist. Dies hängt von der Ausgestaltung, insbesondere den Rückzahlungsbedingungen, ab. Ist eine Rückzahlung vereinbart, und zwar vor der Liquidation des Unternehmens, so handelt es sich unabhängig von Laufzeit und Rangrücktritt des Genußscheins um Fremdkapital und ist als Verbindlichkeit zu bilanzieren.
Welche steuerlichen Aspekte sind bei Genußscheinen zu beachten?
Für Kapitalgesellschaften ist § 8 (3) Satz 2 KStG entscheidend. Ausschüttungen auf Genußrechte mit Gewinn- und Liquidationserlösbeteiligung mindern das Einkommen nicht. Für Personengesellschaften sind die Ausschüttungen stets Betriebsausgaben. Die Einkünfte des Genußscheininhabers gelten als Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG).
Welche Arten von Ansprüchen begründen Genußscheine inhaltlich?
Die wichtigsten Ansprüche sind der Anspruch auf Vergütung der Kapitalüberlassung und der Anspruch auf Kapitalrückzahlung. Daneben existieren weitere Vermögensrechte (Bezugs-, Umtausch-, Auslosungsrechte) und immaterielle Rechte.
Wie kann der Anspruch auf Vergütung der Kapitalüberlassung ausgestaltet sein?
Die Vergütung kann erfolgsunabhängig (feste Verzinsung, garantierte Mindestverzinsung) oder erfolgsabhängig (mittelbare oder unmittelbare Erfolgsabhängigkeit) sein.
Welche Möglichkeiten gibt es bei dem Anspruch auf Kapitalrückzahlung?
Es wird unterschieden zwischen dem Anspruch auf Rückzahlung vor Liquidation und dem Anspruch auf Rückzahlung bei Liquidation. Beide Varianten können erfolgsunabhängig oder erfolgsabhängig ausgestaltet sein.
Was versteht man unter "Erfolg" und "Verlust" im Zusammenhang mit Genußscheinen?
Für die Definition des Begriffes "Gewinn" oder "Periodenerfolg" gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Die Größe "Periodenerfolg" kann sich an Erfolgskennzahlen orientieren, die für andere Zwecke ermittelt werden, so zum Beispiel aus dem externen Rechnungswesen das handelsrechtliche oder steuerrechtliche Periodenergebnis oder aus dem internen Rechnungswesen das Betriebsergebnis.
Welche weiteren Vermögensrechte können Genußscheine beinhalten?
Bezugsrecht (Anspruch auf Bezug neuer Wertpapiere), Umtauschrecht (Tausch gegen andere Wertpapiere), Auslosungsrecht (Auslosung zur Einlösung aus Gewinnen), Benutzungsrecht (Nutzung von Unternehmenseinrichtungen).
Welche immateriellen Rechte können Genußscheine beinhalten?
Recht auf Teilnahme an der Gesellschafterversammlung (mit beratender Stimme) und Kontrollrecht (ähnlich dem eines stillen Gesellschafters).
Was ist das Fazit zum Genußschein?
Genußscheine sind komplexe Wertpapiere mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Sie bieten Emittenten Vorteile bei der Kapitalbeschaffung, stellen aber hohe Anforderungen an die Analyse durch Erwerber aufgrund ihrer individuellen Bedingungen und fehlender gesetzlicher Schutzvorschriften. Sie sind risikobehaftete Papiere.
- Quote paper
- Sigi Schröder (Author), 1998, Der Genußschein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95299