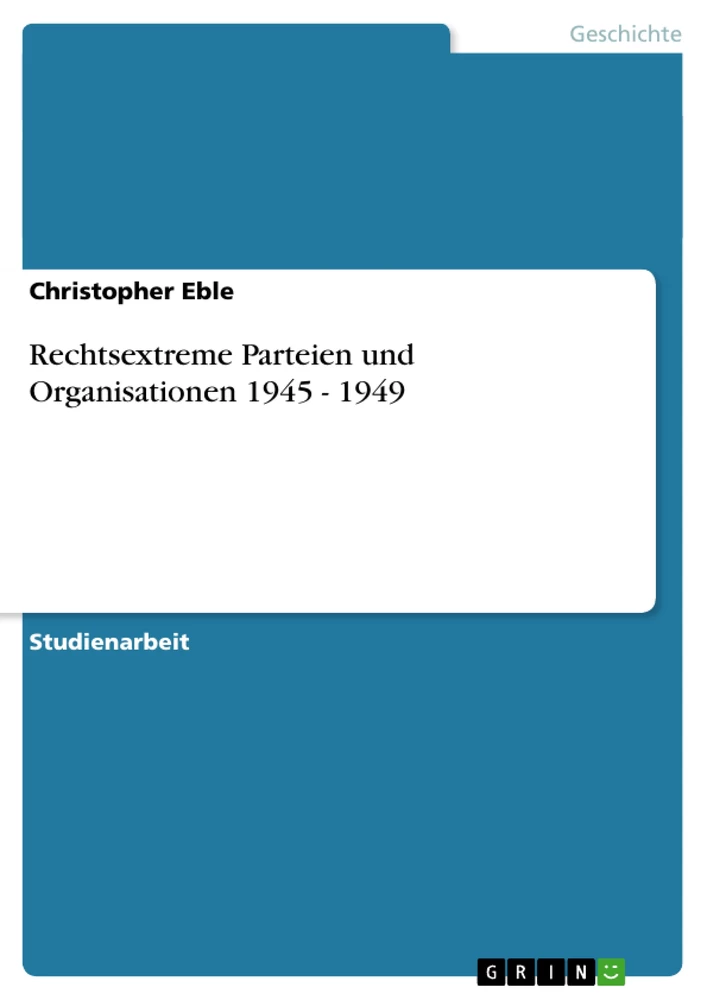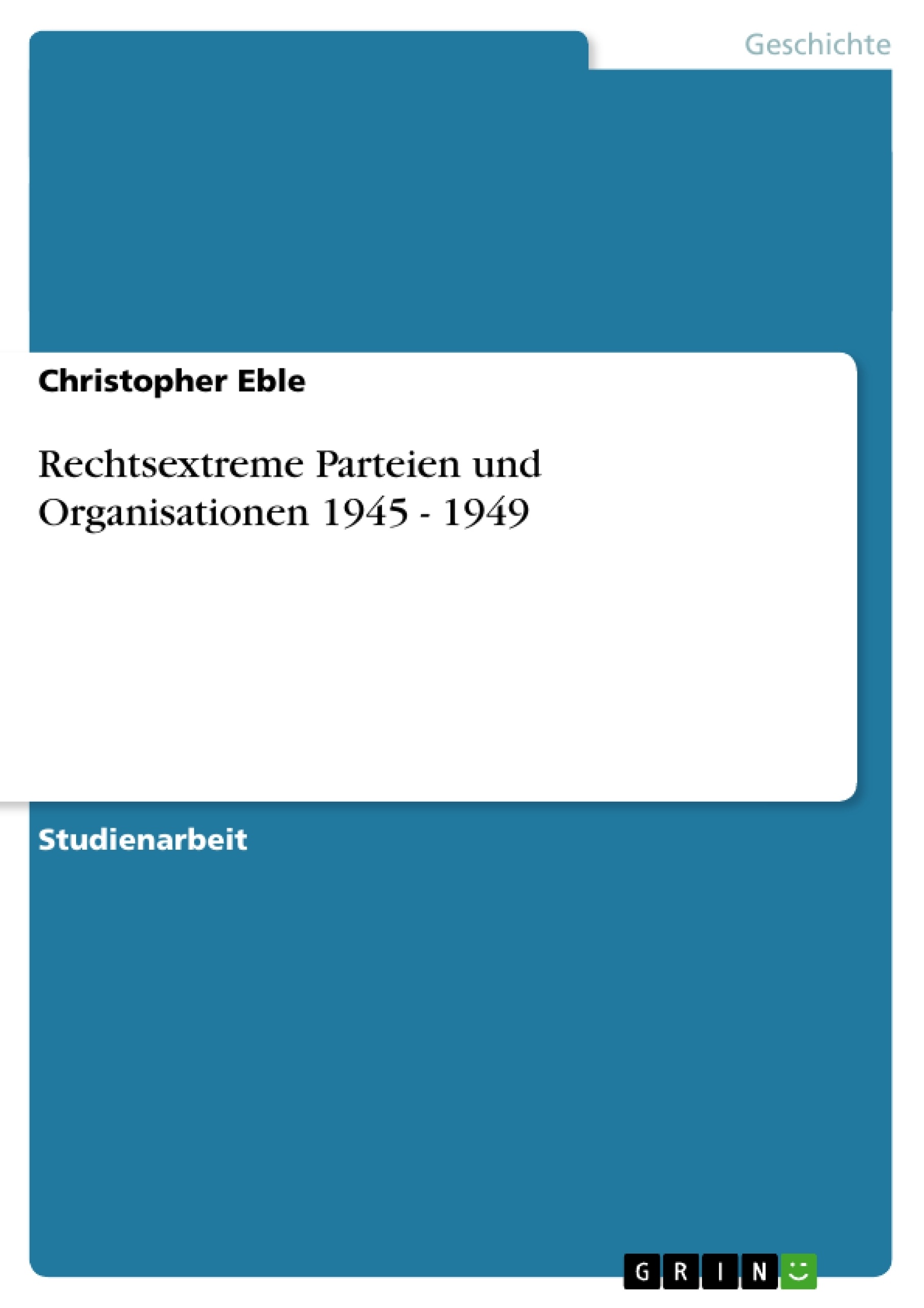Was geschah wirklich in den Trümmern des Nachkriegsdeutschlands, als sich die Asche des Dritten Reichs langsam legte? Tauchen Sie ein in eine erschütternde Analyse der politischen Strömungen am rechten Rand, die in den Jahren nach 1945 um Einfluss und Anhängerschaft kämpften. Diese aufschlussreiche Studie beleuchtet die Entstehung, Entwicklung und das Scheitern rechtsextremer Parteien in der frühen Bundesrepublik, ein oft übersehenes Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Anhand ausgewählter Beispiele wie der Deutsch Konservativen Partei – Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP) und der Wirtschaftlichen Aufbau-Vereinigung (WAV) wird ein detailliertes Bild der ideologischen Grabenkämpfe, personellen Verflechtungen und politischen Strategien dieser Gruppierungen gezeichnet. Die Analyse berücksichtigt dabei die komplexen Rahmenbedingungen der Besatzungszeit, die restriktive Lizenzierungspolitik der Alliierten und die soziale Verunsicherung der Bevölkerung. Erfahren Sie, wie ehemalige Nationalsozialisten, Monarchisten und völkisch gesinnte Kräfte versuchten, im Schatten der jungen Demokratie Fuß zu fassen, und welche Rolle interne Konflikte, wirtschaftliche Entwicklungen und die Ablehnung durch die Mehrheit der Bevölkerung dabei spielten. Diese fundierte Untersuchung bietet nicht nur eine historische Einordnung des Rechtsextremismus in der Nachkriegszeit, sondern wirft auch wichtige Fragen nach den Kontinuitäten und Diskontinuitäten rechtsextremen Denkens in Deutschland auf. Ein essentielles Werk für alle, die sich für die deutsche Geschichte, politische Ideologien und die Herausforderungen des demokratischen Neubeginns interessieren. Die Arbeit analysiert die Ursachen für das Scheitern dieser Parteien und zeigt auf, warum sie trotz anfänglicher Erfolge letztlich keine ernsthafte Gefahr für die junge Demokratie darstellten. Untersucht werden u.a. die Rolle von Schlüsselfiguren, die programmatischen Ausrichtungen, die Wählerschaft und die Einflüsse der Besatzungsmächte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den innerparteilichen Konflikten und den ideologischen Differenzen, die die rechte Szene zerrissen. Das Buch bietet somit eine differenzierte und quellenbasierte Auseinandersetzung mit einem brisanten Thema der deutschen Nachkriegsgeschichte und leistet einen wichtigen Beitrag zur Forschung über Rechtsextremismus und politische Parteien in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
I. Einführung
II. Rechtsextremismus - Analytische Deutungen
III. Die Parteien und Organisationen
III.1. Deutsche Konservative Partei - Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP)
III.2. Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV)
IV. Zusammenfassung
V. Literaturverzeichnis
V.1. Quellen
V.2. Verwendete und weiterführende Literatur
V.3. Abkürzungen
I. Einführung
Der Zweite Weltkrieg - Wohl kaum ein anderes Ereignis in der Geschichte der Menschheit hat binnen weniger Jahre solch unermeßliches Leid und Zerstörungen unvorstellbaren Ausmaßes über Europa und ganze Welt gebracht. Das totalitäre NS-Regime hat dafür gesorgt, daß Deutschland, so wie viele andere Länder auch, nach 1945 sowohl am Boden, als auch in Schutt und Asche lag. Nach der Kapitulation am 8.Mai 1945 wurde Deutschland von den alliierten Truppen besetzt und die Militärregierungen übernahmen die Funktionen des nicht mehr existierenden Staatsapparates, nicht zuletzt um einen möglichst erträglichen Zustand des öffentlichen Lebens herzustellen. Die vier Besatzungsmächte einigten sich auf die Teilung Deutschlands in vier Zonen. Die Alliierten in den Westzonen wollten dann als bald den demokratischen Aufbau in Deutschland vorantreiben. Besonders die Amerikaner und Engländer legten sehr großen Wert darauf, daß ein radikaler Schnitt gemacht werden sollte. „Re-Education“ und „Denacification“ stellten die Maxime der Besatzer dar. Eine so unsägliche Diktatur, wie die des Hitlerregimes sollte sich nicht mehr auch nur im entferntesten wiederholen. Die Entwicklungen in den vier Besatzungszonen gingen dabei aber nicht unbedingt parallel von statten.
Wie aber sollte der demokratische Aufbau in die Tat umgesetzt werden? Primär wurden sämtliche vorbelasteten Personen aus öffentlichenämtern entfernt. Des weiteren wurde ein rascher Aufbau eines Parteiensystems nach grobem Vorbild der Weimarer Republik forciert. So wurde in den verschiedenen Zonen nach und nach die Erlaubnis zur Parteiengründung gegeben. Neben den schon vor dem Krieg bestehenden Parteien wie SPD und KPD, wurden andere Parteien wie die CDU oder die FDP neu gegründet. Die Besatzungsmächte in den Westzonen waren aber darauf bedacht, nur wenige Parteien, die den freiheitlich- demokratischen Grundsätzen entsprachen, zuzulassen. Dies geschah durch eine eher restriktive Lizenzierungspolitik. Dies sollte auch verhindern, daß faschistische und nationalistische Organisationen im öffentlichen Leben wieder Fuß fassen. Die Angst vor einem Wiederaufleben von nationalsozialistischem Gedankengut, das sich in politischer Form bündeln könnte, war auf Seiten der Alliierten immer noch sehr groß. Es wurde aber auch oftmals überschätzt.1 Dennoch, nach 12 Jahren Nazidiktatur war eine gewisse Vorsicht angebracht, denn allein durch Unterzeichnung der Kapitulation waren vorherrschende Meinungen und Ideologien innerhalb der deutschen Bevölkerung sicher nicht mit einem Schlag erloschen. Schließlich wurde die Bevölkerung jahrelang gezielter Propaganda ausgesetzt. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor in der frühen Phase des Neubeginns war die große Anzahl an Menschen, die sozial deklassiert waren. So zum Beispiel die durch die Entnazifizierung arbeitslos gewordenen Beamten oder ehemaligen tatkräftigen Mitglieder der NSDAP. Zusammen mit der miserablen Wirtschafts- und Versorgungssituation nach Kriegsende war also keineswegs sicher, daß rechtsextreme Parteien und Gruppierungen nicht doch wieder an Bedeutung gewinnen würden.2 Mit Entstehung, Entwicklung und der Frage nach der Wirkung von rechtsextremen Parteien, beschäftigt sich anhand von ausgewählten Beispielen die vorliegende Arbeit. Die Entwicklung in der SBZ wurde nicht berücksichtigt.
Zur Quellen- und Literaturlage bezüglich des Rechtsextremismus nach 1945 ist folgendes zu sagen: Für den unmittelbaren Zeitraum nach Kriegsende bis zum starken Aufkommen der NPD in den Sechzigern, ist die auffindbare Literatur sehr spärlich. Es gibt eigentlich nur wenige Werke, die sich intensiv mit rechtsextremen Parteien nach 1945 auseinandersetzen und in denen intensiv Quellenforschung betrieben wurde. Die Arbeit von K. P. Tauber3 bietet eine detaillierte Einsicht in die Vorgänge des rechten Lagers nach Kriegsende. Die Ausführungen im Parteien-Handbuch4 über die rechtsextremen Parteien beziehen sich häufig auf Taubers Forschungen, wobei auch Wissenschaftler wie z.B. Hans W. Schmollinger in diesem Handbuch neue Erkenntnisse liefern. Andere Werke, wie z.B. die von U.Backes und E. Jesse5 sowie P.Dudek und H.-G. Jaschke6 geben nur kurze Überblicke über die Nachkriegsphase, welche sich dann fast ausschließlich auf die beiden oben angeführten Hauptwerke beziehen, die oft zitiert werden. Weitere aufschlußreiche Literatur sucht man fast vergebens. Auch was die Quellenlage anbetrifft, so gibt es keine publizierte Quellensammlung über Parteienmaterial der rechten Szene nach 1945 -1949. Vieles befindet sich in privatem Besitz und Nachlässen, oder in Archiven von deutschen und alliierten Behörden. So beherbergt das Bundesarchiv Koblenz einen großen Anteil an relevantem Quellenmaterial.
Zur einerähnlichen Einschätzung kommt auch Richard Stöss, der Anfang der 80er die Forschungssituation über die relevante Zeitspanne als „ ,terra incognita‘ “7 bezeichnete.
II. Rechtsextremismus - Analytische Deutungen
Bei der Beschäftigung mit rechtsextrem eingestuften Organisationen, ist ein Blick auf die einschlägigen wissenschaftlichen Definitionen, was rechtsextrem bedeutet, geboten. In der Sekundärliteratur lassen sich verschiedene Ausführungen finden, die hier nur ganz knapp angerissen werden sollen.
Stöss erklärt in seinem Buch,8 daß Rechtsextremismus „alle Erscheinungsformen des öffentlichen Lebens umfaßt, die sich gegen fundamentale Prinzipien des demokratischen Verfassungsstaates richten. Rechtsextremismus ist Demokratiefeindschaft“.9 Weitere Merkmale sind ein „übersteigerter Nationalismus“, und eine „völkisch-ethnozentrische Ideologie“.10 Auch eine Art Revisionismus, der die historischen Gegebenheiten verharmlost und relativiert, ist dem Rechtsextremismus zu eigen.11 Stöss unterscheidet zwischen einer „Alten Rechten“ und einer „Neuen Rechte“. Die „Alte Rechte“ steht in den Traditionen der Weimarer Republik, des Deutschnationalismus und des dritten Reiches. Die „Neue Rechte“ dagegen opponiert gegen diese reaktionären Einstellungen und propagiert eine Art dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus.12
Einer angemessenen Definition für wissenschaftliche Zwecke erteilen von vornherein Dudek und Jaschke eine Absage, denn für sie gilt, daß sich „weder durch formale Definitionsversuche noch durch ideengeschichtliche Bestimmungen allein ein arbeitsfähiger Rechtsextremismusbegriff entwickeln (läßt), der geeignet ist, eine Studie zur Geschichte der rechtsextremen Bewegung in der Bundesrepublik anzuleiten.“13 Auch W.Benz sieht eine gewisse Problematik bei einer Definition, aber so stellt er dennoch sog. „Grundindikatoren“ des Rechtsextremismus auf, die denen von Stössähnlich sind und noch durch Merkmale wie „Streben nach Führertum“, „Militarismus“, und der Annahme, daß der Staat und Wirtschaft konspirativ korrumpiert und gelenkt wird, ergänzt wurden.14 Alle Autoren bescheinigen dem Rechtsextremismus zu dem eine stark anti-individualistische Tendenz, sowie die skeptische Begutachtung des Parlamentarismus.
Diese Einengungen des Begriffs „Rechtsextremismus“, werden der Einordnung verschiedener Parteien nach 1945 besser gerecht. Nichtsdestotrotz, eine unscharfer Bereich bleibt immer.
III. Die Parteien und Organisationen
Die folgenden Auswahl der Parteien orientierte sich an mehreren Punkten. Zum einen war die verfügbare Literatur ein entscheidender Faktor. Zum anderen waren die beiden ausgewählten Parteien die, relativ gesehen, erfolgreichsten im Zeitraum 1945 - 1949. Zumindest, wenn man nach Indikatoren wie z.B. Wahlergebnis oder Mitgliederzahl geht. Auch ein Grund war, daß diese Parteien sich in einigen Punkten unterscheiden, aber auch gut sichtbare Parallelen aufweisen. Die in der Nachkriegszeit am erfolgreichsten agierende rechtsextreme Partei, die Sozialistische Reichspartei (SRP) wurde nicht berücksichtigt, da ihr effektivster Wirkungsraum zwischen 1951/52 lag und auch erst Ende 1949 gegründet wurde.
III.1. Deutsche Konservative Partei - Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP)
In den ersten Jahren nach Kriegsende, war es vor allem die DKP-DRP, der es vornehmlich im norddeutschen Raum gelang, eine Partei zu werden, die das extreme rechte Lager bedienen konnte. Die Partei war das Produkt einer Fusion zwischen zwei anderen Parteien. Zum einen gab es die Deutsche Aufbau Partei (DAP). Sie wurde bereits am 31.Oktober 1945 im westfälischen Gronau gegründet. Die Hauptinitiatoren dieser Partei waren Joachim von Ostau und Reinhold Wulle. Wulle hatte schon zu diesem Zeitpunkt eine bewegte Biographie. So war er für die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) Mitglied im Reichstag und gründete aus ihr heraus mit anderen 1922 die Deutschvölkische Freiheitspartei (DFVP).15 Wulle selbst galt als vehementer Antisemit und Anhänger der monarchischen Idee.16 Zwar war er ein Gegner Hitlers im dritten Reich, doch seine nationalistisch, völkischen Einstellungen waren auch nach 1945 noch präsent. Doch schon in der ganz frühen Phase der Partei entstanden
Unstimmigkeiten zwischen Wulle und von Ostau, die später noch für viel mehr Unruhen sorgte. So bekannte sich Wulle zum rechten Lager der ehemaligen Weimarer Republik. Von Ostau aber bemängelte die unattraktive Wirkung diese konservativen Haltung auf jüngere Bürger. Von Ostau fokusierte sich zudem auch auf die ehemaligen Naziaktivisten.17 Die DAP war Anfang 1946 bereits in 21 Kreisen der britischen Zone registriert. Von Ostau und Wulle fusionierten dann schnell auch mit anderen rechten Splittergruppen im Raum Hamburg, Hannover und Lübeck.18
Die andere Fusionspartei war die Deutsche Konservative Partei. Sie bestand zum größten Teil aus einer Ansammlung von alten DNVP-Kadern, die versuchten, diese Partei wieder auf die Beine zu stellen.19 Der Entwicklungsschwerpunkt der DKP lag in Schleswig-Holstein. Von dort aus leiteten Egger Rasmuß und Hermann Mertens die Reorganisation der Partei und der ehemaligen DNVP-Mitglieder. Aber die Aktivitäten in Form eines Bürgerblocks beschränkten sich zunächst auf Lokalebene. Erst im März 1946 bemühte man sich um eine zonenweite Lizenzierung. Generell hatte die Partei, die sich laut Jäger als „christlichen Konservatismus“20 praktizierend verstand, mit vielen Behinderungen seitens der britischen Militärregierung zu kämpfen. Vielerorts wurden erteilte Lizenzen wieder zurückgenommen oder gleich von Anfang an versagt.21 Die angestrebte Vereinigung mit der DAP wurde ebenfalls in diesem Monat vorangetrieben. Am 22.März 1946 wurde die Fusion in Essen offiziell. Der Name der Partei sollte laut Vereinbarung Deutsche Konservative Partei lauten. Aus dem Vereinigungsprotokoll geht hervor, daß „der Zweck der Vereinigung [...], die Schaffung einer einheitlichen großen Rechtspartei (sei), in der alle konservativ, christlich und national eingestellten Deutschen ihre politische Heimat finden sollen.“22 Die Schaffung einer „großen Rechten“ neben dem Bürgerblock war also mit Ziel dieser Fusion.
Eine echte programmatische Grundlage der DKP wurde in der Phase nach der Fusion erarbeitet. Entscheidende Mithilfe bei der Ausgestaltung erhielten die Parteioberen durch den ehemaligen Vorsitzenden der DNVP Otto Schmidt-Hannover.23 Dieses Programm ist auch eine versuchte Synthese von DAP und DKP Ansichten. Generell gesehen versuchte die DKP an den „monarchistisch orientierten preußischen Konservatismus“24 anzuknüpfen. Im „Manifest der Rechten“, so die Bezeichnung der o.g. programmatischen Synthese, wird an erster Stelle die Berufung auf eine christliche Basis für das gesellschaftliche Leben gepocht.25 Weiterhin wird die Monarchie als die beste Staatsform gepriesen und eingefordert. Monarchie aber, so ist es im Programm zu lesen, basierend auf eine demokratische Verfassung.26 Diese Aussagen27 bildeten aber schon die wenigen Übereinstimmungen in den Vorstellungen der beiden Fusionsparteien. Dissens ergab sich bei der Meinung über Wirtschaftspolitik, über den Grad der konservativen Prägung, bis hin zu Streitereien über den endgültigen Namen der Partei. Gerade die Parteispitze in Niedersachsen unter von Ostau paßte der Namensteil „konservativ“ nicht.28 In der Literatur wird darauf hingewiesen, daß dieser Etikettenstreit als Symbol für die schon sehr früh auftretenden inhaltlichen Divergenzen steht. Diese führten in der Zeit zwischen 1946 und 1949 zu heftigen Kontroversen, die dann auch zum Ende der Partei führten.29
Auf dem Zonenparteitag am 27.Juni 1946 konnte sich dann auch der eher pro-nazistische Flügel um von Ostau mit einer Namensänderung durchsetzten. Von nun an hieß die Partei Deutsche Rechtspartei (Konservative Vereinigung). Damit war schon der erste markante Schritt getan, der von einer Anfangs an preußischem Vorbild orientierten konservativen Partei mit völkischen Tendenzen, hin zu einer am dritten Reich orientierten rechtsextremen Partei ging. Dennoch, die zonale Parteiführung um Hermann Klingspor war immer noch den konservativen Kräften zuzurechnen, die die Disharmonien in der Partei aber negierten.30
Bei den Landtagswahlen 1946/47 zeigte sich, daß die moderaten, konservativen Parteiaktivisten in Schleswig-Holstein mit 3,1% noch das beste Ergebnis einfuhren konnten. In anderen Ländern wie Niedersachsen blieb die DRP(KV) weit hinter ihren Erwartungen zurück.31 Dies lag nicht zuletzt am schlechten Organisationsgrad der Partei. Für mehr aufsehen erregten aber die Ergebnisse in Niedersachsen um die Gruppe von Leonhard Schlüter und Adolf von Thadden, die wie von Ostau,32 den rechtsextremen, nationalsozialistischen Flügel repräsentierten. Sie errang in Göttingen 10,68%. Dieser Wahlerfolg stärkte den Radikalen den Rücken.33 Ein weiterer beeindruckender Wahlerfolg wurde bei den Regionalwahlen im November 1948 in Wolfsburg erreicht, als die dortige DRP 17 von 25 Sitzen im Stadtrat errang.
Zu diesem Zeitpunkt war die innere Spaltung der Partei schon weit fortgeschritten. Auf der Zonentagung in Hamburg am 2.April 1948 wurde eine erneute Namensänderung der Partei beschlossen. Sie hieß nun Deutsche Rechtspartei - Deutsche Konservative Partei. Den jeweiligen Ländern wurde es überlassen, unter welchem Namen sie bei Wahlen antreten.
Den Höhepunkt in ihrer Wirkung erzielte dann 1949 bei den Bundestagswahlen der Landesverband Niedersachsen.34 Er zog dank seiner 8,1% mit fünf Sitzen in den Bundestag ein. Dies geschah mit Wahlaussagen wie der Herstellung des Deutschen Reichs in den alten Grenzen, Stopp der Entnazifizierung und Rehabilitierung ehemaliger NS-Aktivisten. Auch machten sie Stimmung gegen die sog. „Lizenzparteien“. Die Machtverhältnisse innerhalb der DKP-DRP wurden somit immer weiter zugunsten des niedersächsischen Landesverband verschoben.35 Die jüngeren Kräfte in der Partei übernahmen das Ruder immer mehr und steuerten in Richtung Neofaschismus, der das Potential ehemaliger Aktivisten und Soldaten auffangen sollte. Ehemalige Programmpunkte der DKP-DRP, angelehnt an die DNVP, wurden nun offen abgelehnt.36
Das unvermeidbare Ende der Partei ergab sich als, angestrebte Verhandlungen mit der Deutschen Partei (DP) im Vorfeld der Bundestagswahl scheiterten. Die Divergenzen zwischen altkonservativem und neonazistischem Flügel innerhalb der DKP-DRP waren zu groß. Zwar konnte die konservative Gruppe noch einen Erfolg feiern, in dem sie die rechtsextremen Dorls, Krüger und Remer, die erst kurz vor der Bundestagswahl dazu gestoßen waren und als „symbols of the party’s radicalization“37 angesehen wurden, aus der Partei ausschlossen.38
Aber die fusionstechnischen Entscheidungen trafen „die Niedersachsen“. Dieser Verband fusionierte nämlich mit dem hessischen Verband der NDP um Heinrich Leuchtgens. Trotz vehementer Proteste des nationalistisch-konservativen Flügels, der eine weitere Parteispaltung verhindern wollte.39 Auch im Bundestag bildeten sie mit Leuchtgens zusammen, er war über die FDP-Liste in Hessen in den Bundestag gekommen, ein Gruppe: Die Nationale Rechte.40 Die Partei war jetzt am Ende. Die restlichen Mitglieder des DNVP-Lagers wechselten im Sog des Auflösungsprozesses fast gänzlich zur DP über. Formell bestand die Partei aber weiter bis zum 28.7.1953.
III.2. Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV)
In der Forschungsliteratur wir die WAV zu meist als rechtsextreme Partei bezeichnet. Doch im Gegensatz zur DKP-DRP stellt sich dieser Radikalismus in einer anderen Art und Weise dar. So wurde im Vergleich zur DKP-DRP, aber auch zur NDP, die Partei nicht von ehemaligen Nationalkonservativen im DNVP-Stil gegründet, sondern von einer einzelnen Person, die dem wirtschaftlichen Bereich zuzurechnen ist und der sich selbst als Gegner des Nationalsozialismus betrachtete: Alfred Loritz, ein ehemaliges Mitglied der Wirtschaftspartei in der Weimarer Republik.41
Der rechtsextreme Charakter der Partei entstand durch ihre anti-demokratische Gesinnung und durch das im höchsten Maße populistische und demagogische Verhalten ihres exzentrischen Parteiführers Loritz. Rassische und Völkische Ideologien waren ursprünglich nicht auf den Fahnen der Partei gestanden.
Die Partei selbst erhielt ihre erste Lizenz zur politischen Betätigung im Stadt- und Landkreis München am 8.12.1945. Im darauffolgenden Jahr wurde sie sogar noch vor der FDP als vierte Landespartei von den amerikanischen Behörden lizenziert. Bayern wurde somit zum einzigen Betätigungsfeld dieser im Verlauf ihrer Entwicklung höchst heterogenen Partei. Das einzige schriftliche Parteiprogramm datiert aus dem Jahr 1945.42 Grob zusammengefaßt handelt es sich um wirtschaftliche Forderungen, die besonders den Mittelstand betreffen. Das Programm appelliert zudem an Arbeiter und Bauern und lehnt die repräsentative Demokratie ab.43 Die Ablehnung des Nationalsozialismus - Aufruf „zur Zusammenarbeit aller antinazistisch gesinnten Männer und Frauen“ oder Bezeichnung dessen als „Todfeind aller Werktätigen“44 - wird aber von Forschern z.T. als Fassade angesehen.45 Loritz, der „ ,weiße Hitler‘ “,46 wollte der Hoffnungsträger derer werden, die durch die Folgen des Krieges stark betroffen waren und finanziell schlecht situiert waren. Loritz bediente sich der latenten Anfälligkeit dieser sozial angeschlagenen Schichten für Demagogie, vollmundige Versprechungen und reißerischen Populismus.47 Diese Taktik Loritz‘ war mitverantwortlich dafür, daß er in nationalsozialistisches Fahrwasser geriet, trotz seiner oberflächlichen Ablehnung des dritten Reichs.
Daß die Vorgehensweise der WAV, was gleichbedeutend war mit den Absichten von Loritz, der die Partei mit eiserner Hand und am Rande jeglicher demokratischer Formen führte,48 Erfolg hatte, zeigten die Erfolge bei Wahlen in den ersten Jahren. So wurde die WAV mit 8 Mandaten in die bayerische verfassungsgebende Landesversammlung gewählt. In den bayerischen Landtag konnte sie immerhin mit 7,4% der Stimmen einziehen. Loritz erhielt sogar einen Ministerposten in der Regierung Ehard. Er wurde Sonderminister für Entnazifizierungsfragen. Besonders der nationale Flügel in der WAV sah darin eine Chance sich für ehemalige Nazis einzusetzen und sie vor der Justiz zu schützen. Im Landtag selbst fiel die Partei aber eher durch rüdes Gehabe auf. Loritz lancierte oft wilde Angriffstiraden und betrieb fortlaufend Demagogie. Dennoch wurde dieses Verhalten, trotz erheblichen Protestes des Landtags, von der Militärregierung geduldet.49 Nach einer längeren Durststrecke, nicht zuletzt durch die immer heftiger werdenden Querelen und Streitereien, in der Öffentlichkeit, konnte sich die WAV bei den ersten Wahlen zum deutschen Bundestag eindrucksvoll mit 14,4% der Stimmen in Bayern zurückmelden. Waren aber bei den ersten Erfolgen 1946 die Mitttelschichten die Hauptwähler, so basierte der Erfolg von 1949 auf dem zuvor eingegangen Wahlbündnis mit dem Neubürgerbund, der die Interessen der Vertriebenen und Flüchtlinge in Bayern vertrat. Da diese durch die Lizenzierungspolitik der Alliierten keine eigene Partei gründen durften, wurden Vertreter des Neubürgerbundes auf die Liste der WAV gesetzt. Die in Bayern in großer Zahl lebenden Vertriebenen gaben deshalb ihre Stimme der WAV.50 Der Einfluß der WAV auf politische Entscheidungen im Bundestag war aberäußerst gering. Woller führt dies auf „mangelnde intellektuelle Potenz“, den „Primat der Propaganda“ und den fortgeschrittenen Zerfall der Partei zurück.51
Der Zerfall war fast schon vorprogrammiert, denn der Anfang der WAV stand schon unter keinem guten Stern. Zu verschieden waren die Personengruppen, die in der WAV eine Art organisatorisches Dach gesucht und gefunden hatten. Das Sammelbecken, in dem Nationalisten, ehemalige Nazis, Kleinbürger, Bauern, Arbeiter und Flüchtlinge schwammen, kann auch als „Auffangbecken ,verhinderter‘ Landesparteien“52 angesehen werden. Eine Partei also für alle die, die aufgrund fragwürdiger Einstellungen und Ideologien keine Lizenz von den amerikanischen Behörden erhielten. Die Partei um Loritz „attracted thousands of ‘little‘ Nazis, who found safety and even patronage under his protective wings.“53 Eine dieser profaschistischen Gruppen die besonders viel Unruhe stiftete, war die um Karl Meißner.54 Gerade mit Meißner lieferte sich Loritz heftige Gefechte um die Parteiführung. Es kam sogar soweit, daß der selbst sehr heterogene Flügel um Meißner55 auf sehr fragwürdigem Wege Loritz als Parteivorsitzenden absetzte, nur um von diesem dann selbst aus der Partei ausgeschlossen zu werden. Die Spitze der Intrigen war, daß Meißner der Staatsanwaltschaft Hinweise vorlegte, die beweisen sollten, daß Loritz an illegalen Schwarzmarktgeschäften beteiligt gewesen sein soll. Daraufhin wurde Loritz verhaftet und angeklagt.56 Zwar konnte er flüchten und im Raum München untertauchen, aber in der Partei hatte er in dieser Phase nichts mehr zu sagen. Dennoch gelang es ihm durch Mittelsmänner , Meißner wieder aus dem Amt des Parteivorsitzenden zu verdrängen. Dieser gründete nach langem hin und her seine eigene rechtsextreme Partei, nämlich den Deutschen Block (DB).
Diese eine Episode aus der sehr bewegten Entwicklungsgeschichte zeigt, wie sehr die WAV von dauernden Querelen gebeutelt war. Diese anhaltenden Differenzen, auch nach Meißners Ausscheren aus der Partei, verhinderten das Entstehen von festen Organisationstrukturen. Auch ein Programm, daß der fortgeschrittenen Entwicklung in Deutschland Rechnung trug, wurde nicht entwickelt. Das Programm von 1945 war und ist die einzige inhaltliche Erklärung der Partei bzw. des Demagogen Alfred Loritz. Zur Illustration der absoluten Heterogenität und Disharmonien der Partei dient die Tatsache, daß während der ersten Periode des Bayerischen Landtages die dreizehn Mandatsträger der WAV insgesamt 65 Fraktionswechsel vornahmen, einmal sogar mit dem Titel „WAV-Opposition“.57
Nachdem sich in den Jahren 1946/47 bereits die bürgerlichen Gruppierungen von der Partei distanziert hatten,58 und mit Meißner dann der rechtsextreme Flügel, brach die Partei 1948 völlig ein. Bei den Kommunalwahlen zogen die radikalenäußerungen eines Loritz nicht mehr. Die wirtschaftliche Lage Deutschlands war auf dem Wege der Besserung, so daß reine Agitation gegen das bürgerliche Lager, gepaart mit keinerlei vernünftigen Vorschlägen zur politischen Gestaltung des Landes, bei der Wählerschaft auf keine Resonanz gestoßen ist. Bei der Kommunalwahl 1948 erreichte sie nur enttäuschende 1,8%. Zwar konnte durch das oben schon beschriebene Wahlbündnis mit dem Neubürgerbund ein fast sensationeller Wahlerfolg gefeiert werden (1949 Bundestagswahl), doch die inneren Strukturen waren schon so irreversibel zerrüttet, daß Alfred Loritz zeitweise als alleiniger Vertreter seiner WAV- Fraktion im Deutschen Bundestags übriggeblieben war. Die anti-demokratische Bewegung von Alfred-Loritz sah sich somit ihrem unweigerlichen Ende gegenüber.
IV. Zusammenfassung
Die zwei exemplarisch behandelten Parteien stehen in gewisser Weise als Paradigma für die Bedeutung der rechtsextremen Parteien in der unruhigen Zeit zwischen alliierter Besatzungsherrschaft und Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die antidemokratisch eingestellten Parteien konnten nämlich zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für den demokratischen Neuaufbau des Landes dar. Sie waren zu schwach in ihren Organisationsstrukturen, um ein wirkungsvolles Ausmaß zu erreichen. Neben der mangelnden finanziellen Mitteln und schlechten Kommunikationswegen, war auch die relativ geringe Unterstützung der deutschen Bevölkerung mitverantwortlich für den spärlichen Verbreitungsgrad in Deutschland. Die geplante „Nationale Opposition“ zu den verschmähten bürgerlichen Parteien konnte nie wirklich errichtet werden. Die Menschen in Deutschland hatten nach der grauenhaften Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und den Jahren der Diktatur zuvor, kein Interesse an rechtsextremen Gedankengut. Die wenigen unverbesserlichen Altnazis waren in ganz klarer Minderzahl. Als Beweis für die Ablehnung der rechten Parteien seitens der Bevölkerung kann das Ergebnis der Bundestagswahl 1949 dienen, als ca. 75% der WählerInnen ihre Stimme den bürgerlichen Parteien um CDU und SPD gaben. Ein klares Votum für den eingeschlagenen demokratischen und wirtschaftlichen Kurs in Deutschland. Ein weiterer Faktor, der die Parteien in die politische Bedeutungslosigkeit manövrierte, war die sehr restriktive Lizenzierungspolitik der Alliierten. Zwar erhielten auf Kreisebene verschiedene Gruppierungen die Lizenz, aber auf Landesebene scheiterten die meisten. Offenes Kokettieren mit nationalistisch-völkischen Ideologien wurde nicht toleriert.
Aber auch die innerparteilichen Querelen und programmatischen Streitereien waren mit Ursache für die schlechte Entwicklung der Rechten. Da kämpften zum einen Nationalkonservative gegen Neofaschisten oder, wie im Falle der WAV, plumpe demagogisch-antidemokratische Kräfte gegen Vertriebeneninteressen. Die politische Rechte in Deutschland war hoffnungslos zerstritten und somit keine ernsthafte Konkurrenz für das bürgerliche Lager. Selbst in der Zeit unmittelbar nach Kriegsende, als Hungersnöte und die schlechte Situation im Arbeits- und Wirtschaftssektor ein mögliches Wählerpotential für die rechtsextremen Parteien konstituierte, konnten die Parteien bis auf einzige Erfolge auf lokaler Ebene kein Kapital daraus schlagen. Mit der Besserung der wirtschaftlichen Lage durch die Währungsreform, sanken die Chancen auf Erfolg noch tiefer. Die antidemokratischen Parteien waren somit kein entscheidender Einfluß auf der politischen Bühne. Selbst wenn sie, wie WAV und DRP, sogar im Bundestag vertreten waren, fielen sie lediglich durch Agitation und unkonstruktive Aussagen auf, wie zum Beispiel mit der Forderung des Abgeordneten der DRP, Dr.Richter, daß neben den Länderfahnen der BRD vor dem Bundeshaus auch die Flaggen der Gebiete Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Danzig und Schlesien gehißt werden sollen.59
Die Angst der Alliierten, nach Kriegsende auf eine öffentliche Landschaft zu treffen, die unter Umständen wieder aufkeimender rechtsextremistischer Propaganda hinterherläuft, erwies sich zum Glück als unbegründet. Nach 1949 konnte lediglich die SRP noch einmal für aufsehen sorgen, welche dann aber vom BVG als verfassungswidrig eingestuft und verboten wurde. Erst in den sechziger Jahren wurde Rechtsextremismus durch die Nachfolgeorganisation der DReP, die NPD, wieder ein unerwünschtes Phänomen in der Bundesrepublik.
V. Literaturverzeichnis
V.1. Quellen
Dudek, P./Jaschke, H.: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Zur Tradition einer besonderen politischen Kultur, Band 2, Dokumente und Materialien, Opladen 1984 Verhandlungen des deutschen Bundestags, I. Wahlperiode 1949. Stenographische Berichte Band I, Bonn 1950
V.2. Verwendete und weiterführende Literatur
Backes, Uwe/Jesse, Eckhard: Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland (Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 272), 4. Völlig überarb. und aktual. Auflage, Bonn 1996
Backes, Uwe/Jesse, Eckhard: Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I: Literatur, Köln 1989
Benz, Wolfgang: Organisierter Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Einüberblick 1945 - 1984, in: GWU 38(1987) S.90 - 104
Büsch, Otto/Furth, Peter: Rechtsradikalismus im Nachkriegsdeutschland. Studienüber die „ Sozialistische Reichspartei “ (SRP) (Schriften des Instituts für Politische Wissenschaft, Bd. 9) Berlin/Frankfurt a. M. 1957
Deutsches Institut für Zeitgeschichte(Hrsg.): Die westdeutschen Parteien 1945 - 1965. Ein Handbuch, Berlin 1966
Dudek, Peter/Jaschke, Hans -Gerd: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in der BRD. Zur Tradition einer besonderen politischen Kultur, Band 1, Opladen 1984
Fenske, Hans: Deutsche Parteiengeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Paderborn 1994
Fisher, Stephen L.: The Minor Parties of the Federal Republic of Germany. Toward a comperative theory of minor parties, Den Haag 1974
Jenke, Manfre d: Verschwörung von rechts? Ein Berichtüber den Rechtsradikalismus in Deutschland nach 1945, Berlin 1961
Knütter, Hans -Helmuth: Ideologien des Rechtsradikalismus im Nachkriegsdeutschland. Eine Studieüber die Nachwirkungen des Nationalsozialismus (Bonner Historische Forschungen, Bd. 19) Bonn 1961
Lange, Max et al .: Parteien in der Bundesrepublik. Studien zur Entwicklung der deutschen Parteien bis zur Bundestagswahl 1953 (Schriften des Instituts für Politische Wissenschaft, Bd.6) Stuttgart/Düsseldorf 1955
Ritter, Gerhard A./Niehuss, Merith: Wahlen in Deutschland 1946 - 1991. Ein Handbuch, München 1991
Rowold, Manfred: Im Schatten der Macht. Zur Oppositionsrolle der nicht-etablierten Parteien in der Bundesrepublik (Bonner Schriften zur Politik und Zeitgeschichte, Bd.9) Düsseldorf 1974
Stöss, Richard: Die extreme Rechte in der Bundesrepublik. Entwicklung - Ursachen - Gegenmaßnahmen, Opladen 1989
ders.(Hrsg.): Parteien-Handbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945 - 1980, 2 Bd. (Schriften des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin, Bd. 38) Opladen 1983
Schmollinger, Horst W.: Die Deutsche Konservative Partei - Deutsche Rechtspartei, in: Stöss, R.(Hrsg.).: Parteien-Handbuch, S.982 - 1024
ders.: Der Deutsche Block, in: Stöss, R.(Hrsg.): Parteien-Handbuch, S.807 - 847
Tauber, Kurt P.: Beyond eagle and swastika. German nationalism since 1945, 2.Bd., Middletown 1967
Sontheimer, Kurt: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933, München 1962
Winge, Sören: Die Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV) 1945-53. Entwicklung einer „ undoktrinären “ politischen Partei in der Bundesrepublik in der ersten Nachkriegszeit, Stockholm 1976 (Diss. Uppsala 1976)
Woller, Hans: Die Loritz-Partei. Geschichte und Struktur der Wirtschaftlichen Aufbau- Vereinigung 1945 -1955 (Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 19) Stuttgart 1982
ders.: Die Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung, in: Stöss,R.(Hrsg.): Parteien-Handbuch, S.2458 - 2481
V.3. Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Vgl. U.Backes/E.Jesse: Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1996[4], S.62
2 Vgl. M. Jenke: Verschwörung von rechts? Ein Bericht über den Rechtsradikalismus nach 1945, Berlin 1961, S.47ff.
3 K.-P. Tauber: Beyond eagle and swastika. German nationalism since 1945, 2 Bd., Middletown 1969
4 R. Stöss(Hrsg.): Parteien-Handbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945 - 1980, 2 Bd. (Schriften des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin, Bd. 38) Opladen 1983
5 U.Backes/E.Jesse: Politischer Extremismus
6 P. Dudek/H. Jaschke: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in der BRD, 2 Bd., Opladen 1984
7 H. Woller: Die Loritz-Partei. Geschichte und Struktur der Wirtschaftlichen Aufbau-Vereinigung 1945 -1955 (Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 19) Stuttgart 1982, S.10
8 R.Stöss: Die extreme Rechte in der Bundesrepublik. Entwicklung - Ursachen - Gegenmaßnahmen, Opladen 1989
9 Ebd., S.18
10 Ebd., S.19
11 Vgl., ebd. S.30
12 Vgl., ebd. S.27ff, Kritisch dazu vgl. U.Backes/E.Jesse: Politischer Extremismus, S.74ff.
13 P.Dudek/H.Jaschke: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus,Bd.1, S.25
14 W.Benz: Organisierter Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Überblick 1945 - 1984, in: GWU 38(1987), S.91. Eine rechtähnliche Auflistung findet sich schon bei H.Knütter: Ideologien des Rechtsradikalismus im Nachkriegsdeutschland (Bonner Historische Forschungen, Bd. 19) Bonn 1961, S.17
15 Zur Biographie von Wulle und von Ostau vgl. H.Schmollinger: Die Deutsche Konservative Partei - Deutsche Rechtspartei, in: R.Stöss(Hrsg.): Parteien-Handbuch, S.985 Anm. 14 und 15
16 Vgl. K. Tauber: Beyond eagle and swastika, S.48.
17 Vgl. P. Dudek/H. Jaschke: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus, Bd.1, S.183
18 Vgl., ebd. S.55
19 Vgl. H. Schmollinger: Die DKP-DRP, S.982ff.
20 P. Dudek/H. Jaschke: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus, Bd.1, S.184
21 Vgl., ebd. S.185
22 Aus Vereinigungsprotokoll vom 22.3.1946, zitiert nach H. Schmollinger: Die DKP-DRP, S.988
23 K. Tauber: Beyond eagle and swastika, S.56
24 H. Schmollinger: Die DKP-DRP, S.989
25 Vgl. Manifest der Rechten, in: P. Dudek/H. Jaschke: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus, Bd.2, S.36
26 Vgl. ebd.
27 Schmollinger weist darauf hin, daß öffentlichenäußerungen und Schriftstücke unter dem Aspekt zu betrachten sind, daß die Auflagen der Alliierten zur Erhaltung der Lizenz beachtet werden mußten. Vgl. H. Schmollinger: Die DKP-DRP, S.989ff.
28 Vgl. K. Tauber: Beyond eagle and swastika, S.55
29 H. Schmollinger: Die DKP-DRP, S.988ff.
30 K. Tauber: Beyond eagle and swastika, S.63
31 Zahlen zu den Wahlen vgl. H. Schmollinger: Die DKP-DRP, S.1012
32 von Ostau wurde im März 1947 aus der Partei ausgeschlossen vgl. K. Tauber: Beyond eagle and swastika S.63
33 Vgl. P. Dudek/H. Jaschke: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus, Bd.1, S.189
34 Eine landesweite Lizenz erhielt die DKP-DRP in der britischen Zone erst zwei Wochen vor der Wahl.
35 Vgl., H. Schmollinger: Die DKP-DRP, S.1005
36 Vgl., P. Dudek/H. Jaschke: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus, Bd.1, S.193
37 K. Tauber: Beyond eagle and swastika, S.97
38 Dies waren die Gründer der Sozialistischen Reichspartei (SRP)
39 Vgl., K. Tauber: Beyond eagle and swastika, S.737
40 Vgl. Verhandlungen des deutschen Bundestags, Stenographische Berichte Band 1, Bonn 1950, S.13
41 Ausführliche Biographie zu Loritz bei H.Woller: Die Loritz-Partei, S.22ff
42 Zu finden in, Deutsches Institut für Zeitgeschichte (Hg.): Die westdeutschen Parteien 1945 - 1965. Ein Handbuch, Berlin 1966, S.511ff.
43 Vgl. ebd., S.511
44 Zitate ebd.
45 Vgl. dazu A.Bauer: Die WAV, der gescheiterte Versuch einer mittelständischen Massenpartei, in: M.Lange et al.: Parteien in der Bundesrepublik (Schriften des Instituts für Politische Wissenschaften, Bd.6) Stuttgart 1955, S.483ff.; ebenso Deutsches Institut für Zeitgeschichte: Die westdeutschen Parteien, S.506
46 H.Woller: Die Loritz-Partei, S.8
47 Vgl. ebd.
48 Vgl., H.Woller: Die Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung, in: R. Stöss (Anm. 6), S.2463
49 Vgl., M. Jenke: Verschwörung von rechts, S.51
50 Zahlen dazu, vgl. H. Woller: Die Loritz-Partei, S.125
51 Zitate ebd. S.130
52 Ebd. S.34
53 K. Tauber: Beyond eagle and swastika, S.102
54 Zur Biographie siehe H.Schmollinger: Der Deutsche Block, in:R.Stöss (Anm. 6), S.806f Anm.1
55 Vgl., Woller: Die WAV, S.2464
56 Vgl., K.Tauber: Beyond eagle and swastika, S.103
57 Vgl. S.Winge: Die Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV) 1945-53. Entwicklung einer „undoktrinären“ politischen Partei in der Bundesrepublik in der ersten Nachkriegszeit, Stockholm 1976 (Diss. Uppsala 1976), Abb.1 S.78
58 Vgl. H.Woller: Die Loritz-Partei, S.65
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text befasst sich mit rechtsextremen Parteien und Organisationen in Deutschland in der Nachkriegszeit von 1945 bis 1949, kurz vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Er analysiert ihre Entstehung, Entwicklung, ihren Einfluss und ihre Bedeutung in dieser Übergangsphase.
Welche Parteien werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf zwei Parteien: die Deutsche Konservative Partei - Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP) und die Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV). Die Analyse umfasst ihre Gründungsgeschichte, programmatischen Ausrichtungen, Wahlergebnisse, interne Konflikte und ihren Einfluss auf die politische Landschaft.
Welche analytischen Deutungen des Rechtsextremismus werden vorgestellt?
Der Text bietet einen Überblick über verschiedene wissenschaftliche Definitionen des Rechtsextremismus, wobei er sich auf Autoren wie Stöss, Dudek, Jaschke und Benz bezieht. Dabei werden Merkmale wie Demokratiefeindschaft, übersteigerter Nationalismus, völkisch-ethnozentrische Ideologie, Revisionismus, Anti-Individualismus und eine skeptische Haltung gegenüber dem Parlamentarismus hervorgehoben.
Wie wird die Quellen- und Literaturlage zum Thema Rechtsextremismus in der Nachkriegszeit bewertet?
Die Arbeit stellt fest, dass die Literatur für den Zeitraum von 1945 bis zu den 1960er Jahren spärlich ist. Es werden Werke von K.P. Tauber und das Parteien-Handbuch als wichtige Quellen genannt, während andere Arbeiten eher Überblicke bieten. Auch die Quellenlage wird als schwierig beschrieben, da vieles in Privatbesitz oder Archiven liegt.
Welche Rolle spielten rechtsextreme Parteien in der frühen Nachkriegszeit?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass rechtsextreme Parteien zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr für den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands darstellten. Ihre Organisationsstrukturen waren zu schwach, ihre finanzielle Mittel begrenzt und die Unterstützung in der Bevölkerung gering. Innere Querelen und programmatische Streitereien trugen ebenfalls zu ihrer Bedeutungslosigkeit bei.
Was waren die Hauptursachen für das Scheitern rechtsextremer Parteien in dieser Zeit?
Zu den Hauptursachen zählen die restriktive Lizenzierungspolitik der Alliierten, das mangelnde Interesse der Bevölkerung an rechtsextremem Gedankengut nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der NS-Diktatur, sowie die internen Konflikte und programmatischen Differenzen innerhalb der Parteien.
Welche Schlussfolgerungen werden bezüglich der Angst vor einem Wiederaufleben des Rechtsextremismus gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass sich die Angst der Alliierten vor einem Wiederaufleben des Rechtsextremismus als unbegründet erwiesen hat. Nach 1949 spielten rechtsextreme Parteien keine bedeutende Rolle mehr, bis die NPD in den 1960er Jahren wieder in Erscheinung trat.
- Quote paper
- Christopher Eble (Author), 1999, Rechtsextreme Parteien und Organisationen 1945 - 1949, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95259