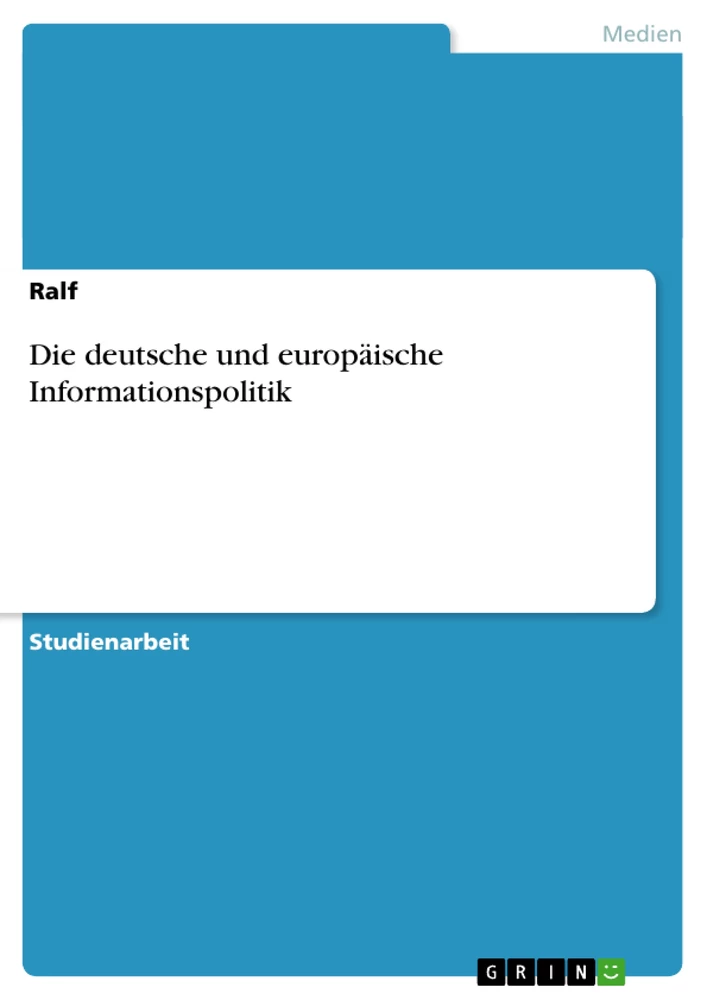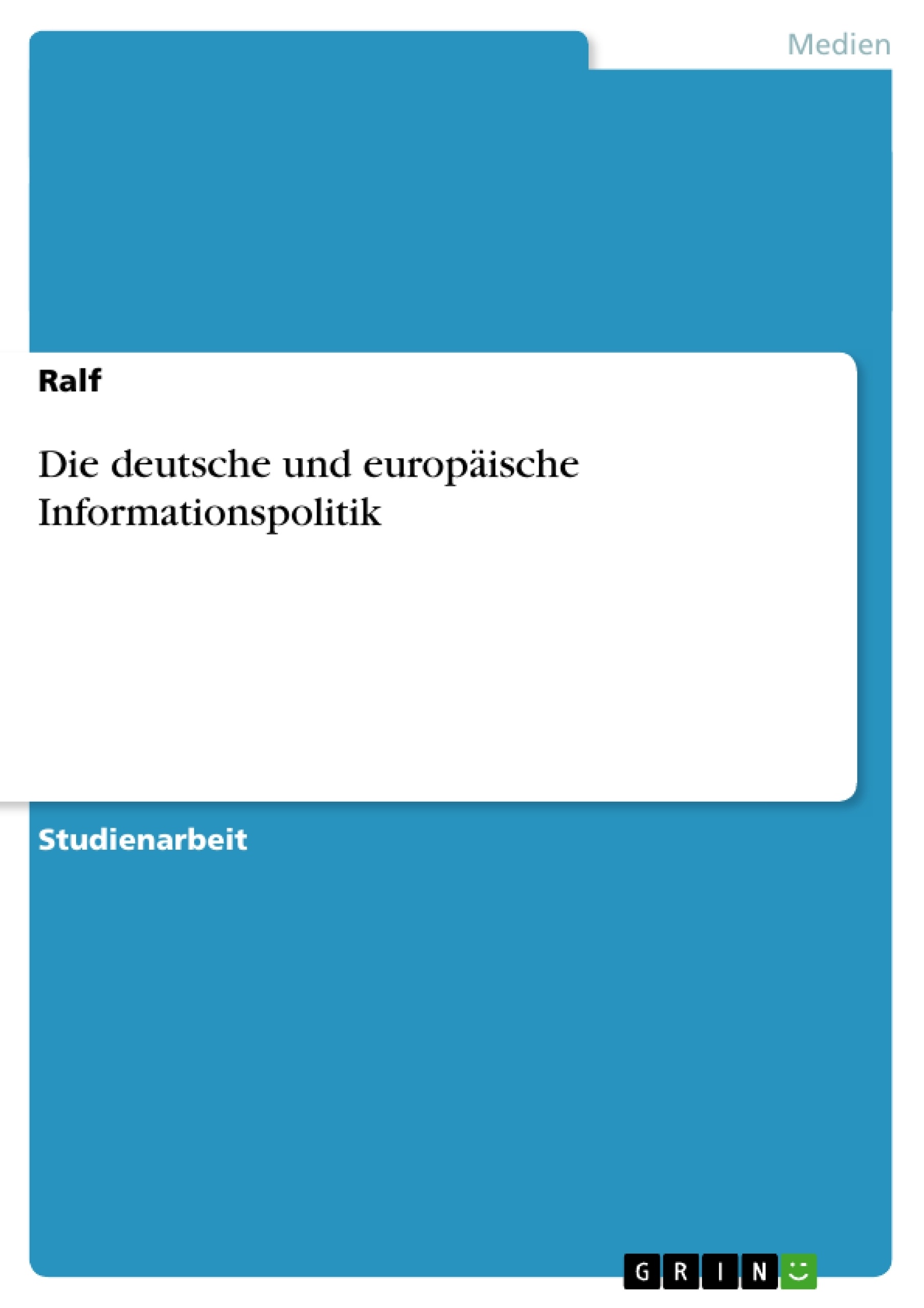Inhaltsverzeichnis:
1. Vorwort
2. Die deutsche Informationspolitik
2.1. Allgemeines zur deutschen Informationspolitik bzw. Forschungspolitik
2.2. Formulierung der deutschen Informationspolitik
2.3. Wichtige Ergebnisse und Definitionen der deutschen Informationspolitik
2.3.1. Programm der Bundesregierung zur IuD-Förderung von 1974 bis 1977
2.3.2. Leistungsplan Fachinformation - Planperiode von 1982 bis 1984
2.3.3. Das Fachinformationsprogramm der Bundesregierung von 1985 bis 1988
2.3.4. Das Fachinformationsprogramm der Bundesregierung von 1990 bis 1994
2.3.5. Die Wissenschaftlich - technische Information für das 21. Jahrhundert
3. Die europäische Informationspolitik
3.1. Hauptanliegen der Informationspolitik der EU
3.2. Wichtige Ergebnisse und Definitionen der europäischen Informationspolitik
3.2.1. Der EG-Vertrag von 1992
3.2.2. Die Impact - Programme von 1989 bis 1995
3.2.3. Das Weißbuch von 1993
3.2.4. Bangemann Arbeitsgruppe und Kommission zur Informationsgesellschaft
3.2.5. Viertes Forschungsrahmenprogramm von 1994 bis 1998
3.2.6. Info 2000 von 1996 bis 1999
4. Kritische Einschätzung der Informationspolitik und Vorschläge für eine künftige Informationspolitik
4.1. Kritische Einschätzung
4.2. Vorschläge für eine künftige Informationspolitik
Quellenangaben
1. Vorwort
In meiner Arbeit gehe ich sowohl auf die Informationspolitik der Bundesrepublik Deutschland, wobei ich hier in der Zeit etwas weiter zurück gehe, um die gesamte Entwicklung der deutschen Informationspolitik zu betrachten, als auch auf die europäische Informationspolitik, also auf die Politik der Europäischen Union ein.
Die nationale Informationspolitik werde ich ab ihrem Ursprung, der in den 60er Jahren liegt, betrachten. Die Betrachtung der Informationspolitik der Europäischen Union umfaßt lediglich die letzten zehn Jahre. Für mich war es nicht in erster Linie wichtig einen allumfassenden Überblick über die nationale und europäische Informationspolitik und ihre Programme darzustellen, sondern ich fand es für sehr wichtig, die Schwerpunkte und einflußreichsten Trends in der Informationspolitik heraus zuarbeiten. Dies ist meiner Meinung nach notwendig, um die Zusammenhänge im Bereich der Information und Dokumentation besser verstehen zu können.
Nachfolgend habe ich die Ergebnisse und Aussagen der deutschen und europäischen Informationspolitik kritisch eingeschätzt, um die Lücken in der Politik aufzudecken. Basierend auf dieser kritischen Eischätzung unterbreite ich abschließend Vorschlägen, wie die Informationspolitik künftig zu gestalten wäre.
Ralf Hofmann
2. Die deutsche Informationspolitik
2.1. Allgemeines zur deutschen Informationspolitik bzw. Forschungspolitik
Ab 1974 genoß das Informationsprogramm der Bundesregierung nach dem Umweltschutz zweite Priorität.
Im Jahr 1983 wird das nun Fachinformationsprogramm genannte Förderungsprogramm in die sachliche Nähe zu Förderungsprogrammen, wie z.B. Informationstechnologien, gestellt. Während 1985 der Aspekt der Nutzung von Fachinformationen unter Berücksichtigung der Stichworte "Neue Techniken / Neue Medien" zum Tragen kommt.
Ziel des Fachinformationsprogramms ist die Bereiche der Massenkommunikation und der Fachinformation näher zusammenrücken zu lassen, wenn nicht gar zusammenwachsen zu lassen. In einer optimalen Forschungsorganisation soll der Einfluß der Politik auf die Wissenschaftsentwicklung und die politische Steuerung von Wissenschaft mit einbezogen werden.
Ein Kriterienkatalog (Beschreibungsmodell) ist in der Lage (von kleinen Ausnahmen abgesehen), die Handlungsziele und die Projekte staatlicher Förderungsprogramme zu beschreiben.
Beschreibungsmodell staatlicher Förderungsmodelle:
- das Reagieren auf ein soziales Problem (wirtschaftlicher oder gesamtgesellschaftlicher Natur)
- ein technisches Handlungsziel (Umsetzung des Problems in konstruktive Zielorientierung)
- die Beteiligung von institutionellen Disziplinen bzw. Forschungsfeldern (entweder heranziehen oder entwickeln)
- problemorientierte Forschungsprogramme (abgrenzbare Aufgabenbündelung)
Seit Anfang der 70er Jahre befindet sich die Forschungs- und Technologiepolitik der BRD in der Effizienzsteigerungsphase. Diese Phase war und ist dadurch gekennzeichnet, daß die stagnierenden Förderungsmittel effizienter angelegt werden mußten bzw. müssen.
Instrumente der Förderungspolitik:
- direkten Maßnahmen (wie z.B. die institutionelle Förderung oder die projektorientierte Förderung),
- indirekten Maßnahmen (Privatwirtschaft als Empfänger),
- indirekt-spezifischen Maßnahmen (richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen),
- verhaltensregulierenden Maßnahmen (ordnungspolitische Gesichtspunkte wie das Patentwesen u.a.)
2.2. Formulierung der deutschen Informationspolitik
Im Jahr 1962 wird die Organisation der Dokumentation grundlegend definiert. Die Organisation der Dokumentation, sowie die Förderung der Dokumentationsleistungen sei laut dem Gutachten des Präsidenten des Bundesrechnungshofes die Aufgabe des Staates. Der Staat ist also dafür zuständig, daß ein nationales Dokumentationsnetz - mit internationaler Kooperation - aufgebaut werden soll. Die Bedeutung der Dokumentationsorganisation ist in dem Sinn sehr wichtig, weil sie als Mittel der Leistungssteigerung in Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung angesehen wird.
Aussagen zur organisatorischen Gliederung von Informationspolitik:
- Steigt die Produktion von Wissen, sind maschinelle Verfahren zur effektiveren Bewältigung nötig.
- Methodische Rückstände müssen aufgearbeitet werden.
- Der Bürger muß besser über die Möglichkeiten der Informationstechnologien informiert werden.
- Die Professionalisierung des IuD-Bereichs muß erreicht werden (Aus- und Fortbildung).
2.3. Wichtige Ergebnisse und Definitionen der deutschen Informationspolitik
2.3.1. Programm der Bundesregierung zur IuD-Förderung von 1974 bis 1977
Das Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation basierte auf den festgestellten Mängeln der IuD-Landschaft, die sich bei der Analyse der IuDStruktur in Deutschland herauskristallisiert haben.
Festgestellte Mängel an der IuD - Landschaft:
- strukturlose Vielfalt der IuD - Einrichtungen
- die unterschiedliche Leistungsfähigkeit dieser Einrichtungen
- die mangelnde Zusammenarbeit zwischen Dokumentations- und Bibliotheksdiensten
- Unzureichender Einsatz moderner Technologie
- Erheblicher Rückstand der IuD in Forschung und Entwicklung
- Kaum qualifiziertes Fachpersonal
Zielsetzung des Programms:
- Ausbau der Informationsdienstleistungen
- Leichter Zugang zu Informationen
- Höhere Effizienz in Forschung, Entwicklung und Ausbildung
- Höhere Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft und Technik
- Unterstützung bei Planung und Entscheidung von Parlament, Regierung, Verwaltung und Justiz
- Bessere Informationsmöglichkeiten für die Bürger
16 Fachinformationssysteme wurden im Rahmen des Programms aufgebaut:
Gesundheitswesen, Medizin, Biologie, Sport (FIS 1)
Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS 2)
Chemie (FIS 3)
Energie, Physik, Mathematik (FIS 4)
Hüttenkunde, Werkstoffe, Metallbe- und verarbeitung (FIS 5)
Rohstoffgewinnung und Geowissenschaften (FIS 6)
Verkehr (FIS 7)
Raumordnung, Bauwesen, Städtebau (FIS 8)
Verbrauchsgüter (FIS 9)
Wirtschaft (FIS 10)
Recht (FIS 11)
Bildung (FIS 12)
Sozialwissenschaften (FIS 13)
Geisteswissenschaften (FIS 14)
Auslandskunde (FIS 15)
Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Kraftfahrwesen, Maschinenbau (FIS 16)
2.3.2. Leistungsplan Fachinformation - Planperiode von 1982 bis 1984
Dieses Förderungsprogramm leitet eine Wende ein und spricht erstmals vom Aufkommen eines sogenannten Informationsmarktes. Im Zeichen der Mittelknappheit heißt das Ziel Kostensenkung.
Eine wichtige Aufgabe sieht das Programm darin, "den Leistungsstand der durch das IuD- Programm zusammengefaßten Einrichtungen und Dienste solange zu sichern, bis über höhere Erlöse und breitere Nutzung der Zuschußbedarf entfällt". Der Bereich der IuD bzw. der Fachinformation wird immer mehr unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit gesehen.
Auf der Basis von Grundsatzfragen wurde eine Neugestaltung der Informationspolitik unter anderem abhängig gemacht. Dies bedeutete aber auch eine Demontage der IuD-Politik in den 70er Jahren.
Die wichtigsten Punkte der Grundsatzfragen:
- Die Notwendigkeit eines staatlichen Engagements ist in der Vergangenheit nicht im gebotenen Maße begründet worden.
- Es wurde in der Vergangenheit von einen Bedarf an Dokumentation ausgegangen, der nie hinreichend untersucht wurde.
- Das IuD-Programm habe zu weitreichende Ziele formuliert, deren Nichteinlösung eine Neuformulierung der Fachinformationspolitik erfordere.
- Die Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal wird als notwendig und wichtig dargestellt, jedoch auf die Nichtzuständigkeit des Bundes für Ausbildungsfragen verwiesen.
1984 kommt der Wissenschaftsrat in seiner "Stellungnahme zur Gesellschaft für Information und Dokumentation (GID)" zu dem Ergebnis, daß die GID nicht die Voraussetzungen für die gemeinsame Förderung durch Bund und Länder erfüllt. Daraufhin wird die GID schrittweise in einen Dienstleistungs- und in einen Forschungsbereich ( "Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD)") überführt.
Bedeutung der Weiterentwicklung von Fachinformation:
Die vollständige Verfügbarkeit der Fachinformation für Wissenschaft, Wirtschaft, Staat und Gesellschaft wird als Voraussetzung dafür angesehen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der BRD zu erhalten und zu verbessern.
2.3.3. Das Fachinformationsprogramm der Bundesregierung von 1985 bis 1988
Im Rahmen dieses Programms wurden die Zuständigkeiten des Bundes auf die im Grundgesetz verankerten und auf die ungeschriebenen verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten begrenzt. Aufgrund dieser Begrenzungen wurden die Zielsetzungen der Informationspolitik neu abgesteckt.
Die Ziele der neuen Fachinformationspolitik:
- Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Fachinformationsmarkt durchzusetzen,
- Die Stärkung des Informationstransfers voranzutreiben,
- Die Sicherung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs zugewährleisten,
- Eine Erhöhung der Akzeptanz und der Nutzung von Fachinformationsdiensten zu erreichen,
- Wettbewerbsvorteile für die deutsche Wirtschaft zu schaffen
Die fünf, aus den Zielen abgeleiteten, Schwerpunkte:
- Förderung von Faktendatenbanken in den Bereichen Chemie, Physik, Gesundheitswesen und Umweltschutz,
- Förderung von internationalen Verbundsystemen für Fachinformation und Verknüpfung mit dem deutschen Forschungsnetz,
- Modellversuche zur innovationsfördernden Informationsvermittlung,
- Informationswissenschaft mit den Schwerpunkten Produkt- und Verfahrensinnovation und rechnergestützte Übersetzungssysteme,
- Internationale Kooperation
2.3.4. Das Fachinformationsprogramm der Bundesregierung von 1990 bis 1994
Die Schwerpunkte im Rahmen dieses Förderungsprogrammes lagen im Ausbau des Angebots und der Nutzung von Fachinformationen in den Neuen Bundesländern. Ebenfalls bleibt festzuhalten, daß sich die deutsche Informationspolitik zunehmend den Rahmenbedingungen und Programmen der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union anzupassen hatte (siehe 3. Kapitel). Das Fördervolumen für Progammmaßnahmen betrug in den Jahren von 1989 bis 1994 insgesamt 2,7 Mrd. DM, wobei die Fachinformationseinrichtungen und die Wissenschaftlichen Bibliotheken zusammen zwei Drittel des Fördervolumens beanspruchten.
2.3.5. Die Wissenschaftlich - technische Information für das 21. Jahrhundert
Ende 1995 wurde dieses Programm von der Bundesregierung vorgestellt - obwohl es die GMD für nicht notwendig hielt. Schwerpunkte, die im letzten Programm stark gefördert wurden, sollten nicht weiter gefördert werden (z.B. Chemieinformationssysteme), es wurde ein neuer Schwerpunkt auf das wissenschaftlich - technische Publikationswesen gesetzt. Fachinformationseinrichtungen, die in der Lage waren wirtschaftlich zu arbeiten - also wenn die Informationsdienste zu marktwirtschaftlichen Bedingungen angeboten werden konnten, wurden ebenfalls nicht mehr gefördert.
Globale Förderziele dieses Programms:
- Datennetze,
- elektronisches Publizieren,
- Literatur- und Faktendatenbanken,
- Sensibilisierung des Informationsbewußtsein
3. Die europäische Informationspolitik
3.1. Hauptanliegen der Informationspolitik der EU
Die Europäische Union sieht die zentrale Aufgabe der europäischen Informationspolitik darin, den Aufbau der Informationsgesellschaft in Europa in die Wege zu leiten und zu beschleunigen. Dadurch soll die angeschlagene europäische Wirtschaft therapiert werden und das Arbeitslosigkeitsproblem in Europa entschärft werden.
Mit welchen Methoden und mit welchen Programmen die Europäische Union ihr selbstgestecktes Ziel erreichen will, wird im Anschluß erläutert und zusammenfassenden wiedergegeben. Seit 1989 wird mit den Programmen und in Kommissionen der Europäischen Union versucht die Rahmenbedingungen für eine Informationsgesellschaft zu definieren.
wichtigste Definitionen:
- Informations- und Kommunikationstechniken werden zur "Telematik" vereinigt.
- Alle Branchen der Produzenten und Distributoren von Informationsinhalten werden unter dem Stichwort "Multimedia" zusammengefaßt.
- Die Branche der Informationsinhalte und der Telekommunikation bilden die Schlüsselindustrie für wirtschaftliche Entwicklung in Europa.
3.2. Wichtige Ergebnisse und Definitionen der europäischen Informationspolitik
3.2.1. Der EG-Vertrag von 1992
Im EG-Vertrag von 1992 sind die wichtigsten Grundbedingungen für eine europäische Informationsgesellschaft festgehalten. Auf diesen Grundbedingungen bauen alle später ins Leben gerufene Programme und Kommissionen auf.
Grundbedingungen der Informationsgesellschaft:
- Der Aufbau der Telekommunikationsinfrastruktur ist nicht Sache der EU, sondern wird durch den Markt erfolgen.
- Alle Bürger und alle Regionen der EU sollen von der Telekommunikationsinfrastruktur profitieren können.
- Einzelne Telekommunikationsnetze sollen zueinander paßfähig, also interoperabel, sein.
3.2.2. Die Impact - Programme von 1989 bis 1995
1. Impact 1 (1989-1990):
Im Rahmen von Impact1 wurde die Förderung des Marktes vereinbart. Ziel ist es, die Entwicklung des Binnenmarktes für elektronische Informationsdienste zu beschleunigen.
2. Impact 2 (1991-1995):
Impact2 verfolgt vier Aktionslinien:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(3) IMO (Information Market Observatory):
- IMO wurde im Rahmen von Impact1 gegründet.
- Ziel von IMO ist das Erheben von Marktdaten und das Anregen von Arbeiten auf dem Gebiet der Informationswissenschaft und der Informationswirtschaft.
Analysiert werden:
Internet
Endnutzermärkte
Geographische Informationssysteme Virtual Reality
Qualitätsmanagement
Massenmarkt der Mulimediaprodukte
3.2.3. Das Weißbuch von 1993
Das Weißbuch von 1993 ist das Planungspapier der Europäischen Union zur Informationsgesellschaft. In diesem Papier wird der gemeinsamer europäischer Informationsraum (Verknüpfung aller nationalen Netze) definiert. Kern des europäischen Informationsraums sind die Netzsysteme: "Nervensystem der Wirtschaft bzw. allgemein der Gesellschaft von morgen". Durch die Verknüpfung der nationalen Netze sollen neue Märkte geschaffen werden und somit das Arbeitslosenproblem entschärft werden.
Auseinandersetzung mit der Telekommunikation in 3 Ebenen:
unterste Ebene -
mittlere Ebene -
dritte Ebene -
Übertragungsnetze / Vermittlungstechniken / Asynchrone Transfer Modus (ATM)
generische Dienste (gemeinsame Basis für alle Anwendungen) z.B. Email
Telematikanwendungen (Anpassen an den spezifischen Bedarf von Benutzergruppen)
Bedingungen für eine Informationsgesellschaft:
In einer Informationsgesellschaft müssen alle Dienste für den Wettbewerb offen sein. Die Anbieter der Dienste müssen für die Sicherheit der Informationssysteme und Kommunikationssysteme garantieren und der Datenschutz muß gewährleistet bleiben. Es gilt einen Universaldienst (Telefon oder Email) zu bestimmen und im Rahmen der Informationspolitik Normen zu definieren.
Bedeutung des Weißbuchs:
Das Weißbuch ist somit die Grundlage bzw. der Auslöser einer neuen Informationspolitik der Europäischen Union.
3.2.4. Bangemann Arbeitsgruppe und Kommission zur Informationsgesellschaft - 1994
Im Rahmen der Arbeitsgruppe und der Kommission hat die Europäische Union die Aussagen des Weißbuches konkretisiert. In einem Schichtenmodell hat man die Bausteine für eine Informationsgesellschaft dargestellt und definiert.
Basis des Schichtenmodells sind die Netze. Die Leistungsfähigkeit dieser Netze muß so groß sein, daß sie alle Multimediaanwendungen (Übertragung von Bild, Ton, Schrift usw.) zuläßt. Die technische Basis der Netze in Europa soll das EURO-ISDN bilden mit dem Ziel einer integrierten Breitbandkommunikation mittels ATM und Datenkompression.
Schichtenmodell (Bausteine für eine Informationsgesellschaft):
1. Netze (Telefon, Mobilfunk, Kabel TV, Satelliten usw.)
2. Grunddienste (Email, Videokonferenzen usw.)
3. Informationsinhalte (Audiovisuelle Programme, Informationsresourcen)
4. Anwendungen: Telearbeit
Fernlernen
Hochschulnetzwerk Telematik für KMU
Straßenverkehrsmanagement Flugsicherung
Gesundheitswesen
Elektronische Ausschreibungen
Netz öffentlicher Verwaltungen
Private Haushalte
3.2.5. Viertes Forschungsrahmenprogramm von 1994 bis 1998
Innerhalb des vierten Forschungsrahmenprogramms werden grundlegende Forschungen und Entwicklungen von der EU finanziert. Das gesamte Finanzvolumen beläuft sich auf 12,3 Mrd. ECU. 3,4 Mrd. ECU davon werden in den Informationsbereich gesteckt - 28% des Programmvolumens. Im Vergleich dazu werden die Bereiche Energie mit 18%, Industrie mit 16%, Biowissenschaften mit 13% und Umwelt mit 9% des Programmvolumens unterstützt. Dies zeigt die große Bedeutung der Telematik und der Kommunikationsdiensten für die EU.
Aufsplitten der Telematikanwendungen in verschiedene Bereich und Sektoren:
Bereich A: für Dienste im öffentlichen Interesse (Verwaltung, Verkehr)
Bereich B: zur Wissenserweiterung ( Forschung, Bildung usw.)
Bereich C: zur Verbesserung der Beschäftigungslage und der Lebensqualität (Umwelt, Gesundheitswesen usw.)
Bereich D: Horizontale Aktivitäten (Sprach-Engineering usw.) Bereich E: Flankierende Maßnahmen
Die Rolle der Bibliotheken:
"Bibliotheken müssen die Drehscheibe innerhalb der europäischen Informationsstruktur werden." Denn die Bedeutung von Wissen und Verbreitung von Informationen bestimmen die Informationsgesellschaft.
Kern: - Netzorientierte interne Bibliothekssysteme
- Bibliotheksdienstleistungen im Verbund
- Zugang zu den netzgestützten Informationsbeständen
Informations-Engineering-Programm:
Durchdringen aller Telematikanwendungen in drei sog. "Engineering"-Sektoren:
- Telematik-Engineering - (Bereitstellen von Entwicklungswerkzeugen, Design von Telematikanwendungen usw.)
- Sprach-Engineering - (Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb und zwischen den europäischen Sprachen, Sprachverarbeitungsmethoden für gesprochene und geschriebene Sprache)
- Informations-Engineering- (Aufbau von Datenbanken, Speichern und Verbreitung von Datenbanken, Recherchieren in Datenbanken, Wertschöpfung von Informationen)
3.2.6. Info 2000 von 1996 bis 1999
Festlegen der Branchen für Informationsinhalte:
- gedruckte Veröffentlichungen (Zeitungen, Bücher usw.)
- elektronisches Publizieren (Online-Datenbanken, Videotext, CD-ROM usw.)
- audiovisuelle Industrie (Fernsehen, Video, Radio usw.)
Die drei Maßnahmepakete im Rahmen von Info 2000:
- Anregung der Nachfrage und Sensibilisierung
- Nutzung der Informationen des öffentlichen Sektors in Europa
- Erschließung des Multimedia-Potentials in Europa
Durch das Programm Info 2000 will die EU die kulturelle Komponente der Informationsgesellschaft kräftigen, indem sie die wirtschaftliche Nutzung des europäischen Kulturerbes unterstützt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten (Grundlage: öffentliche Museen, Bibliotheken und Archive) ausbaut. Dadurch soll nun auch - neben der Stärkung der europäischen Wirtschaft - die Findung einer europäischen Identität erleichtert bzw. ermöglicht werden.
4. Kritische Einschätzung der Informationspolitik und Vorschläge für eine künftige Informationspolitik
4.1. Kritische Einschätzung
Meine Kritikpunkte an der europäischen und deutschen Informationspolitik:
- Mangelhafte Definition von rechtlichen Beziehungen,
- Wegfallen von staatlichen Monopolen,
- Unzureichende Definition eines Universaldienstes,
- Fehlende offene Diskussion in der Bevölkerung
Sicherlich ist es richtig auf die Informationstechnologien zu vertrauen, wenn es darum geht die deutsche bzw. europäische Wirtschaft einen oder mehrere Schritte noch vorne zu bringen, aber etwas, das mir bei der Betrachtung der deutschen und europäischen Informationspolitik gleichermaßen negativ aufgefallen ist, es fehlt bzw. es wird nur am Rande darauf eingegangen, daß im Rahmen von Informationsaustausch rechtliche Beziehungen eingegangen werden. Zwischen Dienstanbieter, Informationsproduzent und Kunde werden ja schließlich trotz der Technisierung des Wissensaustausches immer noch Willenserklärungen zu einem Rechtsgeschäft abgegeben. Die rechtliche Handhabung solcher Geschäfte wird aber sowohl durch die deutsche, als auch durch die europäische Politik in meinen Augen nur unzureichend geregelt. Wie soll z. B. das Urheberrecht im Internet - in dieser Hinsicht ein sehr gefährliches und undurchsichtiges Medium - gehandhabt werden bzw. geschützt werden. Auf diese oder ähnliche Fragen fand ich in der Informationspolitik der Bundesregierung bzw. der Europäischen Union keine oder nur unzureichende Antworten. Die Frage nach der Sicherstellung bzw. Gewährleistung des Datenschutzes (vor allem die technische Realisierung des Schutzes) liefert auch nur unbefriedigende Antworten.
Das Wegfallen von staatlichen Monopolen im Informationssektor (wie jetzt das Monopol der Telekom) sehe ich eher mit einem weinenden Auge. Zum einen fällt ein wichtiges Instrument der staatlichen Regulierung des Informationsmarktes, also der Durchsetzung der Informationspolitik weg - was dazu führen könnte, daß sich das Aneignen von Wissen extrem verteuern würde, zum anderen könnte dadurch auch ein chaotisches Durcheinander - wie ja jetzt im Fall Telekom deutlich zu sehen ist - entstehen, indem nur noch Experten den Durchblick behalten. Dies wäre aber nicht im Sinne einer deutschen oder europäischen Informationspolitik, in deren Rahmen eigentlich jeder Bürger zu den Informationen Zugang haben sollte und nicht nur Experten oder diejenigen, die sie sich finanziell leisten können.
Vielleicht macht man sich im Rahmen der Informationspolitik auch zu wenig Gedanken über die Definition eines Universaldienstes (Telefon, Email usw.). Ein solcher Universaldienst wäre in meinen Augen erst die Grundlage für eine globale Informationsgesellschaft. In diesem Zusammenhang soll erwähnt sein, daß es genügend Länder auf der Welt gibt die nicht über die finanziellen und damit auch technischen Möglichkeiten verfügen wie Deutschland bzw. Europa.
Weiter bin ich der Meinung, daß die deutschen und europäischen Informationsprogramme noch nicht zu einer offenen Diskussion in der Bevölkerung zum Thema Multimedia beigetragen haben. In den USA ist eine solche offene Diskussion ja durchaus üblich. Hier hat die Informationspolitik in Deutschland und Europa ihr selbstgestecktes Ziel noch nicht erreicht. Aus solchen Diskussionen könnte man wertvolle Hinweise ziehen, die dann in die Informationspolitik einfließen könnten.
Was ich aber für sehr wichtig halte, sowohl im Rahmen der Informationsprogramme von der Bundesregierung, als auch im Rahmen der Programme von der Europäischen Union wurden im Bezug auf die Bedeutung der Datenautobahnen Parallelen zum Bau der Eisenbahn- und Straßennetze gezogen. Denn die Datenautobahnen werden einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstand von morgen leisten.
4.2. Vorschläge für eine künftige Informationspolitik
Eine künftige Informationspolitik sollte meine Kritikpunkte aufgreifen und hier vor allem dabei Mithelfen, daß die Rechtlichen Lücken im Bereich des Informationssektors geschlossen werden können. Noch mehr als früher sollte die Informationspolitik bestrebt sein, eine offene Diskussion in der Bevölkerung anzuregen.
Fragen, die sich eine künftige Informationspolitik stellen sollte:
- Muß eine Informationsgesellschaft aufgrund ihrer Definition weltweit zu sehen sein?
- Ist es möglich ein weltweites Universaldienstsystem aufzubauen?
- Welche Vorteile haben finanziell schwache Staaten von einem solchen Konzept?
- Kann ein Volk, in dem über 50% nicht lesen können, an der Informationsgesellschaft teilhaben?
- Welche Basisdienste müßten in einem globalen System integriert werden?
Eine künftige Informationspolitik muß sich mit dem globalen Aspekt der Informationsgesellschaft auseinandersetzen. Denn die Datenautobahnen kennen keine nationalen Grenzen.
Da es auf der Welt leider immer noch sehr viele Entwicklungsländer gibt, wäre es meiner Meinung auch durchaus denkbar, daß sich die Informationspolitik den Bereich der Entwicklungshilfe "einverleibt", also die Programme zur Unterstützung von Entwicklungsländer durch die Informationspolitik bestimmt werden. Man würde in diesen Ländern mithelfen eine moderne Informationsstruktur aufzubauen. Somit wären die Länder dann in der Lage sich das "Wissen der Welt" aus den Datenbanken via Datenautobahn zu holen. Nun könnten sie sich selbst aus ihrem Entwicklungsdasein befreien und auf eigenen Füßen stehen. Damit würden sich neue Märkt herausbilden, dies würde dann auch der Wirtschaft in Deutschland zu gute kommen.
Für eine künftige Informationspolitik ist es nach meiner Ansicht absolut notwendig und das wichtigste, nicht nur nationale oder kontinentale Belange zu beachten, sonder zu lernen in weltweiten Bahnen zu denken.
Quellenangaben
Literatur:
1) Seeger, T.: Informationspolitik: IuD-Politik, Fachinformationspolitik In: M. Buder, W. Rehfeld, T. Seeger, D. Strauch (Hersg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. 4. Auflage München, New York: Saur-Bowker 1997. S. 846 - 880
2) Rehfeld, W.: Tendenzen der Information und Dokumentation. G1: Reisen wir auf den Datenautobahen in eine neue (Un)gewißheit? In: M. Buder, W. Rehfeld, T. Seeger, D. Strauch (Hersg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. 4. Auflage München, New York: Saur-Bowker 1997. S. 959 - 973
3) Stock, W.G.: Die Informationspolitik der Europäischen Union. In: ABI-Technik. Vol. 16, 1996. Nr. 2. S. 111 - 132
sonstige Quellen:
- Vorlesung Massenkommunikation III, Dozent: Prof. Dr. Peter Seeger - eigene Aufzeichnungen
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Das Dokument behandelt umfassend die deutsche und europäische Informationspolitik, beginnend mit den Ursprüngen der deutschen Informationspolitik in den 1960er Jahren bis hin zu den Programmen und Initiativen der Europäischen Union in den 1990er Jahren. Es analysiert die Ziele, Ergebnisse und kritischen Einschätzungen dieser Politiken und schlägt zukünftige Richtungen vor.
Welche Aspekte der deutschen Informationspolitik werden behandelt?
Die Arbeit geht auf die deutsche Informationspolitik ab ihren Ursprüngen in den 1960er Jahren ein. Sie analysiert die Formulierung der deutschen Informationspolitik, wichtige Ergebnisse wie das IuD-Förderprogramm (1974-1977), den Leistungsplan Fachinformation (1982-1984), das Fachinformationsprogramm (1985-1988 und 1990-1994) sowie die Initiative "Wissenschaftlich-technische Information für das 21. Jahrhundert". Auch die allgemeine Forschungspolitik ab 1974 wird thematisiert.
Welche Schwerpunkte setzt die Analyse der europäischen Informationspolitik?
Die europäische Informationspolitik wird hauptsächlich im Kontext der letzten zehn Jahre vor der Veröffentlichung des Dokuments betrachtet. Der Fokus liegt auf den Hauptanliegen der EU-Informationspolitik, wichtigen Ergebnissen wie dem EG-Vertrag von 1992, den Impact-Programmen (1989-1995), dem Weißbuch von 1993, der Arbeit der Bangemann-Arbeitsgruppe, dem vierten Forschungsrahmenprogramm (1994-1998) und Info 2000 (1996-1999).
Welche Kritikpunkte werden an der deutschen und europäischen Informationspolitik geäußert?
Kritisiert werden mangelhafte Definitionen rechtlicher Beziehungen, das Wegfallen staatlicher Monopole, eine unzureichende Definition eines Universaldienstes und eine fehlende offene Diskussion in der Bevölkerung. Es wird bemängelt, dass die rechtliche Handhabung von Geschäften im Informationsaustausch unzureichend geregelt ist, insbesondere im Hinblick auf Urheberrecht und Datenschutz.
Welche Vorschläge werden für eine zukünftige Informationspolitik unterbreitet?
Es wird vorgeschlagen, dass eine zukünftige Informationspolitik die genannten Kritikpunkte aufgreifen und zur Schließung rechtlicher Lücken im Informationssektor beitragen sollte. Sie sollte eine offene Diskussion in der Bevölkerung anregen und den globalen Aspekt der Informationsgesellschaft berücksichtigen. Zudem wird eine Integration des Bereichs Entwicklungshilfe in die Informationspolitik vorgeschlagen, um in Entwicklungsländern eine moderne Informationsstruktur aufzubauen.
Welche Fachinformationssysteme wurden im Rahmen des Programms der Bundesregierung zur IuD-Förderung aufgebaut?
Im Rahmen des Programms wurden 16 Fachinformationssysteme aufgebaut, darunter solche für Gesundheitswesen/Medizin/Biologie/Sport (FIS 1), Ernährung/Land- und Forstwirtschaft (FIS 2), Chemie (FIS 3), Energie/Physik/Mathematik (FIS 4), Hüttenkunde/Werkstoffe/Metallbearbeitung (FIS 5), Rohstoffgewinnung/Geowissenschaften (FIS 6), Verkehr (FIS 7), Raumordnung/Bauwesen/Städtebau (FIS 8), Verbrauchsgüter (FIS 9), Wirtschaft (FIS 10), Recht (FIS 11), Bildung (FIS 12), Sozialwissenschaften (FIS 13), Geisteswissenschaften (FIS 14), Auslandskunde (FIS 15), sowie Elektrotechnik/Feinwerktechnik/Kraftfahrwesen/Maschinenbau (FIS 16).
Welche Ziele verfolgte das Fachinformationsprogramm der Bundesregierung von 1985 bis 1988?
Die Ziele umfassten eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Fachinformationsmarkt, die Stärkung des Informationstransfers, die Sicherung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs, eine Erhöhung der Akzeptanz und Nutzung von Fachinformationsdiensten sowie die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen für die deutsche Wirtschaft.
Was waren die Schwerpunkte des Vierten Forschungsrahmenprogramms der EU im Bereich Telematik?
Die Telematikanwendungen wurden in verschiedene Bereiche und Sektoren aufgeteilt, darunter Dienste im öffentlichen Interesse (Verwaltung, Verkehr), Wissenserweiterung (Forschung, Bildung), Verbesserung der Beschäftigungslage und Lebensqualität (Umwelt, Gesundheitswesen) sowie horizontale Aktivitäten wie Sprach-Engineering.
- Arbeit zitieren
- Ralf (Autor:in), 1998, Die deutsche und europäische Informationspolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95163