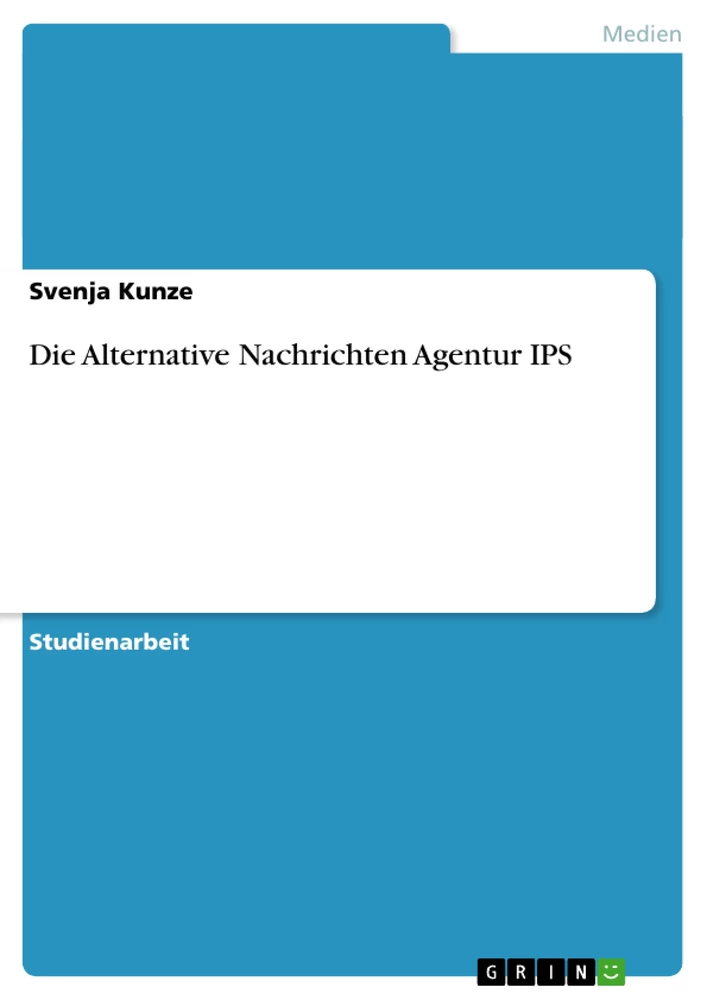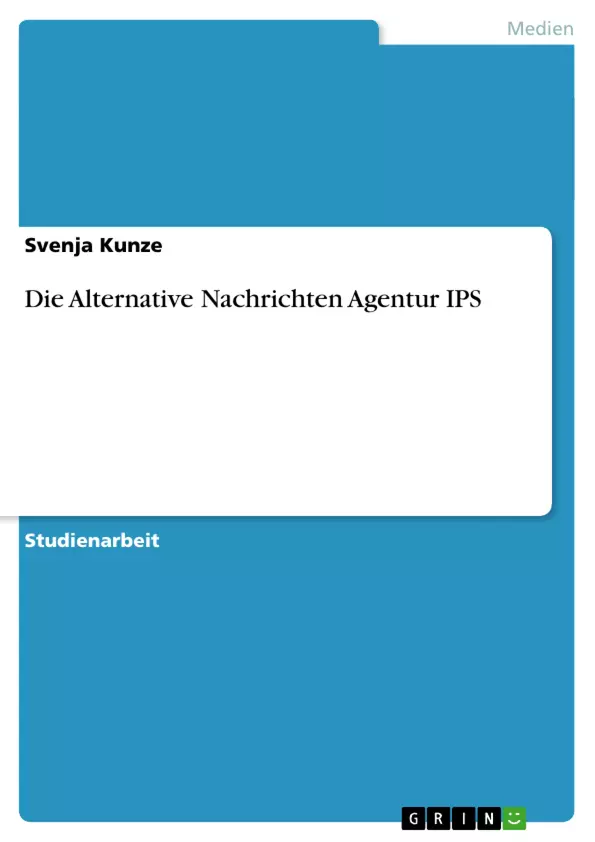Inhalt
I. Einleitung
II. Hauptteil
1. Die Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS)
1.1 Entstehung und Entwicklung
1.2 Aufbau und Struktur
1.3 Die Nachrichtenagentur
1.4 Finanzierung
1.5 Selbstdarstellung und Zielsetzung
2. IPS - eine "alternative" Nachrichtenagentur ?
2.1 Der MacBride-Report und die Forderung nach einem "freien und ausgewogenen Informationsfluß"
2.2 IPS und der MacBride-Report
2.3 IPS - alternativ im Sinne des MacBride-Reports ?
3. Die Position von IPS auf dem internationalen Nachrichtenmarkt
3.1 (wirtschaftliche) Konkurrenzfähigkeit
3.2 Einfluß auf dem internationalen Nachrichtenmarkt
3.3 politische Angriffe auf IPS
III. Schlußbetrachtung
1. Erfüllt IPS die eigene Zielsetzung ?
2. Ausblick: Zukünftige Aufgaben von IPS
IV. Literatur
Die alternative Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS) auf dem internationalen Nachrichtenmarkt
I. Einleitung
Bei der Behandlung des Themenbereiches "Internationale Kommunikation" in Plenum und Tutorium und bei der entsprechenden Lektüre zeigte sich ein deutliches Ungleichgewicht zugunsten der westlichen Industrienationen in allen Bereichen der Kommunikation, besonders aber in der Bereitstellung und Verbreitung von Nachrichten. Offensichtlich dominieren die vier großen Weltagenturen AFP, AP Reuters und UPI den Nachrichtenmarkt und verbreiten dabei - gemäß ihrer Herkunft - vornehmlich "westliche" Nachrichteninhalte in entsprechenden Berichterstattungsmustern.
Der MacBride-Bericht an die UNESCO über die internationalen Kommunikations- probleme bezeichnet diesen Zustand 1980 als "Einbahnstraße" im freien Infor-mationsfluß und plädiert für eine größere Ausgewogenheit, auch und besonders auf dem Gebiet der Nachrichtenmedien.
Alternative Nachrichtenagenturen zu den "Big Four" scheinen diese Forderung nach Ausgewogenheit am ehesten zu erfüllen.
Mit dem Ziel, alternative Informationen bereitzustellen und damit die Integration der "Dritten Welt" auf dem Nachrichtenmarkt und in der internationalen Politik zu ermöglichen, wurde Inter Press Service (IPS) bereits 1964 gegründet.
Was genau aber ist IPS, welchen Anspruch verfolgt die Agentur mit ihrer Arbeit, was leistet sie für die Integration der "Dritten Welt", und welche Position nimmt sie auf dem internationalen Nachrichtenmarkt ein ?
Diese Fragestellung läßt sich in drei Teilschritten bearbeiten. Zunächst ist es notwendig, die rein "technischen" Fakten über IPS zu kennen, d.h. sich mit ihrer Geschichte, ihrer Struktur, ihrer Finanzierung und ihrer Zielsetzung zu beschäftigen, was im ersten Teil dieser Arbeit geleistet werden soll.
Den zweiten Teil stellt eine Beurteilung der IPS-Arbeit nach den Maßstäben des MacBride-Berichtes dar. Es soll festgestellt werden, inwieweit IPS zur Schaffung eines "freien und ausgewogenen Informationsflusses" beiträgt und ob die Agentur in diesem Sinne wirklich als "alternativ" bezeichnet werden kann.
Eine Einschätzung der Position der Agentur IPS auf dem internationalen Nach-richtenmarkt bildet den dritten Teil. Hier soll vor allem das Verhältnis zu den "Big Four" und die Konkurrenzfähigkeit von IPS gegenüber den Weltagenturen betrachtet werden.
Die Schlußbetrachtung enthält eine zusammenfassende Beurteilung der Leistungen von Inter Press Service und einen Ausblick auf die zukünftigen Aufgabenstellungen an IPS.
II. Hauptteil
1. Die Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS)
1.1 Entstehung und Entwicklung
Bereits im Jahre 1962 wurde von dem italienischen Journalisten Roberto Savio eine kleine Nachrichtenagentur in Rom gegeründet, die zum Ziel hatte, Informationen über die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in Lateinamerika zu verbreiten. Aus dieser, vornehmlich von christdemokratischen Kräften geförderten Agentur, der Roman Press Agency, entwickelte sich 1964 Inter Press Service, der es sich mit einem erweiterten Dienst zur Aufgabe machte, als Informationsbrücke zwischen Lateinamerika und Europa zu fungieren. Neben dieser Informationstätigkeit wurde IPS von Beginn an auch im politischen Bereich aktiv. (vgl. Heyn/ Uekermann 1984: 441)
Dazu gehörten in der Anfangszeit Vertragsabschlüsse mit reformgesinnten Regierun-gen Lateinamerikas über die gemeinsame Nutzung von Datenleitungen und Informationskanälen und Kontakte zu christdemokratischen Parteien in Europa und anderen, sich mit der "Dritten Welt" solidarisch erklärenden, westeuropäischen Organisationen, die vor allem der finanziellen Unterstützung der Agentur dienen sollten.
Ende der 60er Jahre mußte IPS in Lateinamerika herbe Rückschläge einstecken: in vielen Ländern putschten sich Militärdiktaturen an die Macht, die Journalisten ins Exil zwangen und die Möglichkeiten "unabhängiger" Nachrichtenagenturen stark einschränkten. Die dortigen IPS-Büros mußten ihre Tätigkeit zeitweise einschränken und waren von der Schließung bedroht. (vgl. Giffard 1984: 42-43)
Die Mißerfolge in Lateinamerika führten dazu, daß IPS sich auf neue Arbeitsbereiche konzentrierte. Man versuchte nun verstärkt, Kontakte nach Afrika, Asien, Europa und in die arabische Welt zu knüpfen.
Anfang der siebziger Jahre begann beispielsweise die Annäherung an osteuropäische Nachrichtenagenturen. 1972 schloß IPS einen Kooperationsvertrag mit der jugoslawischen Nachrichtenagentur TANJUG. TANJUG konnte damit die technische Infrastruktur von IPS in Lateinamerika nutzen, während IPS über TANJUG Zugang zur Infrastruktur in Afrika und Asien erhielt. (vgl. Salamanca Orrego 1993: 90-91)
Etwa gleichzeitig wurden von IPS erste Kontakte in die arabischen Länder geknüpft.
Das wachsende politische Selbstbewußtsein der Entwicklungsländer und die weltweit beginnende Diskussion um eine "Neue Internationale Informations- und Kommunikationsordnung" (NIIKO) stärkte Mitte der siebziger Jahre zwar die Bedeutung von IPS als Organisation für die kommunikationspolitischen Belange der "Dritten Welt", auf journalistischem Gebiet blieb die Agentur jedoch auch gut zehn Jahre nach ihrer Gründung bedeutungslos.
Die Probleme lagen vor allem in der Struktur und Organisation, besonders in der mangeln- den Kooperation zwischen den IPS-Büros. Pläne zu einer Strukturreform scheiterten, daneben fehlte eine klare journalistische Linie (vgl. Salamanca Orrego 1993: 95-96).
Erst Anfang der achtziger Jahre gelang es IPS, auch journalistisch als "Stimme der Dritten Welt" anerkannt zu werden. Es erfolgte eine Ausdehnung der Agentur, sowohl im Volumen der Wortproduktion und in der Produktpalette, als auch geographisch, hier besonders in Afrika.
Im Rahmen der Bemühungen um eine NIIKO erhielt IPS Fördermittel zum Aufbau fehlender Infrastrukturen in Entwicklungsländern, zudem erleichterte "...dieses außergewöhnlich positive Diskussionsklima (im Umfeld der NIIKO, Anm. S.K.) [...] es IPS, eigene Vorstellungen einzubringen und Raum f Ür weitere Operationen zu gewinnen." (Salamanca Orrego 1993: 123)
Zwischen 1982 und 1987 konnte IPS die alten Pläne zur Strukturreform verwirklichen. Neben der Regionalisierung und Dezentralisierung setzte man auf eine weitere Expansion der Agentur, für die westliche Partner benötigt wurden, die bestimmte Projekte finanziell und politisch unterstützen sollten.
IPS gab in dieser Zeit einige der radikalen Postulate auf - z.B. das der "Enkoloni-sierung der Information" - ohne dabei von der Grundposition, nämlich alternative Nachrichten produzieren zu wollen, abzuweichen.
Damit konnte eine größere innere Geschlossenheit und eine stabile operative Basis für die Berichterstattung geschaffen werden - das größte Problem, die finanzielle Abhängigkeit von den verschiedensten Partnern, ist jedoch bis heute nicht gelöst (vgl. Salamanca Orrego 1993: 213-215).
1.2 Aufbau und Struktur
IPS wurde als Genossenschaft italienischen Rechts gegründet. Heute besitzt diese Genossenschaft eine Reihe von "Unternehmen" der unterschiedlichsten Rechtsformen, ist demnach im weitesten Sinne eine Unternehmensgruppe. Alle Gewinne müssen von dieser Unternehmensgruppe reinvestiert werden, denn IPS ist eine "non-profit" - Kooperative. Die Genossenschaft wird von einem elfköpfigen Verwaltungsrat geleitet, für das internationale Nachrichtenetz der Agentur ist allerdings IPS-Tercer Mundo, eines der IPS-Unternehmen mit Sitz in Panama, verantwortlich. (vgl. Salamanca Orrego 1993: 283)
Die Arbeit von IPS gliedert sich in drei Hauptbereiche, in 1) IPS-News Service, die weltweite Nachrichtenagentur, 2) IPS-Telecommunications, für Technologietransfer und den Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur in der "Dritten Welt" zuständig, und 3) IPS- Projects, in den Bereichen Weiterbildung, Medienvernetzung, Frauenförderung etc. aktiv (vgl. IPS 1997 c)).
IPS genießt als anerkannte unabhängige Nichtregierungsorganisation (NGO) beratenden Status im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen.
1.3 Die Nachrichtenagentur
Als Nachrichtenagentur unterhält IPS zwei Weltdienste in Englisch und Spanisch, die in einem Umfang vom jeweils 60.000 Wörtern täglich verbreitet werden. Daneben werden Dienste in Deutsch, Kisuaheli, Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch angeboten; ausgewählte Beiträge werden auch in andere, besonders in asiatische Sprachen übersetzt. Die Gesamtproduktion von IPS-News Service beträgt 160.000 Wörter täglich. Hintergrunddienste zu verschiedenen Themenbereichen, sog. "Bulletins", und spezielle Publikationen für die Vereinten Nationen sind einige der weiteren journalistische Produkte der Agentur (vgl. IPS-Büro Bonn 1997).
Zentralen zur Sammlung, Bearbeitung und Verbreitung von Nachrichten unterhält IPS in Rom (internationale Zentrale), San José (Lateinamerika), New York (Nordamerika), Kingston (Karibik), Colombo (Asien), Harare (Afrika) und Tunis (arabische Welt); dazu kommen etwa 40 nationale Büros und viele freie MitarbeiterInnen/ KorrespondentInnen, so daß aus insgesamt mehr als 100 Ländern berichtet werden kann.
IPS hat nach eigenen Angaben weltweit 1100 Abonnenten, darunter Medien, Organisationen aller Art, Firmen, Regierungseinrichtungen und Privatpersonen. Im deutschsprachigen Raum beziehen ca.100 Kunden den IPS-Dienst, im Medienbereich vor allem die großen Zeitungen/ Zeitschriften1 und die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender (vgl. IPS 1997 b); IPS-Büro Bonn 1997).
1.4 Finanzierung
Die Agentur finanziert sich aus dem Verkauf der journalistischen Produkte, aus Carrier- Diensten für andere Agenturen und Organisationen und aus externer Unterstützung, d.h. über nationale und internationale Stiftungen, Hilfsprogramme, Fördermittel etc. Dabei ist davon auszugehen, daß nur ein geringer Teil der Einnahmen aus dem Nachrichtenverkauf an die Medien stammt (ca. 6% nach älteren Schätzungen). Weitere Anteile bringt der Verkauf an UNO-Organe, Firmen und andere Organisationen außerhalb der Medien; Hauptfinanzierungsquelle sind allerdings die Carrier-Dienste, Übersetzungsarbeiten für und Nachrichtenverkauf an andere Agenturen (vgl. Giffard 1984: 49-50). Daneben dürfte IPS in einem nicht unerheblichen Rahmen von externer Unterstützung abhängig sein2 (IPS 1997 a)).
1.5 Selbstdarstellung und Zielsetzung
"Ziele der IPS-Gruppe sind die Stärkung des S Üd-S Üd- und S Üd-Nord- Informationsflusses sowie die Einbindung aller Akteure in diese Ströme, die das gesamtgesellschaftliche Spektrum repräsentieren", heißt es 1997 in IPS-eigenem Informationsmaterial (IPS-Büro Bonn 1997).
Weiter beschreibt die Unternehmensgruppe ihre Ziele : "IPS is dedicated to promo-ting democratic participation [...], the full envolvement of the countries of the South [...] and the full empowerment of women[...]. In addition, IPS promotes a global communication strategy that aimes to bring together civil society, policy-makers (...) and the media." (IPS 1997 c)).
Nachdem die radikaleren Ansätze aufgeben wurden, setzt sich IPS heute für die "Demokratisierung der Kommunikation" ein; besonders die IPS-Nachrichtenagentur wird oft als "Stimme der Dritten Welt" bezeichnet, was dem Selbstverständnis der Agentur durchaus entsprechen dürfte.
Um die hohen politischen Ansprüche in der täglichen Arbeit der Nachrichtenagentur umzusetzen, versucht IPS vor allem, von der allgemein üblichen ereignis- und krisenorientierten Berichterstattung ("spot news") abzuweichen. Die Ereignisse sollen in ihrem sozialen, kulturellen, historischen und ökonomischen Kontext dargestellt und analysiert werden, " [...] so that the people can begin to understand the complex processes that lie behind the day-to-day events." (IPS 1997 B)). Entwicklungsprozesse und für Entwicklungsländer relevante Themen rücken in den Vordergrund: "IPS [...] produces information that has a content and function considered appropriate to the Third World, with an emphasis on development. This means more attention to analysis and background [...]" (Giffard 1984: 51).
Insgesamt sollen die Ereignisse stärker aus der Perspektive der Entwicklungsländer betrachtet und dargestellt werden.
2. IPS - eine "alternative" Nachrichtenagentur ?
2.1 Der MacBride-Bericht und die Forderung nach einem "freien und ausgewogenen Informationsfluß"
Die Diskussion um eine neue internationale Informations- und Kommunikations-ordnung, die in den siebziger Jahren geführt wurde, entsprang in weiten Teilen den kommunikationspolitischen Debatten der UNESCO. Die Forderung der seit den fünfziger Jahren neu gegründeten Staaten nach einer "neuen Weltinformations-ordnung" stand bereits im Raum, als die 19. Generalversammlung der UNESCO 1976 die Ernennung einer internationalen Expertenkommission zu Untersuchung aller weltweiten Kommunikationsprobleme beschloß. Es sollte damit vor allem ein wissenschaftliches Fundament für zukünftige kommunikationspolitische Initiativen der UNESCO geschaffen werden.
Unter dem Vorsitz des irischen Nobelpreisträgers Sean MacBride wurde die "Internationale Kommission zur Untersuchung der Kommunikationsprobleme" 1977 konstituiert; sie legte ihren ausführlichen Schlußbericht 1980 der UNESCOGeneralkonferenz in Belgrad vor (vgl. Breinig 1987:107-108).
Dieser "MacBride-Bericht" stellte offenkundige Unausgewogenheiten in der Kommunikation fest. Der "freie" Kommunikationsfluß, so die Kommission, sei nicht mehr als eine "Einbahnstaße", die von Nord nach Süd, von den Industrienationen in die Entwicklungsländer, führte. Das Prinzip des freien Kommunikationsflusses müsse deshalb um die Forderung nach Ausgewogenheit ergänzt werden.
Der Konzentration der Nachrichtenmedien in wenigen Industrienationen und dem daraus resultierenden vertikalen Informationsfluß von "Oben" (= entwickelte Welt) nach "Unten" (= Entwicklungsländer) soll nach den Empfehlungen der Experten eine universelle Informationsfreiheit entgegengesetzt werden, in der der horizontale Informationsaustausch zwischen den Entwicklungsländern von der UNESCO stärker gefördert wird, z.B. durch Koordination einzelner Aktivitäten, Forschung, Finanzierung und praktische Medienhilfe (vgl. Breinig 1987: 110-112).
Noch auf der Belgrader Konferenz wurde als erste Maßnahme ein internationales Hilfsprogramm zur Entwicklung der Kommunikation ("International Programme for the Development of Communication" - IPDC) beschlossen, das auch zum Aufbau und zur Förderung regionaler Nachrichtendienste genutzt werden sollte (vgl. Longin/ Wilke 1993: 268).
2.2 IPS und der MacBride-Report
Der MacBride-Bericht übt im Bereich der Nachrichtenberichterstattung konkret Kritik an der einseitigen Richtung des Informationsflußes von Norden nach Süden, an der Auswahl und Bearbeitung der Nachrichtenthemen nach Interesse und Blickwinkel der Industrienationen3 und an der Tatsache, daß die Nachrichtenakteure zu einem Großteil Eliten darstellen, d.h. hohe Politiker, Wirtschaftsmanager usw.
Weicht IPS aber wirklich von der so kritisierten Berichterstattung ab, erfüllt die Agentur die Forderungen der MacBride-Kommission und stellt damit eine echte "Alternative" zu den Weltagenturen dar ?
Maßstäbe zu Beantwortung dieser Frage könnten sein:
1) der Informationsflu ß und die geographischen Räume die mit der Berichterstattung abgedeckt werden, d.h. woher kommen die Nachrichten ?
2) die Nachrichteninhalte/ - Schwerpunkte, d.h. über welche Themen wird bevorzugt berichtet ?
3) die Nachrichtenakteure, d.h. wer kommt in den Nachrichten vor, wird zitiert/ als Quelle benutzt ? und
4) die Darstellungsformen, d.h. wie werden die Themen verarbeitet ?
Den folgenden Ausführungen liegt eine Analyse der IPS-Nachrichten zugrunde, die Anthony Giffard und Catherine van Horn 1992 durchführten. Ziel der Untersuchung war eine Beurteilung der IPS-Arbeit anhand der von der MacBride-Kommission aufgestellten Forderungen und Empfehlungen.
Die Analyse führte - grob zusammengefasst - zu folgenden Ergebnissen:
zu 1) Informationsflu ß
1992 hatten 2/3 der von IPS verbreiteten Nachrichten in Entwicklungsländern ihren Ursprung, dazu hatte ein Großteil der aus den Industrienationen stammenden Nachrichten direkten Themenbezug zu den Interessen der "Dritten Welt" (z.B. Meldungen aus Washington über die Aktivitäten der Weltbank). Einen Berichterstattungsschwerpunkt hatte IPS in Lateinamerika - von dort kamen über 35% der Nachrichten, was auf die Geschichte der Agentur zurückzuführen ist (vgl. Giffard/ van Horn 1992: 151-154).
zu 2) Nachrichtenschwerpunkte
Bei IPS wie bei den westlichen Agenturen lag der inhaltliche Schwerpunkt der Berichterstattung auf den Gebiet "Politik" (je um 30%). An zweiter Stelle standen bei IPS wirtschaftliche Themen (25%), mit 11% folgten militärische An-gelegenheiten.
Verglichen mit den westlichen Agenturen ging IPS zudem überproportional häufig auf Kultur, Umwelt und Menschenrechte ein. (vgl Giffard/ van Horn 1992: 156-158). IPS berichtete außerdem wesentlich positiver über die Ereignisse in der "Dritten Welt", als dies die westlichen Agenturen taten; d.h., daß z.B. Meldungen über Krisen, Katastrophen, Korruption und änliches eine weit geringeren Anteil an der Gesamtberichterstattung hatten (vgl. Giffard/ van Horn 1992: 158-159). zu 3) Nachrichtenakteure/ Handlungsträger
Geographisch kamen 60% der Akteure in den IPS-Nachrichten aus Entwicklungsländern, ein Großteil von ihnen aus Lateinamerika.
Über 43% der Nachrichtenakteure waren offizielle Regierungsvertreter, der Anteil der in den Nachrichten vertretenen "normalen Leute" war auch bei IPS mit 12% sehr gering. Nur 9% der Handlungsträger waren Frauen. (vgl. Giffard/ van Horn 1992: 159-163)
zu 4) Darstellungsformen/ formale Aufmachung
Insgesamt gesehen nahm auch bei IPS der Trend zur kurzen Meldung zu, allerdings war noch immer eine große Zehl der IPS-Meldungen außergewöhnlich lang. 30% der Meldungen hatten 1982 eine Länge von mehr als dreißig Zeilen, dabei wurde häufig auf journalistische Formen wie "Bericht" oder "Feature" zurückgegriffen, die detaillierte Hintergrundinformationen zulassen. (vgl Heyn/ Uekermann 1984: 444 und 447)
2.3 IPS - alternativ im Sinne des MacBride-Reports ?
Anhand der Untersuchungsergebnisse läßt sich zusammenfassend urteilen: größten-teils erfüllt IPS die Kriterien der MacBride-Kommission für eine "alternative" Nachrichtenagentur.
So trägt IPS zu einer Verbesserung des Süd-Süd- bzw. Süd-Nord-Informationsflusses bei, indem die Agentur deutlich mehr Nachrichten aus der und über die "Dritte Welt" verbreitet, als dies z.B. die "Big Four" tun. Die Nachrichten bieten häufiger Hintergrundinformationen und eine kontext-orientierte Analyse der Ereignisse, was einerseits den Informationsaustausch zwischen den Entwicklungsländern vorantreibt, andererseits aber auch im Norden Interesse und Verständnis für die Geschehnisse im Süden weckt.
Die Auswahl der Nachrichtenthemen orientiert sich in einem verstärkten Maße an den Bedürfnissen und Interessen der Entwicklungsländer. Besonders wirtschaftliche Themen finden große Beachtung, was zumindest der ökonomischen Seite von Entwicklungsprozessen Rechnung trägt.
IPS gelingt es, die Ereignisse in der "Dritten Welt" in der Berichterstattung nicht einseitig negativ darzustellen oder auf die großen Probleme, Krisen und Katastrophen zu reduzieren. Die Agentur beobachtet das Geschehen tatsächlich aus einem "Dritte-Welt-Blickwinkel" heraus, auch, indem ein Großteil der Nachrichtenakteure aus Entwicklungsländern kommt.
Dennoch schafft es IPS nicht, neben den "Eliten" neue Nachrichtenakteure zu erschließen. Regierungsvertreter und "Offizielle" dominieren als Handlungsträger auch in den Nachrichten der "alternativen" Nachrichtenagentur, und es gelingt IPS auch nicht, verstärkt Frauen in die Berichterstattung einzubeziehen.
Insgesamt kann die IPS-Berichterstattung aber als "alternativ" im Sinne des MacBrideReports beurteilt werden. Die Dienste von IPS unterscheiden sich stark von denen der kritisierten westlichen Agenturen und nehmen klar Bezug auf die Forderungen des MacBride-Reports. (vgl Giffard/ van Horn 1992: 166-167)
Die "Mißstände" sind teilweise strukturell bedingt, z.B. ist es in vielen Regionen aufgrund der fehlenden Infrastruktur oder des politischen Systems schwierig, andere Handlungsträger als die offiziell verfügbaren (= Regierungsvertreter) zu gewinnen: "[...] IPS may have to expend extra effort to overcome structural barriers that prevent news outside of the realm of male elites." (Giffard/ van Horn 1992: 167)
3. Die Position von IPS auf dem internationalen Nachrichtenmarkt
3.1 (wirtschaftliche) Konkurrenzfähigkeit
1990 verbreitete IPS knapp über 100 000 Wörter täglich - AP hatte zur gleichen Zeit einen Ausstoß von 17 Millionen Wörtern pro Tag, UPI verbreitete 11 Millionen Wörter, AFP 3,35 Millionen und Reuters 1,5 Millionen (vgl. Altschull 1990: 262). Natürlich sind diese Zahlen etwas veraltet, doch sie zeigen deutlich die Relationen: rein an der Wortproduktion gemessen, ist IPS auf dem internationalen Nachrichtenmarkt weitgehend bedeutungslos.
Auch bezüglich der Umsätze kann IPS mit den "Big Four" nicht mithalten: 1982 4 hatte IPS einen Umsatz von unter 5 Mio. $, verglichen mit den 110 Mio.$ bei UPI oder 190 Mio. $ bei AP (vgl. Giffard 1984: 49) sozusagen "peanuts".
Wie bereits erwähnt, ist IPS teilweise noch immer abhängig von externen "Finanzspritzen" durch Organisationen und Regierungen - sicherlich keine ideale Voraussetzung, um als Wirtschaftsunternehmen auf dem internationalen Nachrichtenmarkt zu konkurrieren. Insgesamt ist es allerdings problematisch, die "non-profit" - Kooperative IPS, die sich über ihre politischen Ansprüche dazu verpflichtet hat, gerade in finanziell schwachen Ländern Aufbauhilfe zu leisten, in denen keine großen Umsätze zu erwarten sind, mit profitorientierten Wirtschaftsunternehmen wie den Weltagenturen zu vergleichen (vgl. Giffard 1984: 49).
3.2 Einfluß auf dem internationalen Nachrichtenmarkt
Wie bereits angedeutet, hat IPS nach konventionellen Maßstäben für die Konkurrenzund Leistungsfähigkeit einer Nachrichtenagentur - Wortproduktion, Umsatz usw. - so gut wie keinen Einfluß auf dem weltweiten Nachrichtenmarkt.
IPS selbst hat es sich allerdings auch gar nicht zum Ziel gemacht, auf dieser Ebene mit den Weltagenturen zu konkurrieren. Die Agentur will mit anderen Themen, Inhalten und Darstellungsformen andere Märkte erreichen - "While IPS cannot compete with the Big Four in scope and speed, it can focus on different topic and different actors, for different audiences." (Giffard 1984: 50) - und in diesem Bereich ist IPS durchaus erfolgreich.
Zwar konnte sich IPS auf den gewinnträchtigen Märkten Nordamerikas und Europas kaum etablieren (hier hat die Agentur gerade im Medienbereich nur wenige Abonnenten), in den Entwicklungsländern aber, in denen die großen Agenturen kaum Aktivitäten zeigen, hat sich IPS eine beachtliche Position erarbeitet.
Dabei kann die IPS-Agentur auch auf das weltweit fünftgrößte Netzwerk zurückgreifen, daß sie gemeinsam mit IPS-Telecommunications unterhält und erweitert und das auch als Grundlage für die teilweise sehr enge Zusammenarbeit mit nationalen Nachrichtenagenturen und regionalen Netzwerken dient (vgl. IPS-Büro Bonn 1997 und IPS 1997 c)). Zu bemerken ist auch, daß IPS nicht nur "Unternehmen", sondern gleichzeitig auch anerkannte Nicht-Regierungs-Organisation ist.
Die Agentur ist gewissermaßen eine "politische Institution", was ihr Einfluß z.B. im Wirtschafts-und Sozialrat der UNO5 sowie finanzielle und ideelle Unterstützung durch die verschiedensten - staatlichen und nichtstaatlichen - Partner sichert (vgl. IPS 1997 a)). So hat IPS nicht etwa großen ökonomischen oder journalistischen, sondern eher politischen Einfluß auf den internationalen Nachrichtenmarkt.
3.3 politische Angriffe auf IPS
Als die Diskussion um die NIIKO zu Beginn der achtziger Jahre konkretere Formen annahm, der MacBride-Bericht verabschiedet wurde und sich die UNO den Vorwürfen gegen das herrschende, von westlichen Interessen dominierte Kommunikationssystem anschloß, wurde in einigen Industrienationen, besonders in den USA, Kritik an der informationspolitischen Linie der UNESCO laut.
Die UNESCO, so z.B. ein AP-Bericht vom 21.Oktober 1980, mache sich zum Instrument kommunistischer- und "Dritte-Welt"-Nationen, die ihre Mehrheit im UN-Gremium nutzten, um die Kontrolle über die internationale Berichterstattung zu erlangen. In den US- amerikanischen Medien wurde das Ende des freien Informations-und Nachrichtenflusses durch die (finanzielle) Übervorteilung einiger Agenturen, darunter IPS, beschworen.(vgl. Altschull 1990: 277-282)
Die Kritik richtete sich auch deshalb gegen IPS, weil die Agentur in dieser Zeit ideell eng mit der UNESCO verbunden war und mit dem UNDP, dem Entwicklungs-programm der Vereinten Nationen, über eine mögliche Zusammenarbeit und den Aufbau eines gemeinsamen Kommunikationsnetzwerkes verhandelte.
IPS wurden in einem Artikel des Washington Star antiwestliche Einstellungen unterstellt. Die Agentur, so die Vorwürfe, würde antiimperialistische Absichten verfolgen und Befreiungsbewegungen wie die PLO, die nicaraguanischen Sandinisten und die afrikanischen Guerillakämpfer durch seine Berichterstattung unterstützen. (vgl. Salamanca Orrego 1993: 145)
Man warf IPS sogar die Absicht vor, sich zu einer "international operierenden Presseagentur zu entwickeln, um mit AP und UPI, den großen US-Agenturen in Wettbewerb zu treten." (Salamanca Orrego 1993: 147).
Die Weltagenturen betrachteten IPS also durchaus als Konkurrenz, gerade auf dem Nachrichtenmarkt der "Dritten Welt". IPS pflegte gute Kontakte zu den dortigen Regierungen und den nationalen Presseagenturen, und so mußten auch AP und UPI fürchten, in einigen Ländern bald nur noch unwesentliche Positionen auf dem lokalen Nachrichtenmarkt zu bekleiden, sowohl in ökonomischer als auch in "machtpolitischer" Hinsicht (vgl. Giffard 1984: 56).
Heute hat sich mit der Diskussion um die NIIKO auch die politische Debatte um Agenturen wie IPS gelegt. Das mag insbesondere daran liegen, daß sich IPS in den vergangenen Jahren nicht als ökonomische Bedrohung der "Big Four" auf dem internationalen Nachrichtenmarkt behaupten konnte.
III. Schlußbetrachtung
1. Erfült IPS die eigene Zielsetzung ? - Zusammenfassung und Bewertung
Wie bereits dargelegt, verfolgt IPS mit seiner journalistischen Arbeit auch weit-reichende politische Ziele - Stichwort ist hier "Demokratisierung der Kommuni-kation". Während die Agentur es schafft, ihre journalistischen Ansprüche weitgehend zu erfüllen (s.o., 2.2.), ist es natürlich schwieriger, politische Interessen weltweit durchzusetzen, gerade in Konkurrenz zu den westlichen Weltagenturen.
IPS stößt dabei oft genug auf strukturell bedingte Grenzen wie z.B. politische Systeme, ökonomische Gegebenheiten und Infrastrukturen, die eine relativ kleine und finanzschwache "Organisation" nicht im Alleingang überwinden kann.
Insgesamt denkt IPS wohl zu idealistisch, z.B. in der Vorstellung den gesamten internationalen Informationsfluß zugunsten der Entwicklungsländer "umlenken" zu können. Man will zuviel erreichen, ohne die entsprechenden Mittel dazu zu haben.
Es ist allerdings zu würdigen, daß IPS die eigenen Ansätze relativ konsequent verfolgt, und das nicht nur im Bereich der Nachrichtenagentur, sondern gerade auch in der Kombination der verschiedenen Arbeitsbereiche News Service, Projects und Telecommunications. Wenn IPS auch im Vergleich zu den "Big Four" nach traditionellen Gesichtspunkten keine Chance auf dem internationalen Nachrichtenmarkt hat, kann die Agentur mit ihren Diensten eine echte Alternative zu "herkömmlichen" Nachrichten bieten.
Insofern konnte IPS zumindest sein kurzfristiges Ziel, die alternative Nachrichtenberichterstattung, erreichen.
2. Ausblick: Zukünftige Aufgaben von IPS
Die größte Herausforderungen von IPS liegen sicherlich in der Einbindung des ehemaligen Ostblocks in die internationalen Nachrichtenströme.
Mit dem Zusammenbruch der dortigen politischen Systeme versanken auch die entsprechenden, auf den Erhalt der Regime ausgerichteten Nachrichtenagenturen in der Bedeutungslosigkeit, was dazu führte, daß auch in Osteuropa die "Big Four" auf den Nachrichtenmarkt drängten - mit ähnlichen Folgen für die Berichterstattung, wie sie in den Entwicklungsländern zu beobachten sind.
Ist die Nachrichtengebung über die Ereignisse in Rußland und einigen anderen großen GUS-Staaten noch relativ ausgeprägt, wird den kleineren, wirtschaftlich und politisch für den Westen weniger bedeutsamen Ländern nur bei Krisen, Kriegen und großen Affairen Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Entwicklungen, die auch diese Länder durchmachen, bleiben im Verborgenen - eine deutliche Parallele zur Berichterstattung über die "Dritte Welt".
Erste Schritte in Richtung Osteuropa geht IPS-Projects mit der Fortbildung und Unterstützung osteuropäischer JournalistInnen und mit einem Programm zur Vernetzung der Medien in ost- und mitteleuropäischen Ländern. Daneben bemüht sich die IPSNachrichtenagentur um eine stärkere Einbeziehung des ehemaligen "Ostblocks" in die Nachrichtenberichterstattung.
Ein weiteres goßes Ziel von IPS sollte es in der Zukunft auch sein, für die "alternative" Art der Berichterstattung mehr Interessenten gerade in Westeuropa und in Nordamerika zu gewinnen. IPS muß dabei die Balance halten zwischen politischem und journalistischem Anspruch und der Notwendigkeit, Nachrichten und andere journalistische Produkte zu verkaufen, das heißt die Finanzierung der IPS-Gruppe auf eine feste Basis zu stellen und die ökonomischen Abhängigkeiten zu überwinden.
Allerdings nimmt m.E. das Interesse der "Ersten Welt" an den Ereignissen und Entwicklungen in der "Dritten Welt" insgesamt zu, so daß IPS mit seinem Angebot durchaus im Trend liegt und mit seinem Konzept einige Chancen in der Zukunft haben dürfte.
Literatur
Alscheid-Schmidt, Petra (1991): Die Kritik am internationalen Informationsfluß, Frankfurt.
Altschull, J. Herbert (1990): Agenten der Macht. Die Welt der Nachrichtenmedien - eine kritische Studie, Konstanz.
Breinig, Christian (1987): Kommunikationspolitik der UNESCO. Dokumantation und Analyse der Jahre 1946-1987, Konstanz.
Giffard, C. Anthony (1984): Inter Press Service: News From the Third World. In: Journal of Communication 34, 4, 41-89.
Ders./ Catherine von Horn (1992): Inter Press Service and the MacBride Report: heeding the call ? In: Gazette 50, 147-168.
Heyn, J Ürgen/ Heinz R. Uekermann (1984): Nachrichtenberichterstattung aus einer Süd- Nord-Perspektive. Inter Press Service als eine Alternative zum Dritte-Welt- Themenangebot von Associated Press. In: Publizistik 29, 440-448.
Inter Press Service B Üro Bonn (1997): IPS Fact Sheets. (Informationsmaterial und Selbstdarstellung)
Inter Press Service (1997):
A) IPS- PARTNERS. (Online im Internet) URL: http://www.ips.org/Partners.htm
B) IPS-PRODUCTS. (Online im Internet) URL: http://www.ips.org/Products.htm
C) IPS-STRUCTURE. (Online im Internet) URL: http://www.ips.org/Structure.htm (Stand: 18.02.1997)
Salamanca Orrego, Daniel Federico (1993): Medienpolitik für die Dritte Welt: Inter Press Service (IPS). Geschichte und Struktur einer Dritte-Welt-Nachrichten- agentur, Frankfurt.
Wilke, J Ürgen/ Christine Longin (1993): Nachrichtenagenturen in der Dritten Welt. In: Wilke, Jürgen (Hrsg.): Agenturen im Nachrichtenmarkt, Köln, 283-309.
[...]
1 u.a. Neue Züricher Zeitung, Frankfurter Rundschau, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die tageszeitung, Die Zeit, Spiegel.
2 IPS gibt keine genauen Zahlen an, die Liste derer, die als externe Unterstützer genannt werden, ist jedoch lang. Als Beispiele sollen an dieser Stelle für Deutschland die Carl-Duisburg- Gesellschaft, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit und das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit genügen. (IPS-Büro Bonn 1997)
3 zur "Qualität der Dritte-Welt-Berichterstattung transnatinaler Agenturen" vgl. auch AlscheidSchmidt 1993: 75-78
4 Auch hier geht es weniger um die - veralteten - konkreten Zahlen, sondern um das Verhältnis !
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt die alternative Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS) und ihre Position auf dem internationalen Nachrichtenmarkt.
Was sind die Hauptziele dieses Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, IPS vorzustellen, ihre Rolle im Kontext des MacBride-Berichts zu bewerten und ihre Position im Vergleich zu den großen Weltnachrichtenagenturen zu analysieren.
Was ist Inter Press Service (IPS)?
IPS ist eine Nachrichtenagentur, die 1964 gegründet wurde, um alternative Informationen bereitzustellen und die Integration der "Dritten Welt" in den Nachrichtenmarkt und die internationale Politik zu fördern.
Wie entstand und entwickelte sich IPS?
IPS entstand aus der Roman Press Agency und konzentrierte sich zunächst auf Lateinamerika. Später erweiterte sie ihre Aktivitäten auf Afrika, Asien, Europa und die arabische Welt. Sie erlebte Rückschläge durch Militärdiktaturen in Lateinamerika und konzentrierte sich auf Kooperationen mit anderen Nachrichtenagenturen wie TANJUG.
Wie ist IPS aufgebaut und strukturiert?
IPS ist als Genossenschaft italienischen Rechts organisiert und umfasst verschiedene "Unternehmen". Sie gliedert sich in IPS-News Service (Nachrichtenagentur), IPS-Telecommunications (Technologietransfer) und IPS-Projects (Weiterbildung, Medienvernetzung etc.).
Wie finanziert sich IPS?
IPS finanziert sich durch den Verkauf ihrer journalistischen Produkte, Carrier-Dienste und externe Unterstützung durch Stiftungen, Hilfsprogramme und Fördermittel.
Welche Ziele verfolgt IPS?
IPS zielt darauf ab, den Süd-Süd- und Süd-Nord-Informationsfluss zu stärken, die demokratische Teilnahme zu fördern und die Rolle der Frauen zu stärken. Sie strebt eine globale Kommunikationsstrategie an, die Zivilgesellschaft, politische Entscheidungsträger und Medien zusammenbringt.
Was ist der MacBride-Bericht und welche Rolle spielt er für IPS?
Der MacBride-Bericht an die UNESCO kritisierte die unausgewogene Kommunikation und forderte einen "freien und ausgewogenen Informationsfluss". IPS wird im Kontext des MacBride-Berichts als eine "alternative" Nachrichtenagentur betrachtet.
Inwiefern ist IPS eine "alternative" Nachrichtenagentur im Sinne des MacBride-Berichts?
IPS trägt zur Verbesserung des Süd-Süd- und Süd-Nord-Informationsflusses bei, berichtet über Themen aus der Perspektive der Entwicklungsländer und vermeidet eine einseitig negative Darstellung der "Dritten Welt".
Welche Position nimmt IPS auf dem internationalen Nachrichtenmarkt ein?
IPS kann nicht mit den großen Weltagenturen in Bezug auf Wortproduktion oder Umsatz konkurrieren. Ihr Einfluss liegt eher in ihrem politischen Engagement und ihrer Position als anerkannte Nichtregierungsorganisation (NGO).
War IPS politischen Angriffen ausgesetzt?
Ja, in den 1980er Jahren wurde IPS kritisiert und antiwestliche Einstellungen unterstellt, insbesondere im Zusammenhang mit der Diskussion um die Neue Internationale Informations- und Kommunikationsordnung (NIIKO).
Welche Schlussfolgerungen werden in Bezug auf die Zielerreichung von IPS gezogen?
IPS erfüllt ihre journalistischen Ansprüche weitgehend, stößt aber auf strukturelle Grenzen bei der Umsetzung ihrer politischen Ziele. Sie ist eine echte Alternative zu "herkömmlichen" Nachrichten, auch wenn sie idealistisch ist.
Welche zukünftigen Aufgaben werden für IPS identifiziert?
Zu den zukünftigen Aufgaben von IPS gehören die Einbindung des ehemaligen Ostblocks in die internationalen Nachrichtenströme und die Gewinnung von mehr Interessenten für ihre "alternative" Berichterstattung in Westeuropa und Nordamerika.
Welche Literatur wird in diesem Dokument zitiert?
Das Dokument zitiert verschiedene Werke zur internationalen Kommunikation, Nachrichtenagenturen und der Rolle von IPS, darunter Arbeiten von Alscheid-Schmidt, Altschull, Breinig, Giffard, Heyn/Uekermann, Salamanca Orrego und Wilke/Longin.
- Quote paper
- Svenja Kunze (Author), 1997, Die Alternative Nachrichten Agentur IPS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95149