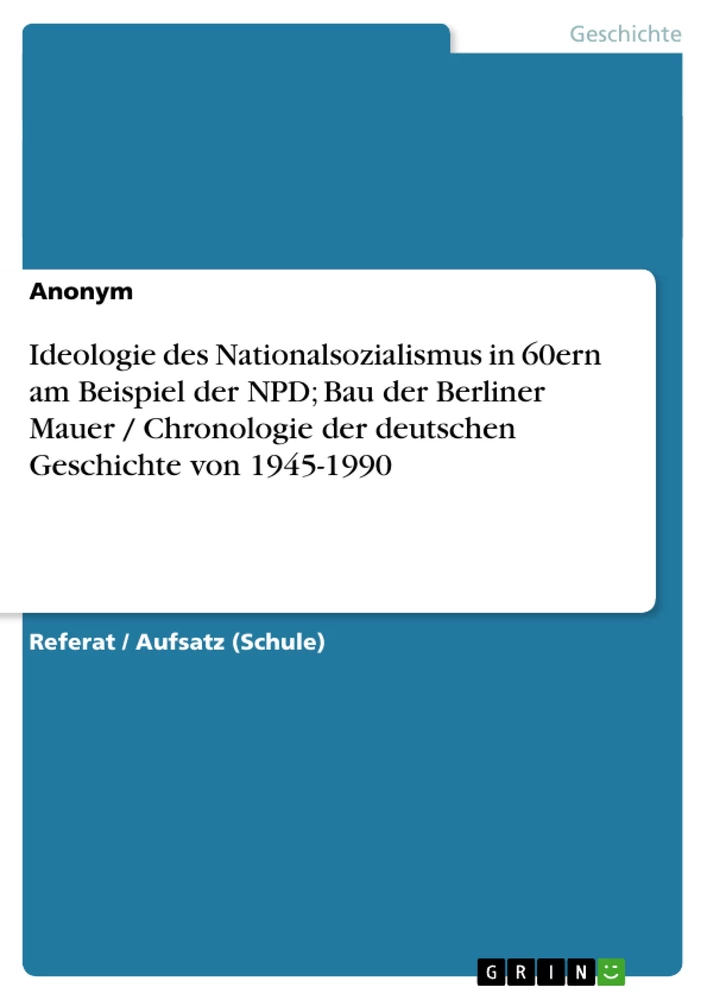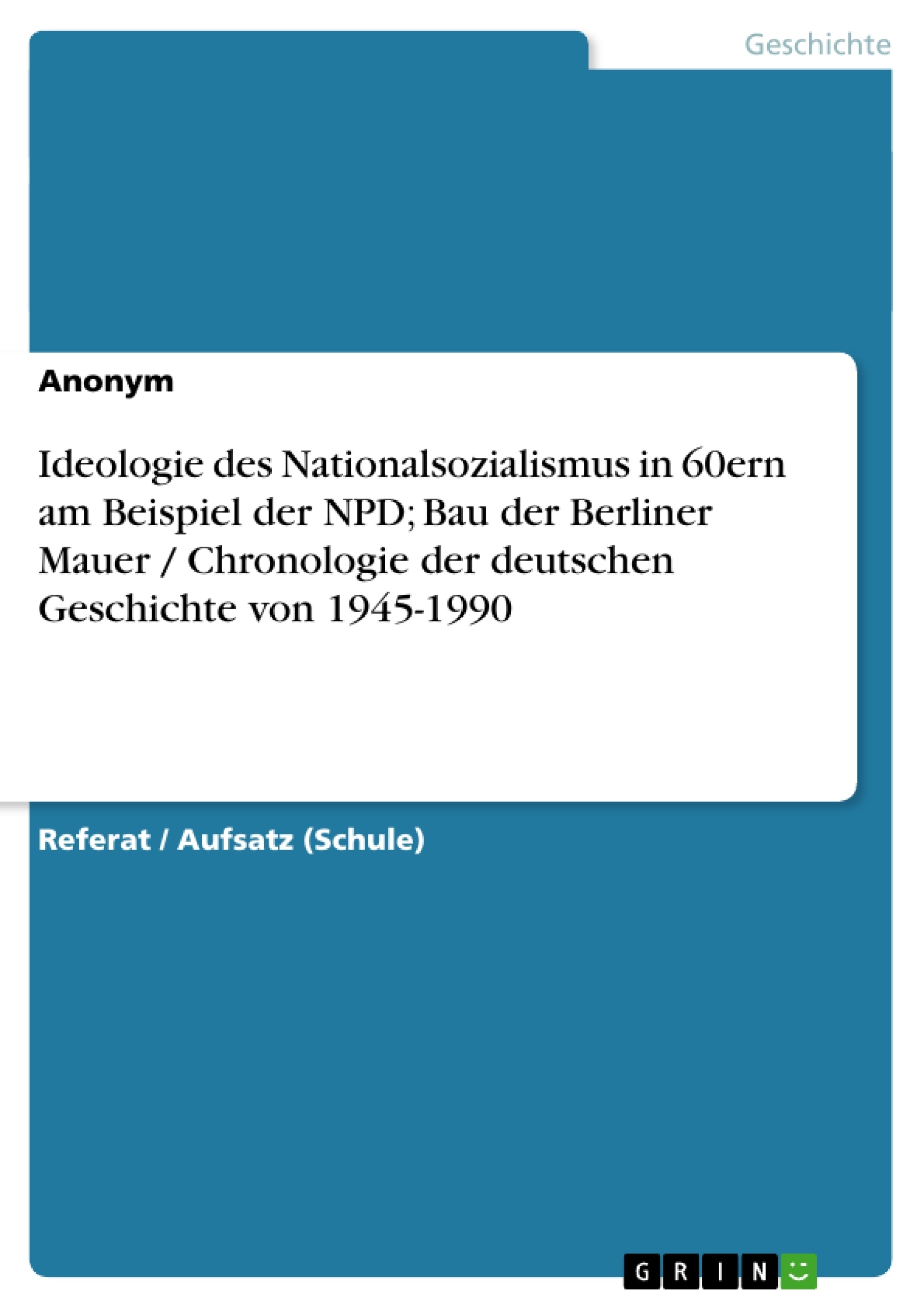Kaum eine Partei erregte die öffentliche Diskussion in den 60’er Jahren so sehr wie die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Nach dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei 1952 und der hoffnungslosen Zersplitterung des rechtsextremen Spektrums der deutschen Parteienlandschaft war es einer nationalen Sammlungspartei erstmals wieder gelungen, diese Kräfte zu vereinen und bedeutsame Wahlerfolge zu erringen. Die etablierten Parteien und die durch Studentenunruhen sensibilisierte Öffentlichkeit reagierten heftig gegen die vermeintliche "rechte Gefahr", die das demokratische System der Bundesrepublik zu bedrohen schien. In dieser Arbeit will ich mich vorrangig mit der Ideologie dieser Partei befassen, beleuchte aber auch kurz ihre Geschichte.
Inhaltsverzeichnis
1. Chronologie der dt. Geschichte von 1945 bis 1990
1.1. Chronologie der westlichen Besatzungszonen und der späteren BRD
1.2. Chronologie der östlichen Besatzungszone und der späteren DDR
2. Die Ideologie des Rechtsextremismus in den 60ern am Beispiel der NPD - eine Erscheinung der Wirtschaftskrise?
2.1. Einleitung
2.2. Entstehung, Aufstieg und Abstieg der NPD
2.3. Die Ideologie der NPD
2.3.1. Die Wählerstruktur
2.4. Schlußwort und persönliche Wertung
3. Der Bau der Berliner Mauer
3.1. Einleitung
3.2. Das sowjetische Ultimatum vom November 1958
3.3. Vom Ultimatum zur Mauer
3.4. Die Situation nach dem Mauerbau
3.5. Die Bedeutung des Mauerbaus für die DDR
3.6. Die Bedeutung des Mauerbaus für die BRD und West-Berlin
3.7. Schlußwort
4. Literaturverzeichnis
4.1. Chronologie
4.2. Problem 1
4.3. Problem 2
4.4. Anhang
5. Anhang mit Bildern, Tabellen
1. Chronologie
1.1. Chronlogie der westlichen Besatzungszonen und der späteren BRD
Eine Tabelle mit allen Bundespräsidenten und den Kanzlern befindet sich, wie weitere Bilder, im Anhang.
1945
7.6/ 9.6 Kapitulation der deutschen Wehrmacht
5.6 Aufteilung Deutschlands in 4 Besatzungszonen
Juli Alliierten rücken in Deutschland ein
17.7.- 2.8. Potsdamer Konferenz
8.8. Beginn der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse
30.8. Errichtung des Alliierten Kontrollrates in Berlin
5.10.- 7.10. Gründung der SPD
10.10. Gründung der CSU
14.10.- 16.10. Gründung der CDU
1946
6.1./ 7.1. Gründung der FDP
30.9.- 1.10. Verkündung der Urteile der Kriegsverbrecherprozesse
12.10. Beginn der Verhaftung von Nazis
2.12. Vereinigung der amerikanischen und britischen Zone zur Bizone
1947
3.2. Ahlener Programm der CDU (Verstaatlichung von Betrieben)
25.2. Staat Preußen aufgelöst
22.4.- 25.4. Gründung des DGB
1948
23.2.- 7.6. Londoner Sechsmächtekonferenz
20.3. Ende des Alliierten Kontrollrates, da SU ihn verläßt
21.6. Beginn der Währungsreform
24.6. Beschluß soziale Marktwirtschaft einzuführenà darauf Beginn Berlinblockade
1.7. Frankfurter Dokumente
1.9. Beginn der Arbeit des parlamentarischen Rates (bereits 10.8.- 23.8. Vorarbeiten an Verfassung)
1949
6.4.- 8.4. Beschluß der Einrichtung der Hohen Kommision + Trizone (Frk., GB, USA)
4.5. Ende der Berlinblockade
23.5. Verkündung des Grundgesetzes (8.6. angenommen)
15.7. Düsseldorfer Leitsätze der CDU (soziale Marktwirtschaft beschlossen)
14.8. Wahl zum Bundestag
12.9. Theodor Heuss 1. Bundespräsident
15.9. Konrad Adenauer 1. Bundeskanzler
21.9. Besatzungsstatut in Kraft getreten (Militärregierung aufgelöst)
31.10. BRD Mitglied der OEEC
22.11. Petersberger Abkommen
15.12. Marshallplan in Kraft
1951
15.2. Schaffung des Bundesgrenzschutzes
6.3. BRD erhält Vollmachten in Außenpolitik ? Aufnahme in Europarat
11.1. Gründung der Montanunion
26.5. Bonner Konvention
23.10. Verbot der Sozialistischen Reichspartei (Nachfolger NSDAP)
1953
27.2. Londoner-Schulden-Abkommen (regelt Kriegsschulden)
6.9. Bundestagswahl
1954
26.2. Wehrhoheit der BRD beschlossen
28.9.- 3.10. Londoner Neun-Mächte-Konferenz
19.10.- 23.10. Pariser Konferenzen (führen zu Pariser Verträgen)
1955
? Hallstein-Doktrin verkündet
5.6. Verkündung der vollen Souveränität der BRD (Beitritt zur NATO/ Brüsseler Pakt)
5.9. Landwirtschaftsgesetz (Neuordnung der Landwirtschaft)
ab September Aufnahme politischer Beziehungen zur SU
1956
6.7. Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
26.7. Gründung der Bundesbank
17.8. Verbot der KPD
27.10. Saargebiet endgültig a Deutschland
1957
15.10. Bundestagswahl (CDU/ CSU totale Mehrheit)
? Gründungsmitglied der EWG
1958
25.4. Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Handelabkommens
1960
August Kündigung des Interzonenabkommens
1961
13.8. Beginn des Mauerbaus
17.9. Bundestagswahl (CDU/ CSU verliert totale Mehrheit, Adenauer zum 4x Kanzler)
1962
Oktober Spiegelaffäre (Minister kündigten Rücktritt, wegen Verletzung der Pressefreiheit)
1963
16.10. Ludwig Erhradt Nachfolger von Adenauer
? Freundschaftsvertrag mit Frankreich
1965
Mai Bruch der Beziehungen mit arabischen Staaten
19.9. Bundestagswahl (CDU gewinnt, Erhardt Kanzler)
1966
27.10. Bruch der Koalition
1.12. Beginn einer Großen Koalition
1968
26.6. Billigung des Notstandgesetzes (bildete sich APO)
1969
29.9. Bundestagswahl (CDU gewinnt, Koaltion von FDP, SPD, Kanzler wird W. Brandt)
28.11. Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag
1970
26.3. Beginn der Vier-Mächte-Konferenz
12.8. Moskauer Vertrag
7.12. Warschauer Vertrag
1971
3.9. Ende der Vier-Mächte-Konferenz
1972
3.6. Inkrafttreten der Ost-Verträge
19.11. nach Auflösung des Bundestages neue Bundestagswahl (Koaltion SPD, FDP)
1973
21.6. Grundlagenvertrag mit DDR tritt in Kraft
18.9. Aufnahme in UNO
1974
Mai Brandt tritt nach Guillaume-Affäre zurück, Schmidt Kanzler
1975
Juli BRD Mitglied der Genfer Abrüstungskonferenz
1976
3.10. Bundestagswahl (Koalition SPD, FDP, Kanzler Schmidt)
1977
Oktober Entführung Schleyers, einer Lufthansamaschine in Mogadischu
? Höhepunkt der Studentenproteste (ab 1975)
1980
5.10. Bundestagswahl (Koaltion SPD, FDP)
1982
September Bruch der Koaltion (Mißtrauensvotumà Kohl wird Kanzler)
1983
6. März Bundestagswahlen, da Auflösung Bundestag (CDU/ CSU, FDP Koalitionà besteht bis heute)
ab 1982 erhöhtes Ansteigen der Arbeitslosenzahlen
1985
April/ Mai Besuch Kennedys in der BRD
1989
9.11. Verkündung der Reisefreiheit in der DDR
1990
31.8. Unterzeichnung des Einigungsvertrages
12.9. Zustimmung der ehemaligen Alliierten
3.10. Wiedervereinigung offiziell begangen
21.11. Ostblock stimmt zu
1.2. Chronlogie der östlichen Besatzungszone und der späteren DDR
Eine Tabelle mit allen Staatsoberhäuptern befindet sich, wie weitere Bilder, im Anhang.
ab 45 Schaffung eines sozialistischen Geistes in Kunst, Bildung, Kultur
April Gruppe "Ulbricht" trifft ein
7.6/ 9.6 Kapitulation der deutschen Wehrmacht
5.6 Aufteilung Deutschlands in 4 Besatzungszonen
9.6. Errichtung der SMAD
10.6. Genehmigung der Bildung antifaschistischer Parteien
11.6. Gründung der KPD
15.6. Gründung der FDGB und SPD
26.6. Gründung der CDU
5.7. Gründung der LDPD
14.7. Bildung des antifaschistischen Blocks
3.9. Beginn der Bodenreform
30.8. Errichtung des Alliierten Kontrollrates in Berlin
1946
21.4./ 22.4. Vereinigung SPD, KPD zur SED
1947
14.6. Bildung der Deutschen Wirtschaftskommission
6.12./ 7.12. 1. Dt. Volkskongreß
1948
23.4. Gründung der VVB
29.4. Gründung der Bauernpartei
25.6. Gründung der NDPD
23.6. Währungsreform
3.7. Gründung der kasernierten Volkspolizei
1949
15.5./ 16.5. 3. Dt. Volkskongreß
29.5. Annahme der Verfassung
7.10. Gründung der DDR
10.10. Umwandlung SMAD in SKK
1950
6.7. Anerkennung der Oder-Neiße Grenze in Görlitzer Vertrag
29.9. Beitritt zum RGW
1952
29.4. Umwandlung VVB in VEB
23.7. Teilung der DDR in 14 Bezirke und 217 Kreise
1953
28.5. SKK aufgelöst
17.6. Aufstand in DDR (durch sowjetische Truppen niedergeschlagen)
1954
25.3. Souveränitätserklärung der DDR durch SU
17.10. Volkskammerwahlen (94,5% für Einheitslistenà Wahlen nicht mehr erwähnt, da immer selbe Ergebnisse)
1955
20.9. Amt des Hohen Kommisars aufgehoben
1956
18.1. Schaffung der NVA
1958
13.2. staatliche Planungskommision zur Lenkung der Wirtschaft eingerichtet
1959
3.6. Gründung von LPGs beschlossen
1960
12.9. Amt des Präsidenten abgeschafft (Staatsrat eingeführt)
1961
13.8. Beginn des Mauerbaus
1962
24.5. Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
1964
12.6. Abkommen mit SU über Unantastbarkeit der Grenzen der DDR
1967
20.2. Gesetz über "Staatsbürgerschaft der DDR"
1968
ab 1968 Verschärfung der Strafen bei politischen Delikten
6.4. neue Verfassung der DDR angenommen
in 60ern verschärfte Kontrollen für West-Bürger an Grenzen
20.8./ 21.8. Beteiligung am Prager Frühling
1971
3.5. Nachfolger von Ulbricht wird Honecker
17.12. Transitabkommen mit BRD
1973
seit 70er Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage
21.6. Grundlagenvertrag mit BRD tritt in Kraft + diplomatische Beziehung zur NATO
1.8. Tod Ulbrichts
18.9. Aufnahme in UNO
1974
4.9. nimmt Beziehungen zu USA auf (internationale Anerkennung)
1976
22.5. Honecker Generalsekretär
1981
Dezember Besuch von Kanzler Schmidt
1982
15.7. Beginn der Stationierung von Kurzstreckenraketen
1983
1.7. BRD gibt DDR Kredit über 1 Mrd. DM
1984
seit 84 Flüchtlinge halten sich in Botschaften der BRD in Prag auf
1987
? Besuch Honeckers in der BRD
1989
Herbst Honecker tritt zurück; Nachfolger Krenz (7 Wochen an Macht); Nachfolger Modrow
Herbst Formierung oppositioneller Gruppen (Montagsdemos)
9.11. Verkündung der Reisefreiheit in der DDR à Flüchtlinge in Ungarn dürfen in Westen reisen
1990
Frühjahr Umbennenung der SED in PDS
31.8. Unterzeichnung des Einigungsvertrages
12.9. Zustimmung der ehemaligen Alliierten
3.10. Wiedervereinigung offiziell begangen
21.11. Ostblock stimmt zu
2. Die Ideologie des Rechtsextremismus in den 60ern am Beispiel der NPD - eine Erscheinung der Wirtschaftskrise?
2.1. Einleitung
Kaum eine Partei erregte die öffentliche Diskussion in den 60’er Jahren so sehr wie die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Nach dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei 1952 und der hoffnungslosen Zersplitterung des rechtsextremen Spektrums der deutschen Parteienlandschaft war es einer nationalen Sammlungspartei erstmals wieder gelungen, diese Kräfte zu vereinen und bedeutsame Wahlerfolge zu erringen. Die etablierten Parteien und die durch Studentenunruhen sensibilisierte Öffentlichkeit reagierten heftig gegen die vermeintliche "rechte Gefahr", die das demokratische System der Bundesrepublik zu bedrohen schien. In dieser Arbeit will ich mich vorrangig mit der Ideologie dieser Partei befassen, beleuchte aber auch kurz ihre Geschichte.
2.2. Entstehung, Aufstieg und Abstieg der NPD
Die Gründung der NPD am 28. November 1964 als eine Partei, die sich dem Alten Nationalismus der Weimarer Republik verpflichtet sah, kam am Anfang der 60er Jahre nicht von ungefähr. Von den zahlreichen rechtskonservativen Parteien, sofern sie nicht wie die Sozialistische Reichspartei (SRP) verboten worden waren, hatte nur die Deutsche Reichspartei (DRP) eine nennenswerte Bedeutung erlangt. Doch auch sie kämpfte Anfang der 60er Jahre mit Zersplitterungstendenzen und Auflösungserscheinungen. Der DRP war es in der Bundestagswahl von 1961, wie in den Jahren zuvor, wieder nicht gelungen, in das Parlament einzuziehen.
Die weitere Entwicklungsgeschichte der NPD läßt sich in mehrere Phasen einteilen. Als erste Phase kann man die Zeit von der Gründung bis zum Karlsruher Parteitag im Juni 1966 nennen. In dieser Zeit erfolgte der Aufbau und die Festigung der Parteiorganisation. Unterstützt wurde dies von zahlreichen Ortsverbänden. 1965 trat die NPD erstmals zu den Bundestagswahlen an und erzielte 2,0% der Stimmen. Zwei Jahre nach ihrer Gründung, im November 1966, hatte die NPD bereits 25000 Mitglieder und 23 Landtagsmandate. 1967 waren es bereits 61 Mandate. Bei der Bundestagswahl 1969 erlitt die Partei eine erschütternde Niederlage. Es hatte sich gezeigt, daß das Wählerpotential der NPD überwiegend aus Protestwählern bestand. Mit dem seit 1968 einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch mit dem der Bildung, entfielen diese Wähler. Die monatelange Verbotsdiskussion hatte ebenso Wirkung gezeigt, wie die Anti-NPD-Kampagnen in Gewerkschaften und Medien. Die Wählerschaft wechselte zur CDU/ CSU.
Es ist zu kritisieren, daß die Bundesregierung nicht Gebrauch von ihrem Recht machte die NPD zu verbieten. So entstanden zahlreiche Initiativen gegen die NPD. Auch das Ausland beäugte mißtrauisch den neu aufkeimenden Nationalsozialismus. Ohne diese Initiativen und den Wirtschaftsaufschwung, wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, daß die NPD in den Bundestag einzieht.
2.3. Die Ideologie der NPD
Eine Partei, die versucht Mitglieder und Wähler zu mobilisieren, muß versuchen, bestimmte soziale Gruppen anzusprechen und ihnen zu vermitteln, daß ihre Interessen bei ihr am besten aufgehoben sind. Die Konzentration auf eine in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Mittelschicht legte im Fall der NPD den Protest gegen eine moderne, liberale, demokratische und pluralistische Gesellschaft nahe. Eine obrigkeitsstaatliche, deutsche Tradition versprach, durch Einheit und Geschlossenheit den bedrohten sozialen Status der Mitglieder und Wähler zu sichern. Neben dieser sozialen Tendenz stellt der Sammlungscharakter der Partei ein zweites wichtiges Element dar. Da fast alle Sachfragen in der Partei kontrovers diskutiert wurden, blieb als Ideologie nur der Reflex auf die Erwartungen und Vorstellungen der möglichen Anhängerschaft. Schlagworte und Ideale mit denen die Parteigänger ähnliche Vorstellungen verbanden, wurden so zu integrativen Elementen, meist ohne Rücksicht auf ein logisch strukturiertes Ideologiegebäude. Das Parteiprogramm der NPD sowie öffentliche Äußerungen von Parteifunktionären waren stets so gehalten, ein juristisches Vorgehen gegen die Partei zu vermeiden. Das Verbot der SRP hatte die Gefahr einer staatlichen Gegenreaktion gezeigt. Gestalter der Parteiideolgie waren vor allem die aus der SRP stammenden Funktionäre. 1964 wurde auf dem Hannoverschen Parteitag das "Gründungsmanifest" der NPD verfaßt, das eine Sammlung vager national-konservativer Aussagen zu den Zielen der Partei beinhaltete. Das erste ordentliche Parteiprogramm der NPD folgte erst auf dem dritten Parteitag in Hannover, vom 10.-12. November 1967. Leitgedanken im ersten Parteiprogramm der NPD waren: Starke Betonung nationaler Gedanken in der Wirtschafts-, Erziehungs-, Verteidigungs- und Außenpolitik; Fremdenfeindlichkeit; Agrarromantik; Antiliberalismus; Antipluralismus; Aggressivität gegenüber der bestehenden demokratischen Gesellschaftsordnung. Damit hatte die NPD Ideen aufgegriffen, die seit der Weimarer Republik in Parteien wie der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und der NSDAP verbreitet gewesen waren, ohne sich jedoch mit einer dieser Parteien zu identifizieren. Das Programm war jedoch letztlich so gehalten, daß es zwar reichlich politische, jedoch kaum rechtliche Angriffspunkte bot. Auf dem Papier des Parteiprogramms offenbarte sich die NPD auf den ersten Blick als eine demokratische, bürgernahe und konservative Partei, die in keinem offenen Konflikt zu den Grundsätzen der freiheitlichen demokratischen Ordnung stand, jedoch auch keine klare politische Linie erkennen ließ. Günther Grass sagte einmal: "Hat die NPD ein Programm? Sie ist für die Todesstrafe und gegen Gastarbeiter. Sie stellt Ansprüche auf Gebiete, in denen, wie es heißt, das deutsche Volk seit Jahrhunderten gewachsen ist. Sie ist einfach schlicht gegen Entwicklungshilfe. Ist das ein Programm?" Dieses Zitat finde ich sehr treffend, da es zeigt, daß die NPD nur eine Partei ist, die versucht Stimmen zu gewinnen durch die Menschen provozierende Aussagen. Protestwähler machen 80% der Wählerschaft aus. Da die eigentlichen Ziele der NPD doch weitaus radikaler waren und noch immer sind, als dies im Parteiprogramm publiziert wurde, konnten diese nur an anderen Stellen zum Ausdruck kommen. Das 1967 erschienene "Politische Lexikon" und die Parteizeitung "Deutsche Nachrichten" übernahmen vorrangig diese Aufgabe. Beide erfüllten sozusagen eine propagandistische Aufgabe. Im Lexikon wird vor allem die neue Kultur kritisiert und eine übersteigerte nationale Weltanschauung präsentiert. Obwohl sich die NPD zum Grundgesetz und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekannte, vertrat sie dennoch die These, daß wirkliche Demokratie in der Bundesrepublik niemals realisiert worden wäre. Die auf solchen Überlegungen basierende ideale Staatsform konnte laut NPD nur ein Führerstaat sein. Die NPD vertrat sogar noch die Rassenlehre, was ein Ausschnitt aus ihrem Programm zeigt: "Die Grundartung und Gemeinschaft Menschheit entsproß nicht einer völlig gleichen Art und Gemeinschaft, sondern in großen getrennten Räumen in Unterarten und Untergemeinschaften, in Rassen mit verschiedenen leiblichen und geistigen Stilanlagen ...". Entsprechend diesen Ansichten einer Rasse werden auch antisemitische Dogmen vertreten, die in vielen Fällen an nationalsozialistische Propaganda heranreichen. Es wird gesagt, daß es nie einen Befehl zur Massenvernichtung von Juden gegeben hat- merkwürdig jedoch, daß die NPD auch heute noch Reisen nach Auschwitz unternimmt, die sich für mich als reine Provokation darstellen. Auch wird den Juden die Manipulation der Wirtschaft vorgeworfen, wie auch die der Politik. Der Nationalsozialismus wird nicht besonders hervorgehoben, die deutsche Vergangenheit aber glorifiziert. Das Leben dient einer Art "ökonomischer Lebensversorgung". Analog dieses Leitsatzes wird die Kriegsschuld von Deutschland gewiesen und die Schuld Frankreich und England gegeben, denn diese hätten Deutschland provoziert. Die Entnazifizierung wird als "tiefgehende Verfremdung des Denkens und Fühlens" hingestellt. Ein weiterer Punkt ist, daß Deutschlands alte Grenzen (Drittes Reich) wieder hergestellt werden sollen. Dazu gehört politische, wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Ausland. Eine Unabhängigkeit wird Deutschland vor Krisen schützen. So muß die Vorherrschaft der USA in Europa beendet werden. Die NPD würde bei einem Herrschaftsantritt eine Politik der Eindämmung Deutschlands betreiben. Der Kommunismus wird stark kritisiert und die Führer linksgerichteter Organisationen werden öffentlich angegriffen. Unter Kommunismus zählt die NPD auch die SPD, den DGB und sozialkritische Schriftsteller. Diese Ideologie hat sich bis heute kaum verändert, wenn sich ihre Ziele und Forderungen nicht sogar noch verstärkt haben. Ergänzt wurde die Ideologie durch das Thema Europa und seit neuestem auch dem Thema Euro. Die NPD lehnt eine Integration Deutschlands in Europa ab, wie auch den Euro, der, wie die NPD denkt, die deutsche Wirtschaft nur noch weiter ruinieren würde.
2.3.1. Wähler- und Mitgliederstruktur
Während in der Gründungsperiode der NPD sich die Parteimitglieder weitgehend aus der DRP und zahlreichen anderen national-konservativen oder rechtsextremen Gruppen rekrutierten, änderte sich dies mit dem Aufstieg der Partei. Gegen Ende der sechziger Jahre hatte sich die Sozialstruktur der NPD-Wähler an die der Gesellschaft der Bundesrepublik deutlich angenähert. Es hatte sich gezeigt, daß die Wahlerfolge der Partei auf eine sozial breit gefächerte Wählerschaft zurückgingen. Vor allem in wirtschaftlich schwachen Regionen gewann die Partei Anhänger aus allen Berufsgruppen. Ebenfalls zeigte sich, daß Mitglieder von Berufsgruppen, die von der Wirtschaftskrise der späten 60er Jahre stark betroffen waren, bundesweit mit der NPD sympathisierten. Wähler - unabhängig von der Einkommenshöhe -, obwohl man sagen muß, daß ein breiter Kreis aus mittelständigen Berufsgruppen kommt, die glaubten, es seien allgemein, oder für sie speziell schlechte Zeiten zu erwarten, neigten dazu, den autoritären Lösungsvorschlägen der NPD Gehör zu schenken. In katholischen Bevölkerungskreisen konnte die Partei jedoch nur geringe Erfolge verzeichnen. Frauen machen gerade mal 10% der Wählerschaft aus. Ziel war es, Rechte, NS-Mitläufer, Vertriebene, Soldaten, mittelständische Selbständige, Bauern und Facharbeiter zu mobilisieren. Verbindendes Element waren emotionale Aussagen zu Reizworten wie Kriegsschuld, Ordnung etc. sowie zu atmosphärischen Begriffen wie Einheit, Stärke, Treue. Es ist nicht anzunehmen, daß die Ideologieelemente in ihrer Gesamtheit allen Mitgliedern, geschweige denn der gesamten Wählerschaft bekannt waren. Im Zuge der politischen Arbeit wurden diese Elemente, die sich darüber hinaus in vielen Punkten logisch widersprachen, einzeln und der jeweiligen Situation angemessen, vorgetragen. Es waren überwiegend konservativ orientierte Protestwähler, welche der NPD ihre Wahlerfolge ermöglichten.
2.4. Schlußwort und persönliche Wertung
Die Ideologie der NPD ist in ihrer Gesamtheit schwer einzuordnen. Sie bestand im wesentlichen aus einer Anzahl von Aussagen zu kontroversen Themen der Zeit und dem Wiederaufgreifen von rechtsextremen Ideen der Weimarer und NS-Zeit. Kulturpessimismus, Rassismus, Nationalismus und Antikommunismus sollten als integrative Faktoren wirken und einer breiten Bevölkerungsschicht eine Identifikation mit der NPD ermöglichen. Doch nicht nur viele Angriffspunkte bei diesen Themen, sondern auch die Vorstellungen von einem völkischen Kollektivismus und Führerstaat legen die Frage nahe, ob die Partei noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Es läßt sich jedoch abschließend sagen, daß die starken Reaktionen der Öffentlichkeit Teil eines demokratischen Prozesses und damit durchaus gerechtfertigt waren. Die NPD hatte mit ihren großen Erfolgen Ende der 60er Jahre in der deutschen Öffentlichkeit eine Rückbesinnung auf die Grundwerte einer freiheitlichen Demokratie entfacht. Gerade die zahllosen Versuche politischer und pädagogischer Auseinandersetzung, nicht nur durch Parteien und Verbände, sondern auch durch private Initiativen, zeigte, daß die Gesellschaft Abwehrkräfte besitzt, um solchen Gefahren zu begegnen. Dies scheint mir in letzter Zeit jedoch zu verblassen anhand neuer Zahlen. So schwenkt jeder vierte Jugendliche in Richtung einer der NPD ähnlichen Ideologie. Meiner Meinung nach muß der Staat hart durchgreifen, so daß diese und andere Organisationen nicht noch rechtlich begünstigt für ihre Meinung in der Öffentlichkeit eintreten dürfen. Heute hat die Partei sowieso weiter an Bedeutungslosigkeit verloren. So entstanden neue Parteien, wie die Jungen Nationaldemokraten, ein wie ich finde sehr treffender Name. Nur durch diese Leute kann die Demokratie gerettet werden (Sarkasmus). Wer erinnert sich nicht noch an die letzten Wahlen. Über die Werbespots der NPD konnte man doch nur lachen. Vor deutschen Fahnen standen Leute in einer Art verkrampfter Haltung, welche die Menschen zu überzeugen versuchten, daß Deutschland in seinen alten Grenzen wieder hergestellt werden muß. Die einzige Gefahr besteht nur darin, daß eine wieder Minderheit eine Mehrheit unter seine Kontrolle bringt.
3. Der Bau der Berliner Mauer
Dieser Teil der Hausarbeit beschäftigt sich genauer mit dem Zeitraum von 1958 bis 1961 mit dem Schwerpunkt dem Bau der Berliner Mauer. Auf eine Vorgeschichte und eine weitere Entwicklung nach 1961 möchte ich dabei verzichten, da dies bereits in der Chronologie aufgearbeitet wurde.
3.1. Einleitung
Der DDR-Führung war es trotz umfangreicher Propagierung der Einheit Deutschlands, der Ausnutzung von Ost-Berlin als Symbol für die Einheit Deutschlands und der Unterstützung oppositioneller Kräfte in der BRD nicht gelungen, den westdeutschen Staat zu destabilisieren. Im Westen glaubte die überwiegende Mehrheit, die Einheit Deutschlands könne in absehbarer Zeit nur durch die Einverleibung der DDR realisiert werden. Die Westberliner sahen sich mehr denn je als "Vorposten der Freiheit" und "Schaufenster des Westens" In der DDR gab man die Bemühungen, die Bundesrepublik über eine Konföderation für den Sozialismus zu gewinnen, mehr und mehr auf. Als 1956 Unruhen in Polen und Ungarn die Instabilität des sozialistischen Lagers deutlich machten, wandte man sich einer Absicherung der inneren Stabilität zu. Um die hohen Flüchtlingszahlen einzudämmen, verabschiedete die Volkskammer am 11.12.1957 ein Gesetz, in dem die Republikflucht unter Strafe gestellt wurde. Der Reiseverkehr zwischen den deutschen Staaten wurde weiter erschwert, Bundesbürger brauchten fortan eine Aufenthaltserlaubnis, um in die DDR reisen zu können.
3.2. Das sowjetische Ultimatum vom November 1958
Schon am 11.8.1958 hatte die Sowjetunion in einem Schreiben an die USA gegen die Einbeziehung von West-Berlin in völkerrechtliche Verträge der BRD protestiert. Dies verstoße sowohl gegen den rechtlichen Status von Berlin (West), als auch gegen die Tatsache, daß Ost-Berlin die Hauptstadt der DDR sei. Nachdem alle Versuche, ohne Absperrmaßnahmen die Flüchtlingsströme einzudämmen, gescheitert waren, konkretisierten sich auf sowjetischer Seite die Überlegungen, Berlin (West) als destabilisierenden Faktor zu neutralisieren. Chruschtschow machte deshalb in seiner Note vom 27.11.1958 den Vorschlag, Berlin (West) zu einer "Freien Stadt" zu erklären, entmilitarisiert und von der BRD unbeeinflußt. Mit diesem Schritt sollte der relativ offene Fluchtweg aus der DDR verschlossen werden. Um die Dringlichkeit einer Lösung der Berlinfrage zu betonen, drohte Chruschtschow, einen separaten Friedensvertrag mit der DDR zu schließen, wenn sich die Westmächte nicht binnen sechs Monaten zu ernsthaften Verhandlungen bereit erklärten. In diesem Falle fiele die Kontrolle über die Zufahrtswege von und nach Berlin unter die Zuständigkeit der DDR.
3.3. Vom Ultimatum zur Mauer
In einer weiteren Note vom Januar 1959 schlug die Sowjetunion vor, innerhalb der nächsten zwei Monate eine Friedenskonferenz einzuberufen, in der ein Friedensvertrag mit den beiden deutschen Staaten ausgearbeitet und unterzeichnet werden sollte. Obwohl die Westmächte die sowjetischen Noten in einer gemeinsamen Erklärung zurückwiesen, zeigten sie sich doch zu weiteren Verhandlungen bereit. Auf der Außenministerkonferenz in Genf, die mit Unterbrechungen vom Mai bis August tagte, nahmen außer den vier Mächten erstmals auch Vertreter beider deutscher Staaten teil. Obwohl beide Seiten von ihren Maximalforderungen bezüglich Deutschland und Berlin abrückten, scheiterten die Verhandlungen an der Aufrechterhaltung der vom Westen eingenommenen Rechtsposition für West-Berlin und deren sowjetischen Ablehnung. In der Mitte des Jahres 1960 spitzten sich die wirtschaftlichen und politischen Probleme in der DDR zu. Formell knüpfte das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zwar an die sozialistischen, solidarischen Ideen der Arbeiterbewegung an, doch die politische Diktatur, Rechtsunsicherheit und fehlende Freiheiten verzerrten diese Ideen. Bürokratische Ineffizienz, aber auch Reparationen und Mißwirtschaft behinderten das Wirtschaftswachstum beträchtlich. Die Fixierung der DDR-Bürger auf die Bundesrepublik mit ihrer freiheitlich parlamentarischen Demokratie und ihrem "Wirtschaftswunder" sorgte für eine rasch ansteigende Zahl der Flüchtlinge. Den Handwerkern, die im Frühjahr den staatlichen Kollektivierungsbemühungen entgehen wollten, folgten im Sommer überwiegend die Vertreter der Intelligenz. Das Politbüro der SED reagierte auf die Zuspitzung der Lage mit der Ausweitung der parteilichen Machtbefugnisse. Nach Beschlüssen des Politbüros und des Staatsrates im Juli 1960 wurde bindend bestimmt, daß die Staatsorgane die Beschlüsse der SED auszuführen hätten. Dies bedeutete, daß die SED nunmehr ihr Machtmonopol total durchgesetzte und sich alle Autorität staatlicher Macht völlig unterordnete. Ulbricht ging es dabei nicht um die zeitweilige Maßnahme eines Krisenmanagements, sondern darum, die Krise zu nutzen, um den Machtanspruch des Politbüros langfristig in solch absoluter Art im politischen System der DDR zu verankern wie es in den fünfziger Jahren wegen des Widerstandes der Blockparteien nicht möglich gewesen war. Folgerichtig vervielfachte sich der Parteiapparat der SED in kurzer Zeit, um seiner Weisungsbefugnis gegenüber den staatlichen Organen nachkommen zu können. Daß die politische Motivation Ulbrichts in der zweiten Berlinkrise allein auf Machterhalt ausgelegt war, zeigte sich auch in der Abschaffung des Präsidentenamtes der DDR zugunsten eines Staatsrates, dessen Vorsitzender er im September 1960 wurde. Da Ulbricht außerdem Erster Sekretär der ZK der SED war und sich im Februar 1960 zum Vorsitzenden des Verteidigungsrates hatte wählen lassen, war ihm die Okkupation entscheidender Machtpositionen gelungen. Es erfolgte eine bis dahin nicht gekannte Unterordnung, Konzentration und Gleichschaltung aller politischen Führungsinstanzen und -kräfte des Landes unter dem Ersten Sekretär des ZK der SED. Diese Position galt es in der Krise, mit allen Mitteln zu verteidigen. Die Lösung der Berlinfrage wurde für die DDR immer dringlicher. Von 1955 bis 1960 waren schon 1.340.878 Bewohner der DDR in den Westen geflüchtet, wovon alleine 667.667 das Notaufnahmeverfahren in West-Berlin beantragt hatten. Die DDR-Führung förderte durch ihre harte Politik die Fluchtbewegung. Gegen angebliche "Menschenhändler" wurden immer schwerere Strafen ausgesprochen. Die Regierung wandte sich nervös gegen die angeblichen "verbrecherischen Abwerbungsaktionen" des Westens, waren doch 50 Prozent der Flüchtlinge unter 25 Jahren. Bis zum Ende des Jahres wurde Berlin zum Schauplatz eines deutsch-deutschen "Kleinkrieges". Die DDR versuchte mit Drohungen gegen Bundestagssitzungen in West- Berlin, der Sperrung des Zugangs nach Ost-Berlin für fünf Tage anläßlich der Tagung der Landsmannschaften in Berlin und der Einführung des Passierscheinzwanges für Bundesdeutsche beim Besuch des Ostsektors herauszubekommen, wie weit sie die Empfindlichkeit der Westmächte gegen Restriktionen innerhalb Berlins herausfordern konnte. In der Bundesrepublik reagierte man mit Empörung und rang sich nach einiger Zeit zu einem schwerwiegenden Entschluß durch. Am 30. September 1960 kündigte die Bundesregierung das Interzonen-Handelsabkommen mit der DDR und stellte damit über zehn Prozent der Gesamtimporte der DDR in Frage. Obwohl die Kündigung gegen Jahresende zurückgenommen werden mußte, da sie indirekt die Versorgung Berlins gefährdete, war die wirtschaftliche und politische Wirkung immens. Die Sanktionen hatten die DDR schwer getroffen und ihr die eigene Abhängigkeit von der BRD vor Augen geführt. Die "Widerrufsklausel", welche dem Vertrag bei seiner Wiederinkraftsetzung eingefügt wurde, führte dem sozialistischen Staat seine Abhängigkeit klar vor Augen. Der neugewählte amerikanische Präsident Kennedy sah sich einer sich anbahnenden Auseinandersetzung gegenüber, die mit allen Mitteln psychologischer, diplomatischer und wirtschaftlicher Kriegführung geführt wurde. Im Laufe der Vorbereitungen zum amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffen in Wien, das am 3. und 4.6.1961 stattfinden sollten, wiederholte Chruschtschow seine Drohungen gegen den Status von West-Berlin, um die Vereinigten Staaten in der Frage der Eindämmung der Flüchtlingsströme zum Handeln zu bewegen. Das Treffen endete jedoch ergebnislos und mit der sowjetischen Drohung eines separaten Friedensvertrages mit der DDR, der in den Augen Chruschtschows ein Erlöschen der westlichen Besatzungsrechte in Berlin zur Folge gehabt hätte. Kennedy machte im Gegenzug deutlich, daß die USA die Verweigerung westlicher Rechte in Berlin als kriegerischen Akt ansehen würden und keinesfalls bereit seien, auf drei essentielle Punkte zu verzichten: Das Recht auf Anwesenheit in Berlin, die Zugangsrechte zur Stadt und die Lebensfähigkeit von Berlin (West) wurden unter der Bezeichnung "three essentials" zur obersten Maxime der amerikanischen Politik in Berlin. In den folgenden Monaten erfolgte auf beiden Seiten ein Wechselspiel von militärischen Maßnahmen, Absichtserklärungen und verbalen Drohungen, um die Gegenseite von der Unhaltbarkeit ihrer Verhandlungspositionen zu überzeugen. Auf Seiten der DDR- Führung ergriff Walter Ulbricht am 15.6.1961 auf einer Pressekonferenz die Initiative. So forderte er die Schließung einer Flüchtlingslager. Aufgrund der wirtschaftlichen Probleme und der hohen Flüchtlingszahlen mußte Ulbricht in kurzer Zeit eine Lösung finden. Doch ist nicht auszuschließen, daß er zu diesem Zeitpunkt noch an einen Verhandlungserfolg der Sowjetunion mit ihren Friedensvertragsplänen glaubte. Selbst wenn für ihn erweiterte Grenzkontrollen unumgehbar schienen, konnte er den Entschluß einer vollständigen Abriegelung der Grenzen nicht im Alleingang fällen. Vom 3.-5.8.1961 trafen sich die Ersten Sekretäre der Zentralkomitees der kommunistischen und Arbeiterparteien der Mitgliedsländer des Warschauer Paktes in Moskau. Auf der Konferenz, auf der speziell die Deutsche Frage und das Berlin-Problem behandelt wurden, erhielt Ulbricht die politische Zustimmung der UdSSR für seine Absperrpläne Ost-Berlins. In der Nacht vom 12. auf den 13.8.1961 errichteten Volkspolizei und NVA entlang der quer durch Berlin verlaufenden Sektorengrenze Stacheldrahtverhaue und Steinwälle, die in der folgenden Zeit zu einer durchgehenden Mauer ausgebaut wurden. Gleichzeitig wurden Polizei- und Armee-Einheiten in Ost-Berlin eingesetzt, um Demonstrationen zu verhindern. Die Sowjetunion hatte der Regierung der DDR die Verfügung über den Ostsektor Berlins in allen wesentlichen Teilen übergeben und es gestattet, daß Truppen der DDR in Ost-Berlin einrückten und daß DDR-Behörden einseitig die innerstädtischen Verkehrsverbindungen blockierten. Fortan war Berlin als Fluchttor für DDR-Bürger versperrt, die DDR abgeriegelt.
3.4. Die Situation nach dem Mauerbau
Die Errichtung der Absperrmaßnahmen kam für Bundesregierung, Berliner Senat und Westalliierte überraschend. Obwohl Bundeskanzler Adenauer am Abend des 13. August im Fernsehen zu Ruhe und Besonnenheit aufrief, blieb die Situation unübersichtlich. Die Westalliierten zeigten demonstrative Gelassenheit und fanden sich nicht bereit, mehr als eine Beobachtung der Aktivitäten an der Grenze einzuleiten. Diese viel kritisierte Zurückhaltung der Westmächte, aber auch der Bundesregierung nach der Abriegelung der Grenze, resultierte daraus, daß man mit noch sehr viel weitergehende Maßnahmen rechnete. Gefürchtet wurde nicht nur ein Aufstand in der Ostzone mit unkalkulierbaren Auswirkungen, sondern auch ein unmittelbares Vorgehen der DDR gegen die Verbindungswege nach West-Berlin. Bis dahin hatte die DDR nur zu Mitteln gegriffen, welche die Rechte der Westmächte in Berlin nicht verletzten. Auf westalliierter Seite ging man davon aus, daß ein zu brüskes Vorgehen gegen die Absperrmaßnahmen der Sowjetunion nur einen willkommenen Anlaß für Blockademaßnahmen oder für die Einnahme Berlins gegeben hätte. Noch 1948 war die atomare Unverwundbarkeit der USA eine entscheidende Trumpfkarte gewesen, doch die Aufrüstung beider Seiten mit Interkontinentalrakten hatte ein atomares Patt der Supermächte ergeben. Die Stimmung der Bürger in Berlin brach indessen vollends zusammen. Empörung, Enttäuschung über die Untätigkeit des Westens und die Furcht vor einer ungewissen Zukunft führten zu großen Proteskundgebungen. Schließlich sandte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, einen Brief an Präsident Kennedy, dessen Inhalt und Diktion deutliche Schritte unausweichlich machten. Aber erst als diese auch für den auf Hochtouren laufenden Bundestagswahlkampf bedeutsame negative Entwicklung schon offenbar war, ergriff man in Bonn und Washington psychologische Gegenmaßnahmen. Der Deutsche Bundestag wurde zu einer Sondersitzung einberufen, um eine Erklärung des Bundeskanzlers entgegenzunehmen, in der er die DDR scharf verurteilte. Präsident Kennedy ordnete eine demonstrative Verstärkung der amerikanischen Truppen in Berlin an, so daß eine neue Zuversicht unter der Bevölkerung entstand. Die Reaktionen in der DDR waren wider Erwarten außerordentlich vielfältig. Manche DDR-Bürger hofften auf das Versprechen der SED-Propaganda, daß es sich um vorläufige Maßnahmen bis zum Abschluß des Friedensvertrages handele, die Regierung jedoch fühlte sich erleichtert, weil nun die DDR nicht weiter ausbluten konnte. Sie ging davon aus, daß bei hohen Wachstumsraten die BRD in einigen Jahren doch noch in der Arbeitsproduktivität überholt werden könnte. Dies wurde natürlich nicht geschafft. Doch die Errichtung der Mauer bedeutete noch nicht das Ende der zweiten Berlinkrise, da Chruschtschow weiterhin versuchte, seine Ziele durchzusetzen. Ab 23.8.1961 spitzte sich die Auseinandersetzung zwischen Ost und West weiter zu. Die Sowjetunion bestritt in einer Note an die Westmächte das Recht der Alliierten auf freie Benutzung der Luftkorridore nach West- Berlin. Auf beiden Seiten erfolgte die Verstärkung der Streitkräfte in Europa. Doch erst nachdem der sowjetische Versuch der Stationierung von Mittelstreckenraketen in Kuba gescheitert war, lenkte Chruschtschow ein und erklärte, daß die Sowjetunion nicht weiter auf dem 31.12.1961 als Termin für die Unterzeichnung des Friedensvertrages bestünden. Das Ende der Kuba-Krise am 28. Oktober bedeutete daher zugleich das Ende der Berlin-Krise. Die konzeptionelle Perpetie bestand darin, daß die Existenz West-Berlins einerseits und die Existenz der Mauer andererseits stillschweigend als vorerst unveränderbare Bestandteile des Status quo anerkannt wurden. In der Phase nach der Kuba-Krise ging es nun darum, den Berlin-Konflikt auch vertraglich "einzukapseln" und die beiden deutschen Staaten mit ihren spezifischen Sonderkonflikten in den internationalen Prozeß einzubeziehen.
3.5. Die Bedeutung des Mauerbaus für die DDR
Mit der Errichtung des "Antifaschistischen Schutzwalles" war in den Augen der DDR der "Krisenbrandherd Berlin" unter zuverlässige Kontrolle gebracht worden. In offiziellen Darstellungen wurde dabei immer die volle Unterstützung der Bevölkerung für die Errichtung der Absperrmaßnahmen betont: bringen und die DDR ungestraft auszuplündern." Die Bundesrepublik war auf sich selbst zurückgeworfen worden und die DDR konnte sich konsolidieren, denn erst die Mauer gab Ulbricht die volle Gewalt über die Bürger seines Staates. Damit bestand für die DDR-Führung die gleiche Ausgangsposition wie für andere kommunistische Regierungen: Die Menschen, die nicht mehr einfach abwandern konnten, weil ihnen jede Form demokratischen Mitwirkens in der DDR verwehrt wurde, mußten sich mit dem Regime arrangieren. Es gab nun keine Alternative mehr zur Anpassung an den sozialistischen Staat und seine Gesellschaft. Das Bewußtsein, auf unabsehbare Zeit eingesperrt zu sein, machte viele Menschen in der DDR "mauerkrank".
Abgrenzungskampagnen konnten weder verwandtschaftliche Beziehungen zertrennen noch das Gefühl für nationale Zusammengehörigkeit beseitigen. Wirkte der Mauerbau 1961 noch auf eine Konsolidierung der DDR und den Machterhalt der SED hin, so wirkte sich die Mauer letztendlich traumatisch für die DDR aus. Nach dem Ende dieser zweiten Berlin-Krise hatte sich auf östlicher Seite auch der Eindruck durchgesetzt, daß die Westbindung der Stadt zumindest kurzfristig nicht lösbar war. Das Nahziel der Berlin-Politik der DDR wurde fortan, den Hauptstadtanspruch der Ostteils der Stadt durchzusetzen und gleichzeitig die Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik Deutschland in Frage zu stellen. Aus diesem Grunde folgten ab 1963 immer deutlichere Proteste gegen die Präsenz des Bundes in Berlin.
3.6. Die Bedeutung des Mauerbaus für die BRD und West-Berlin
Der Mauerbau war für die westdeutsche Politik ein tiefer Einschnitt. Konrad Adenauers deutschlandpolitische Konzeption hatte den größten Schlag erhalten. Die "Politik der Stärke", die Vorstellung, das System der DDR sei durch Druck von außen zu verändern, schien gescheitert. Aufgrund seines harten politischen Kurses gegenüber den realistischeren Ansätzen Kennedys, geriet der Bundeskanzler immer mehr ins Kreuzfeuer der Politik. Der junge amerikanische Präsident hatte erkannt, daß dem Westen keine kurzfristige Möglichkeit blieb, den Bau der Mauer rückgängig zu machen und plädierte für die Erhaltung des "status quo" auf der Grundlage seiner nach wie vor bestehenden "three essentials" um einen "modus vivendi" zu finden. Dies beinhaltete aber auch die Annahme der Mauer als Faktum, um politischen Spielraum für die Zukunft zu gewinnen. Das Scheitern Adenauers Politik der Härte gegenüber der DDR spiegelte sich auch bei den Wahlen am 17. September 1961 wieder, als die CDU ihre absolute Mehrheit verlor, und der Adenauer Chruschtschow der Wahlkampfhilfe für Willy Brand bezichtigte. Doch die Existenz der Mauer gab auch Ansatzpunkte zu einer Neuorientierung der Ost-Politik. So glaubte man, daß durch bessere Beziehungen zum Osten die Mauer vielleicht fallen könnte. Diese Politik wurde dann von Brandt realisiert, führte aber nicht zu ihrem gewünschten Ergebnis. Trotz der Abkehr des offenen Konfrontationskurses gegenüber dem anderen deutschen Staat, wurde Berlin und die Mauer jedoch zum zentralen Integrationselement für die Gesellschaft der BRD. Die Mauer machte das gemeinsame "Feindbild" aller Westdeutschen möglich, bot eine einfache, leicht zu verstehende politische Positionsbestimmung für jeden an. Westlich der Mauer existierte die BRD mit ihrer freiheitlich demokratischen Grundordnung, östlich davon, getrennt von einem unmenschlichen Bauwerk, errichtet von einem undemokratischen System, lag die DDR und hielt ihre eigenen Bürger gefangen. Diese hier recht simplifizierte Darstellung wurde bis zum Ende der DDR mehrfach abgewandelt und relativiert, behielt jedoch aufgrund ihrer zutreffenden Kernaussage immer Aktualität.
3.7. Schlußwort
Dieser Teil der Hausarbeit beleuchtete ein tragisches Kapitel näher. Die Stadt Berlin spielte in der deutschen Geschichte eine sehr große Rolle. Mit dem Mauerbau natürlich keine sehr gute. Jedoch wurde in dieser Stadt, die mit dem Leid vieler Menschen verbunden ist, auch ein neues Kapitel deutscher Geschichte geschrieben. Wollen wir hoffen, daß Deutschland nicht wieder durch einen Krieg getrennt wird, der von deutschen Boden ausgeht.
4. Literaturverzeichnis
4.1. Chronologie
- Bertelsmann Lexikon Geschichte auf CD-ROM, Bertelsmann Electronic Publishing,
München, 1996
- Deutschland, Ploetz, Freiburg, 1986
4.2. Problem 1
- Norbert Frei, Vergangenheitspolitik, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1996
- Hans-Gerd Jaschke, Die Republikaner, J.H.W. Dietz, Bonn, 1993
- Hannelore Janssen, Hilflos gegen Rechtsextremismus?, bund Verlag, Köln, 1995
- Falter, Wer wählt rechts?, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1994
- Fascher, Eckhard: Modernisierter Rechtsextremismus ? Ein Vergleich der Parteigründungsprozesse der NPD und der Republikaner in den sechziger und achziger Jahren, Berlin, 1994
- Kevenhörster, Paul: Zur Ideolgie der NPD. Eine Auswertung des "Politischen Lexikons", in: Gebauer, Bernhard: Analysen und Dokumente zur Auseinandersetzung mit der NPD, Eichholz,
- Schmidt, Giselher: Ideologie und Propaganda der NPD
- Schmollinger, Horst : Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, in: Stöss, Richard (Hrsg.): Parteien Handbuch der Bundesrepublik Deutschland 1945-1980, Opladen, 1984
4.3. Problem 2
- Hildebrandt, Reinhard: Kampf um Weltmacht. Berlin als Brennpunkt des Ost- WestKonfliktes, Opladen 1987
- Müller Helmut: Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bonn 1994
- Schwarz, Hans-Peter (Hrsg.): Berlinkrise und Mauerbau, Bonn 1985
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Chronologie der deutschen Geschichte von 1945 bis 1990?
Diese Chronologie bietet eine detaillierte zeitliche Übersicht der Ereignisse in Deutschland von 1945 bis 1990, unterteilt in die westlichen und östlichen Besatzungszonen bzw. die spätere BRD und DDR. Sie beinhaltet wichtige politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse.
Was behandelt der Abschnitt über die Ideologie des Rechtsextremismus in den 60ern am Beispiel der NPD?
Dieser Abschnitt analysiert die Entstehung, den Aufstieg und Fall der NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) in den 1960er Jahren. Er untersucht die Ideologie der Partei, ihre Wählerstruktur und stellt die Frage, ob ihr Aufstieg eine Folge der damaligen Wirtschaftskrise war. Es wird auch eine persönliche Wertung abgegeben.
Was ist der Fokus des Abschnitts über den Bau der Berliner Mauer?
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Ereignisse von 1958 bis 1961, die zum Bau der Berliner Mauer führten. Er behandelt das sowjetische Ultimatum von 1958, die Situation vor und nach dem Mauerbau und die Bedeutung des Mauerbaus für die DDR, die BRD und West-Berlin.
Welche Art von Literatur wird im Literaturverzeichnis aufgeführt?
Das Literaturverzeichnis listet verschiedene Bücher, Lexika und andere Publikationen auf, die für die Erstellung der Chronologie, die Analyse der NPD und des Rechtsextremismus sowie die Untersuchung des Mauerbaus verwendet wurden. Die Literatur ist nach Themenbereichen sortiert (Chronologie, Problem 1, Problem 2).
Was befindet sich im Anhang?
Der Anhang enthält Bilder und Tabellen, die die Chronologien ergänzen, einschließlich Tabellen mit allen Bundespräsidenten und Kanzlern der BRD sowie Staatsoberhäuptern der DDR.
Welche Themen werden in der Chronologie der westlichen Besatzungszonen und der späteren BRD behandelt?
Die Chronologie der westlichen Besatzungszonen und der BRD behandelt Ereignisse wie die Kapitulation der Wehrmacht, die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen, die Potsdamer Konferenz, die Gründung von Parteien (SPD, CSU, CDU, FDP), die Währungsreform, die Gründung der BRD, den Beitritt zur NATO, die Einführung der Wehrpflicht, den Bau der Berliner Mauer, die Spiegelaffäre und die Wiedervereinigung.
Welche Themen werden in der Chronologie der östlichen Besatzungszone und der späteren DDR behandelt?
Die Chronologie der östlichen Besatzungszone und der DDR behandelt Ereignisse wie die Errichtung der SMAD, die Gründung der KPD, SPD, CDU und LDPD, die Vereinigung von SPD und KPD zur SED, die Gründung der DDR, den Aufstand vom 17. Juni, den Bau der Berliner Mauer, die Ablösung Ulbrichts durch Honecker, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur NATO und die Wiedervereinigung.
Welche Aspekte der NPD-Ideologie werden diskutiert?
Die Analyse der NPD-Ideologie konzentriert sich auf nationale Gedanken, Fremdenfeindlichkeit, Agrarromantik, Antiliberalismus, Antipluralismus, Aggressivität gegenüber der demokratischen Gesellschaftsordnung, Rassenlehre und antisemitische Dogmen. Es wird auch die Rolle der Parteizeitung "Deutsche Nachrichten" und des "Politischen Lexikons" bei der Verbreitung der Ideologie beleuchtet.
Welche Auswirkungen hatte der Mauerbau auf die DDR?
Der Mauerbau stabilisierte kurzfristig die DDR, indem er die Fluchtbewegung eindämmte und es dem Regime ermöglichte, die Bevölkerung besser zu kontrollieren. Langfristig führte er jedoch zu einer "Mauerkrankheit" und trug letztendlich zum Zusammenbruch der DDR bei.
Welche Auswirkungen hatte der Mauerbau auf die BRD und West-Berlin?
Der Mauerbau war ein tiefer Einschnitt für die westdeutsche Politik und markierte das Scheitern von Adenauers "Politik der Stärke". Gleichzeitig wurde die Mauer zu einem zentralen Integrationselement für die Gesellschaft der BRD und bot eine klare Abgrenzung zu dem undemokratischen System in der DDR.
- Quote paper
- Anonym (Author), 1998, Ideologie des Nationalsozialismus in 60ern am Beispiel der NPD; Bau der Berliner Mauer / Chronologie der deutschen Geschichte von 1945-1990, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95145