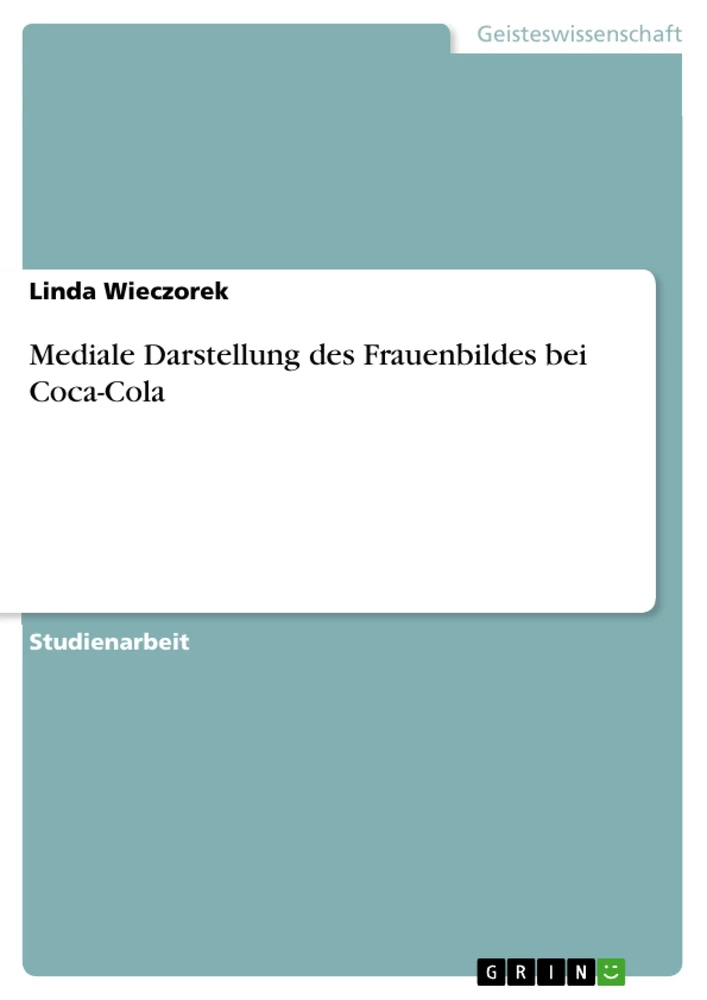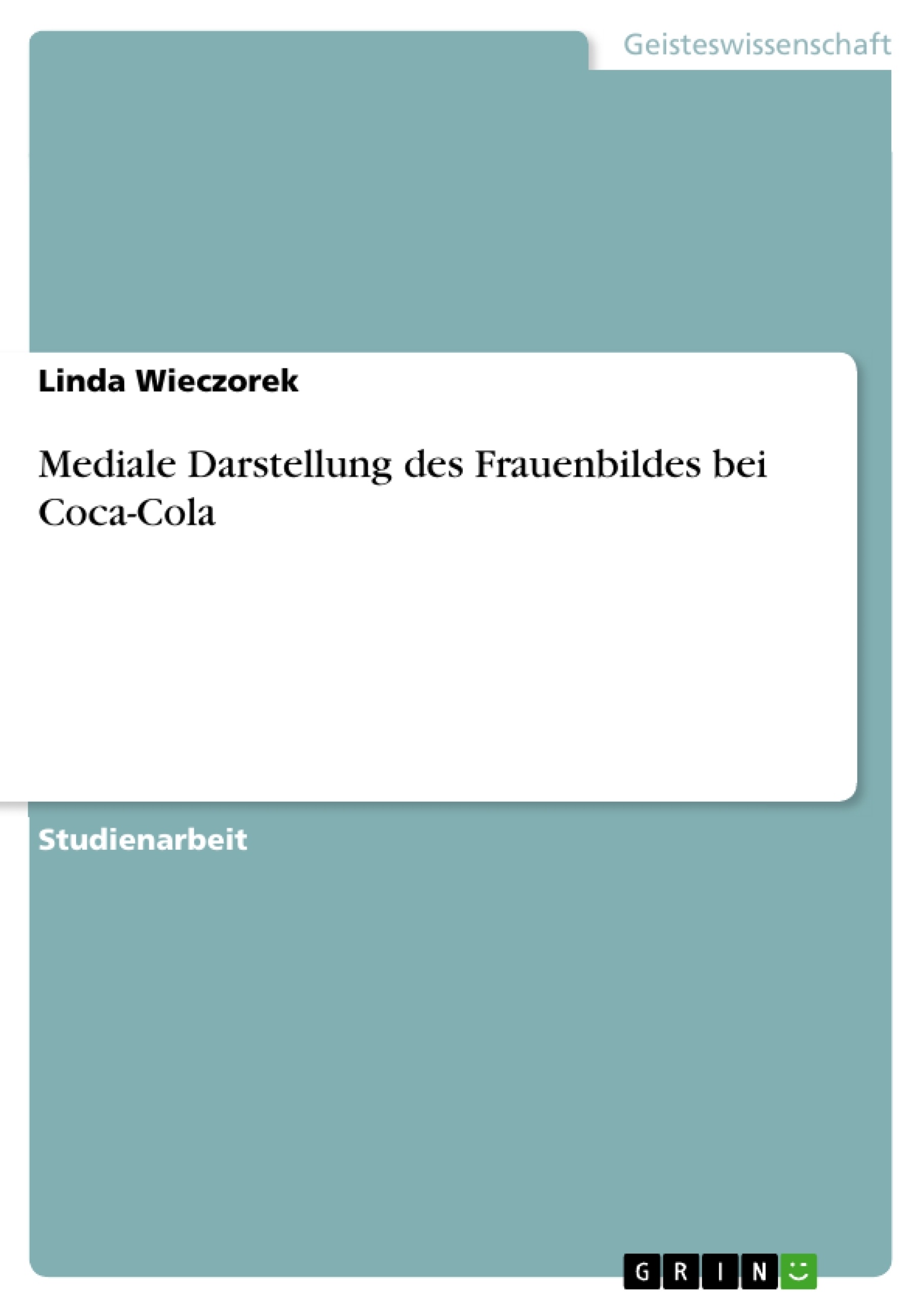Die vorliegende Ausarbeitung basiert auf dem Seminar „Orte der Vielfalt: Erscheinungsformen gesellschaftlicher Vielfalt“ und thematisiert die Fragestellung: Inwiefern unterscheidet sich das medial inszenierte Frauenbild im Coca-Cola-Werbefilm „It’s Happy Hour at Coke“ (2017) von der Selbstwahrnehmung der Frau im 21. Jahrhundert?
Nach einer Einführung in die Thematik gilt es zunächst, die theoretischen Grundlagen der Werbung und des Frauenbilds zu erläutern. Hierbei werden die Begriffe definiert und anschließend in den theoretischen Kontext eingeordnet. Das dritte Kapitel widmet sich dem Forschungsdesign und dem methodischen Vorgehen. Die Filmanalyse fokussiert vor allem die formalen Gestaltungselemente wie die Kameraeinstellung, die Perspektive sowie auditive Stilmittel wie Musik, Geräusche und Sprache. Im Vordergrund der Analyse steht jedoch der Bild- und Handlungsinhalt. Im Rahmen der qualitativen Forschung gilt es den Werbespot „It’s Happy Hour at Coke“ (2017) anhand dieser Elemente zu beschreiben und anschließend mit den inhaltlichen Aspekten zu verknüpfen. Die Interpretationsergebnisse des Werbefilms und die Gegenüberstellung der Theorie verdeutlichen die Diskrepanz und eine mediale Stereotypisierung des weiblichen Geschlechts, welche es im nächsten Schritt kritisch zu betrachten gilt. Der Verlauf des Forschungsprozesses und die Resultate werden im letzten Kapitel zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Theoretischer Zugang
- 2.1. Werbung - Der Werbefilm.
- 2.2. Das Frauenbild im 21. Jahrhundert....
- 3. Forschungsdesign und Methode
- 4. Analyse: „It's Happy Hour at Coke” (2017)....
- 5. Auswertung.
- 6. Fazit....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit befasst sich mit der medialen Darstellung des Frauenbilds im Coca-Cola-Werbefilm „It's Happy Hour at Coke“ (2017) und untersucht, inwiefern sich diese von der Selbstwahrnehmung der Frau im 21. Jahrhundert unterscheidet.
- Analyse des medial inszenierten Frauenbilds im Werbespot
- Theoretische Einordnung von Werbung und Frauenbild im 21. Jahrhundert
- Bedeutung von Gleichberechtigung und Subjektivierung von Weiblichkeit
- Untersuchung von Diskrepanzen zwischen medialer Darstellung und Selbstwahrnehmung
- Kritik an medialer Stereotypisierung des weiblichen Geschlechts
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Diese Einleitung stellt die Coca-Cola Company vor, ihre Marketingstrategie und ihr Engagement in den Bereichen Diversität, Integration und Frauen. Die Forschungsfrage wird eingeführt: Inwiefern unterscheidet sich das medial inszenierte Frauenbild im Coca-Cola-Werbefilm „It's Happy Hour at Coke“ (2017) von der Selbstwahrnehmung der Frau im 21. Jahrhundert? Die Arbeit stellt die Struktur des Forschungsprozesses vor. - Kapitel 2: Theoretischer Zugang
Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Begriffe Werbung und Frauenbild und ordnet sie in den theoretischen Kontext ein. Es wird auf die Rolle der Frau im 21. Jahrhundert hinsichtlich der körperlichen und affektiven Dimensionen eingegangen, wobei die Subjektivierung von Weiblichkeit und die Forderung nach Gleichberechtigung besondere Beachtung finden. - Kapitel 3: Forschungsdesign und Methode
Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign und die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es beleuchtet die qualitative Forschungsmethode und die Fokussierung auf die Analyse des Werbespots „It's Happy Hour at Coke“ (2017) hinsichtlich formaler Gestaltungselemente wie Kameraeinstellung, Perspektive, Musik, Geräusche und Sprache. Die Interpretation des Werbespots im Kontext der Theorie wird als Grundlage für die Analyse der Diskrepanz zwischen medialer Darstellung und Selbstwahrnehmung genutzt.
Schlüsselwörter
Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die mediale Darstellung des Frauenbilds, Werbefilme, Coca-Cola, Selbstwahrnehmung, Gleichberechtigung, Subjektivierung von Weiblichkeit, mediale Stereotypisierung, qualitative Forschung, Filmanalyse, formalen Gestaltungselemente.
- Quote paper
- Linda Wieczorek (Author), 2020, Mediale Darstellung des Frauenbildes bei Coca-Cola, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951146