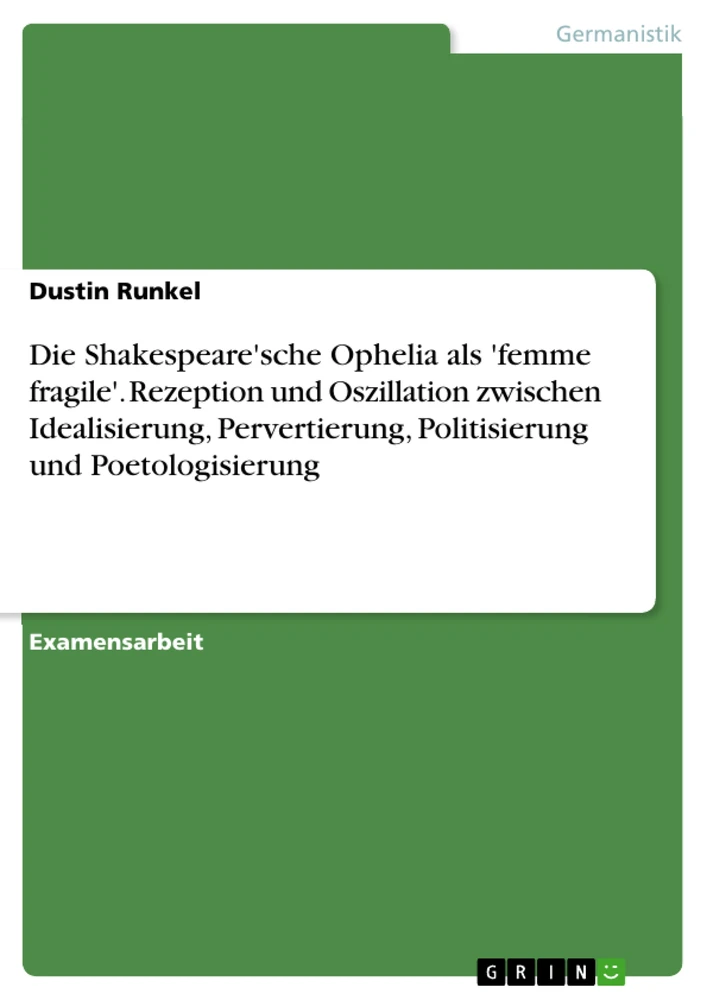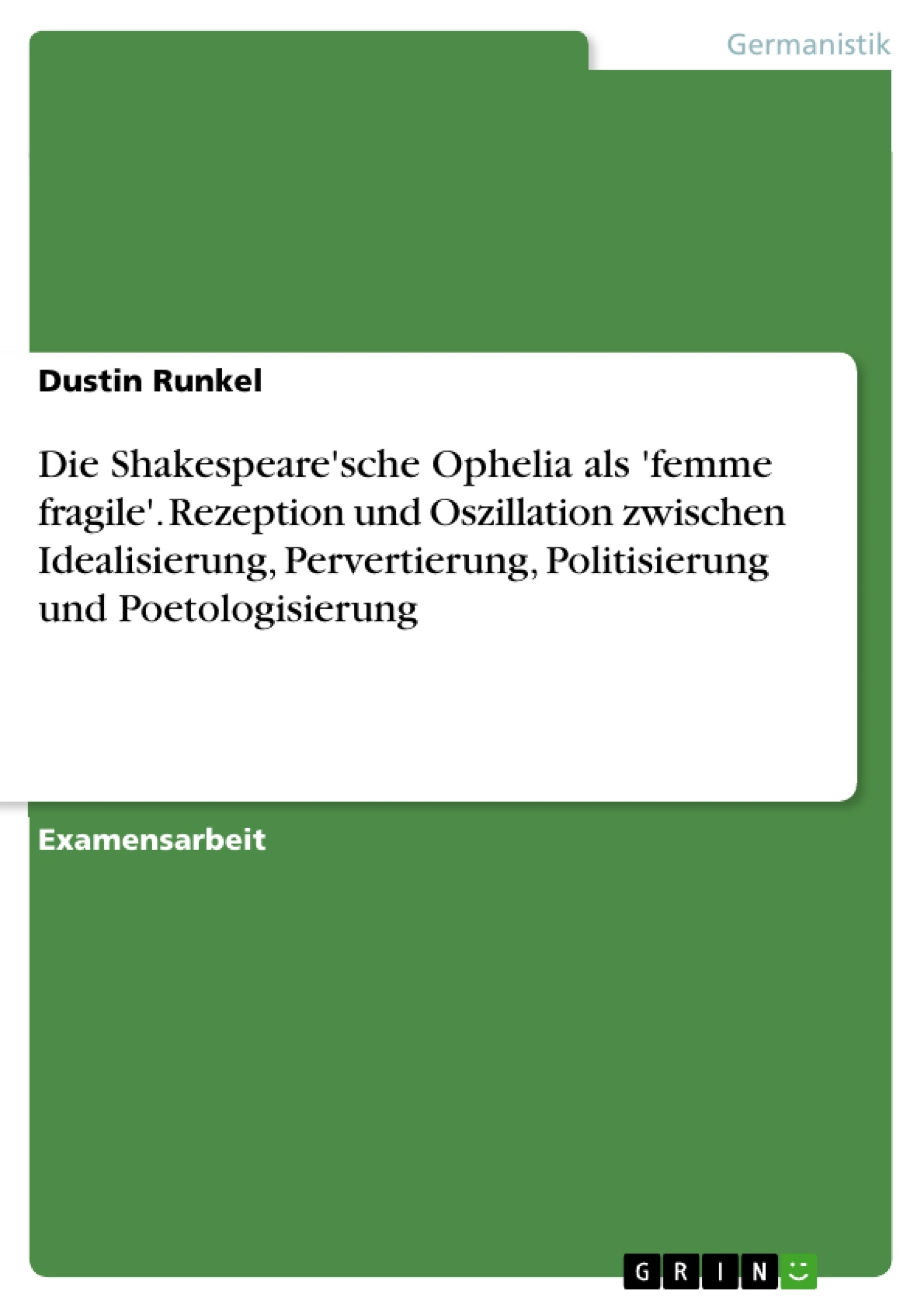Die Intention dieser Arbeit besteht darin, die Rezeptionsgeschichte von Shakespeares Leidensgestalt Ophelia und ihres Wassertodes anhand von ausgewählten Kunstwerken vom achtzehnten bis zum zwanzigsten Jahrhundert nachzuvollziehen. Hierbei sollen Parallelen, Divergenzen, Akzentverschiebungen und bisweilen gar intertextuelle Bezugnahmen eruiert werden.
Aus diesem Anlass wird als Basis zunächst die Ophelia-Figur in ihren wesentlichen Grundzügen betrachtet, bevor sich dem Shakespeare-Enthusiasten Goethe zugewandt wird, der mit der Deuteragonistin seines Lebenswerks "Faust I" den Auftakt dieser Untersuchung von Ophelia-Fortschreibungen bildet. Im Anschluss wird mit Millais‘ "Ophelia" ein Seitenblick auf die bildmalerische Rezeption der 'femme fragile' geworfen und mit der Behandlung von Rimbauds "Ophélie" der Kulminationspunkt der Ophelia-Idealisierung erreicht.
Aus der Feder dieses Autors wird zum einen der Mythos der ewig (schönen) lebenden Wasserleiche geboren, zum anderen ist es dieses Werk, das den Folgegenerationen starke Impulse bietet und so den Ophelia-Kult in der Moderne einleitet. Ebendiesem wird im Rahmen der Hausarbeit größere Aufmerksamkeit gewidmet, da die expressionistische Wasserleichenpoesie eine Zäsur in der Bearbeitung des Ophelia-Motivs darstellt.
Neben Heyms "Ophelia I" und Benns "Schöne Jugend" werden deshalb auch die Variationen von Brecht in den Blick gefasst, welche an den expressionistischen Motivzirkel anknüpfen, aber differente Themenschwerpunkte setzen. Im Folgenden wird dann mit Huchels "Ophelia" die zunehmende Politisierung von Shakespeares Figur zum Millennium hin untersucht, bevor die Arbeit letztlich mit der Interpretation von Caves Mörderballade "Where the Wild Roses Grow" beschlossen wird.
Damit wird einerseits die Rezeption Ophelias in der (Pop-)Musik berührt, andererseits ein Beleg für die gegenwärtige Omnipräsenz und Renaissance ebenjenes literarischen Mythos geliefert. Schließlich hat die Kontrafaktur "Ophelia und kein Ende" mindestens genauso Gültigkeit wie der semantische (Prä-)Komplex, an den sie sich anlehnt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Rest ist Schweigen? – Der Mythos Ophelia
- 2. Lieben ist menschlich, nur müsst ihr menschlich lieben – Das (Liebes-)Leid der fragil-vulnerablen Ophelia
- 3. Es irrt der Mensch so lang er strebt – Goethes Gretchen als Pendant zur Opferfigur Ophelia?
- 4. Millais' Ästhetisierung von Tod und Sexualität in Ophelia – Die Geburtsstunde des Mythos der ewig schönen Leiche
- 5. Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab… – Die Rimbaud'sche Potenzierung Ophelias zur lebenden Toten
- 6. Der Expressionismus – Die Kunst, Wahrheit zu verbreiten
- 6.1 Der literaturgeschichtliche Hintergrund
- 6.2 Ophelia als hässlich-schöne Wasserleiche? – Heyms Ästhetisierung des Hässlichen in Ophelia I
- 6.3 Die Krone der Schöpfung, die Ratte, der Mensch? Benns Schöne Jugend – Das Schädlingsrequiem eines Mediziniks …
- 6.4 Ich sprech zu Gott: Mein Fels, warum hast du mein vergessen? – Göttliche Ab- statt Zuwendung in Brechts anti-christlicher Lyrik
- 7. Ophelia im Dienste dissidenter Lyrik – Die (Wasser-)Leiche im Schatten der Mauer
- 8. Elisa, thy name is woman! Schönheit als Mordmotiv in Where the Wild Roses Grow
- 9. Ophelia - Requiescat in pace? Resümee und Nachbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Rezeptionsgeschichte der Ophelia-Figur aus Shakespeares Hamlet vom 18. bis zum 20. Jahrhundert zu untersuchen. Dabei werden ausgewählte Kunstwerke analysiert, um Parallelen, Unterschiede und Akzentverschiebungen in der Darstellung Ophelias aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Ophelia-Mythos und seine Transformationen in verschiedenen künstlerischen Kontexten.
- Die Entwicklung des Ophelia-Mythos von Shakespeare bis zur Moderne
- Die Oszillation zwischen Idealisierung, Politisierung und Pervertierung der Ophelia-Figur
- Die Rolle der Ästhetik in der Darstellung von Ophelias Tod und Leid
- Die Interpretation Ophelias in verschiedenen Kunstformen (Literatur, Malerei, Musik)
- Die Bedeutung von intertextuellen Bezügen und der Einfluss verschiedener literaturgeschichtlicher Strömungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Rest ist Schweigen? – Der Mythos Ophelia: Die Einleitung stellt die immense und andauernde Rezeption der Ophelia-Figur aus Shakespeares Hamlet vor. Sie betont die Bedeutung Ophelias als Muse für Literatur, Musik und bildende Kunst, über die Grenzen Englands hinaus. Die Arbeit skizziert ihren Weg in die Populärkultur und kündigt die Analyse der Rezeptionsgeschichte anhand ausgewählter Werke an, von Goethe bis zu zeitgenössischen Interpretationen. Der Fokus liegt auf der Erforschung von Parallelen, Divergenzen und intertextuellen Bezügen.
2. Lieben ist menschlich, nur müsst ihr menschlich lieben – Das (Liebes-)Leid der fragil-vulnerablen Ophelia: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die folgenden Analysen, indem es die Figur Ophelias in Shakespeares Hamlet eingehend untersucht. Es betrachtet ihre Rolle im Stück und analysiert ihre Verletzlichkeit, ihr Leiden und ihre Beziehung zu Hamlet. Das Kapitel legt den Schwerpunkt auf die Ursachen ihres Leidens und ihrer tragischen Entwicklung im Stück, was als Grundlage für die späteren Rezeptionen dient. Die verschiedenen Facetten von Ophelias Charakter und ihre Beziehung zum Umfeld werden hier detailliert untersucht.
Häufig gestellte Fragen zu: Der Rest ist Schweigen? – Der Mythos Ophelia
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte der Ophelia-Figur aus Shakespeares Hamlet vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Sie analysiert ausgewählte Kunstwerke, um Parallelen, Unterschiede und Akzentverschiebungen in der Darstellung Ophelias aufzuzeigen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung des Ophelia-Mythos und seinen Transformationen in verschiedenen künstlerischen Kontexten, der Oszillation zwischen Idealisierung, Politisierung und Pervertierung der Figur, der Rolle der Ästhetik in der Darstellung von Ophelias Tod und Leid, und der Interpretation Ophelias in verschiedenen Kunstformen (Literatur, Malerei, Musik).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus neun Kapiteln. Kapitel 1 stellt die umfassende Rezeption der Ophelia-Figur vor und skizziert den Ansatz der Arbeit. Kapitel 2 analysiert Ophelias Rolle und Leiden in Shakespeares Hamlet. Die Kapitel 3 bis 8 behandeln verschiedene künstlerische Interpretationen Ophelias von Goethe bis zu zeitgenössischen Werken (z.B. Millais, Rimbaud, Expressionisten wie Heym, Benn, Brecht) und dem Lied "Where the Wild Roses Grow". Kapitel 9 fasst die Ergebnisse zusammen und bietet eine Nachbetrachtung.
Welche Künstler und Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Darstellung Ophelias in Werken von Goethe, Millais, Rimbaud, sowie Expressionisten wie Georg Heym, Gottfried Benn und Bertolt Brecht. Zusätzlich wird das Lied "Where the Wild Roses Grow" untersucht. Der Fokus liegt auf der vergleichenden Analyse verschiedener Interpretationen und der Herausarbeitung intertextueller Bezüge.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung des Ophelia-Mythos von Shakespeare bis zur Moderne nachzuvollziehen und die vielfältigen künstlerischen Interpretationen dieser Figur zu analysieren. Es geht um die Untersuchung von Parallelen, Divergenzen und der Bedeutung intertextueller Bezüge sowie des Einflusses verschiedener literaturgeschichtlicher Strömungen.
Welche Zielgruppe spricht die Arbeit an?
Die Arbeit richtet sich an Leser*innen, die sich für die Rezeptionsgeschichte literarischer Figuren, die Analyse von Kunstwerken und die Erforschung intertextueller Beziehungen interessieren. Sie ist insbesondere für Studierende der Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und vergleichbarer Fächer relevant.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von einer Darstellung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte. Danach werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst. Der Hauptteil besteht aus der detaillierten Analyse der ausgewählten Werke.
- Quote paper
- Dustin Runkel (Author), 2017, Die Shakespeare'sche Ophelia als 'femme fragile'. Rezeption und Oszillation zwischen Idealisierung, Pervertierung, Politisierung und Poetologisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950984