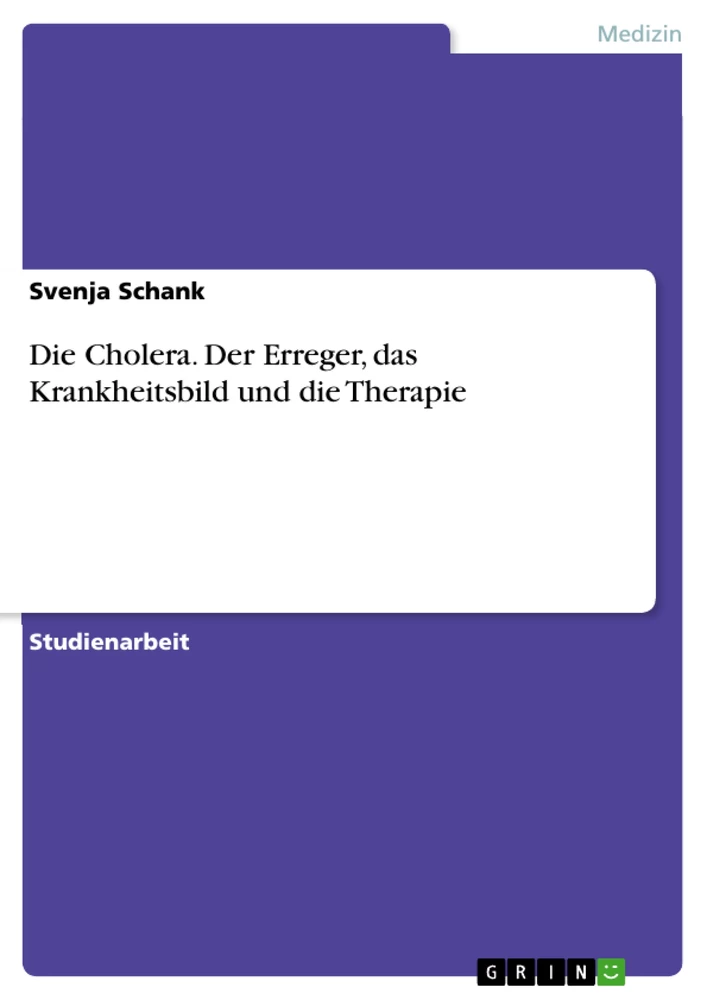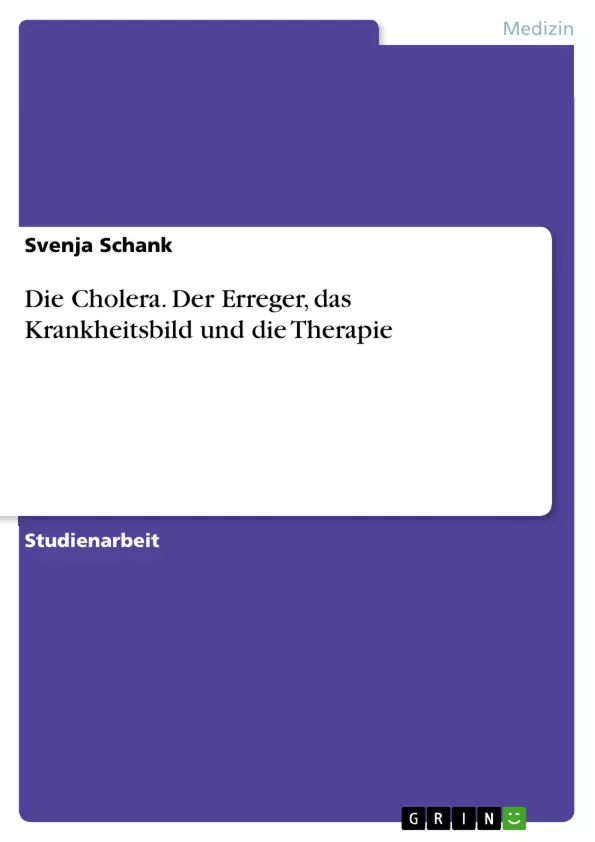Kürzlich las ich in der Biographie von Bertha Pappenheim (1859-1936) folgendes :
"1873, Bertha war inzwischen 14 Jahre alt, wurde Wien Schauplatz einer Weltausstellung. Alle Hoffnungen des handelstüchtigen Wiens richteten sich auf das Großereignis. Man hatte investiert, gebaut und renoviert, um die internationale Kundschaft für sich zu gewinnen. [...] Im Rahmen einer großangelegten Erweiterung der Stadt war das Gelände innerhalb der früheren Festungswälle ausgebaut worden. [...]
Der Kaiser persönlich eröffnete die Weltausstellung mit allen Pomp. Besonderer Stolz der Wiener war die Rotunde am Prater, das damals größte Haus der Welt. Doch insgesamt erfüllte die Ausstellung die Hoffnungen der Geschäftswelt nicht. Der erwartete lebhafte Fremdenverkehr blieb aus, weil Fälle von Cholera gemeldet wurden und ein größeres Publikum fernhielten. Prompt beschwerte sich die Wiener Presse, dass die wenigen Krankheitsfälle von missgünstigen Journalisten aus Prag und Berlin zu einer grassierenden Seuche aufgebauscht worden wären. Die Weltausstellung endete schließlich in einem finanziellen Desaster. Ein riesiger Börsenkrach war die Folge."
Daraufhin bekam ich Interesse daran, mich näher darüber zu informieren, was es mit dieser gefürchteten Krankheit auf sich hat und welche weiteren sozialen Folgen die Epidemien hatten bzw. heute noch haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- klinisch-pathologische Aspekte
- Der Erreger
- Das Krankheitsbild
- Prophylaxe
- Therapie
- geschichtlicher Rückblick
- große Pandemien des 19. und 20. Jahrhunderts
- zeitliche und geographische Abläufe
- Forschungen zur Ätiologie
- Robert Kochs Beitrag zur Cholerabekämpfung
- Beispiel für den Verlauf einer Choleraepidemie
- Hamburg 1892
- soziale Lage der Bewohner
- große Pandemien des 19. und 20. Jahrhunderts
- Einflüsse hygienischer und sozialer Faktoren
- Cholera heute
- Zusammenfassung und Prognose
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Cholera, einer gefährlichen Infektionskrankheit. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Krankheit zu vermitteln, von ihren klinisch-pathologischen Aspekten bis hin zu ihrem historischen Verlauf und ihrer aktuellen Bedeutung. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Krankheit auf die betroffene Bevölkerung und den gesellschaftlichen Kontext.
- Klinisch-pathologische Aspekte der Cholera (Erreger, Krankheitsbild, Prophylaxe)
- Historischer Rückblick auf Cholera-Pandemien und Robert Kochs Beitrag
- Einfluss hygienischer und sozialer Faktoren auf das Auftreten von Cholera
- Die Cholera im 21. Jahrhundert
- Zusammenfassende Betrachtung der Krankheit und Prognose
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit wird durch eine Anekdote über die Wiener Weltausstellung 1873 eingeleitet, bei der Cholera-Fälle den erwarteten Touristenboom verhinderten und ein finanzielles Desaster verursachten. Diese Einleitung verdeutlicht die weitreichenden sozialen und ökonomischen Folgen von Cholera-Epidemien und begründet das Interesse der Autorin an dem Thema.
klinisch-pathologische Aspekte: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die klinischen und pathologischen Aspekte der Cholera. Es erläutert den Erreger Vibrio cholerae und seine verschiedenen Biovare (El Tor, Proteus, Albensis). Das Krankheitsbild wird umfassend dargestellt, beginnend mit der oralen Aufnahme des Bakteriums über die Besiedlung des Dünndarms bis hin zu den charakteristischen Symptomen wie Erbrechen, Durchfall ("Reiswasserstuhl") und Dehydration. Die schweren Folgen der Dehydration, einschließlich Azidose, Nierenversagen und Kreislaufkollaps, werden ebenso beschrieben wie die hohe Letalität unbehandelter Fälle. Abschließend werden präventive Maßnahmen wie die Isolierung von Infektionsquellen und Impfung, sowie die aktuellen Empfehlungen der WHO diskutiert.
geschichtlicher Rückblick: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Cholera, insbesondere die großen Pandemien des 19. und 20. Jahrhunderts. Es wird auf die zeitlichen und geographischen Abläufe eingegangen und die damaligen Forschungsbemühungen zur Ätiologie der Krankheit beschrieben. Ein besonderer Fokus liegt auf Robert Kochs Beitrag zur Cholerabekämpfung. Als Beispiel für den Verlauf einer Choleraepidemie wird die Situation in Hamburg 1892 detailliert analysiert, inklusive der sozialen Bedingungen der betroffenen Bevölkerung.
Einflüsse hygienischer und sozialer Faktoren: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss hygienischer und sozialer Faktoren auf das Auftreten von Cholera-Epidemien. (Anmerkung: Da der Text hier keine weiteren Informationen enthält, kann keine detaillierte Zusammenfassung erstellt werden.)
Cholera heute: Dieses Kapitel befasst sich mit der aktuellen Situation der Cholera. (Anmerkung: Da der Text hier keine weiteren Informationen enthält, kann keine detaillierte Zusammenfassung erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Cholera, Vibrio cholerae, Pandemien, Infektionskrankheit, Hygiene, soziale Faktoren, Prophylaxe, Therapie, Robert Koch, Epidemiologie, Dehydration, Letalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Cholera-Arbeit
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Arbeit über Cholera?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Cholera. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Die Arbeit behandelt klinisch-pathologische Aspekte (Erreger, Krankheitsbild, Prophylaxe und Therapie), einen geschichtlichen Rückblick mit Fokus auf große Pandemien und Robert Kochs Beitrag, den Einfluss hygienischer und sozialer Faktoren, die aktuelle Situation der Cholera und eine abschließende Zusammenfassung und Prognose.
Welche klinisch-pathologischen Aspekte der Cholera werden behandelt?
Dieser Abschnitt beschreibt detailliert den Erreger Vibrio cholerae und seine verschiedenen Biovare. Das Krankheitsbild wird von der oralen Aufnahme des Bakteriums über die Besiedlung des Dünndarms bis hin zu den charakteristischen Symptomen (Erbrechen, Durchfall, Dehydration) und deren schweren Folgen (Azidose, Nierenversagen, Kreislaufkollaps) dargestellt. Präventive Maßnahmen wie Isolation und Impfung sowie aktuelle WHO-Empfehlungen werden ebenfalls diskutiert.
Welchen historischen Rückblick bietet die Arbeit?
Der historische Rückblick konzentriert sich auf die großen Cholera-Pandemien des 19. und 20. Jahrhunderts, ihre zeitlichen und geographischen Abläufe und die damaligen Forschungsbemühungen. Besonderes Augenmerk liegt auf Robert Kochs Beitrag zur Cholerabekämpfung. Die Cholera-Epidemie in Hamburg 1892 dient als detailliertes Beispiel, inklusive der sozialen Lage der betroffenen Bevölkerung.
Welche Rolle spielen hygienische und soziale Faktoren?
Die Arbeit untersucht den Einfluss hygienischer und sozialer Faktoren auf das Auftreten von Cholera-Epidemien. Leider enthält der zur Verfügung gestellte Text an dieser Stelle keine weiteren Informationen, sodass keine detailliertere Zusammenfassung möglich ist.
Wie beschreibt die Arbeit die aktuelle Situation der Cholera?
Der Abschnitt über die Cholera im 21. Jahrhundert enthält im vorliegenden Text ebenfalls keine weiteren Informationen, sodass keine detaillierte Zusammenfassung gegeben werden kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Cholera, Vibrio cholerae, Pandemien, Infektionskrankheit, Hygiene, soziale Faktoren, Prophylaxe, Therapie, Robert Koch, Epidemiologie, Dehydration, Letalität.
Wie beginnt die Einleitung der Arbeit?
Die Einleitung beginnt mit einer Anekdote über die Wiener Weltausstellung 1873, bei der Cholera-Fälle einen erwarteten Touristenboom verhinderten und ein finanzielles Desaster verursachten. Dies verdeutlicht die weitreichenden sozialen und ökonomischen Folgen von Cholera-Epidemien.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Cholera zu vermitteln – von den klinisch-pathologischen Aspekten bis hin zu ihrem historischen Verlauf und ihrer aktuellen Bedeutung. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Krankheit auf die betroffene Bevölkerung und den gesellschaftlichen Kontext.
- Citation du texte
- Svenja Schank (Auteur), 2002, Die Cholera. Der Erreger, das Krankheitsbild und die Therapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9507