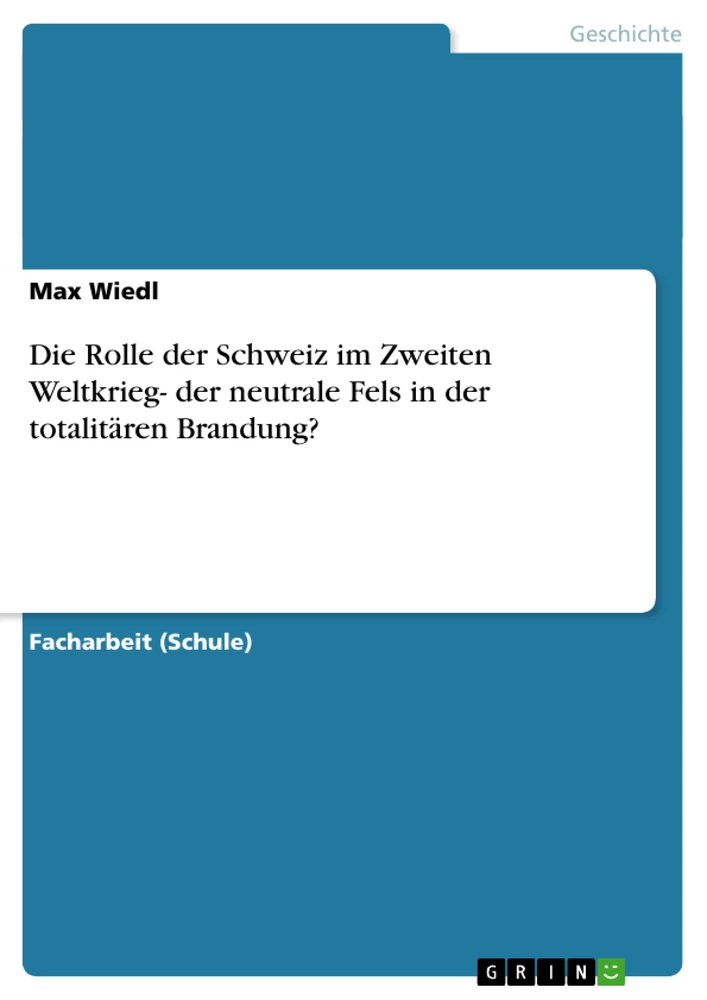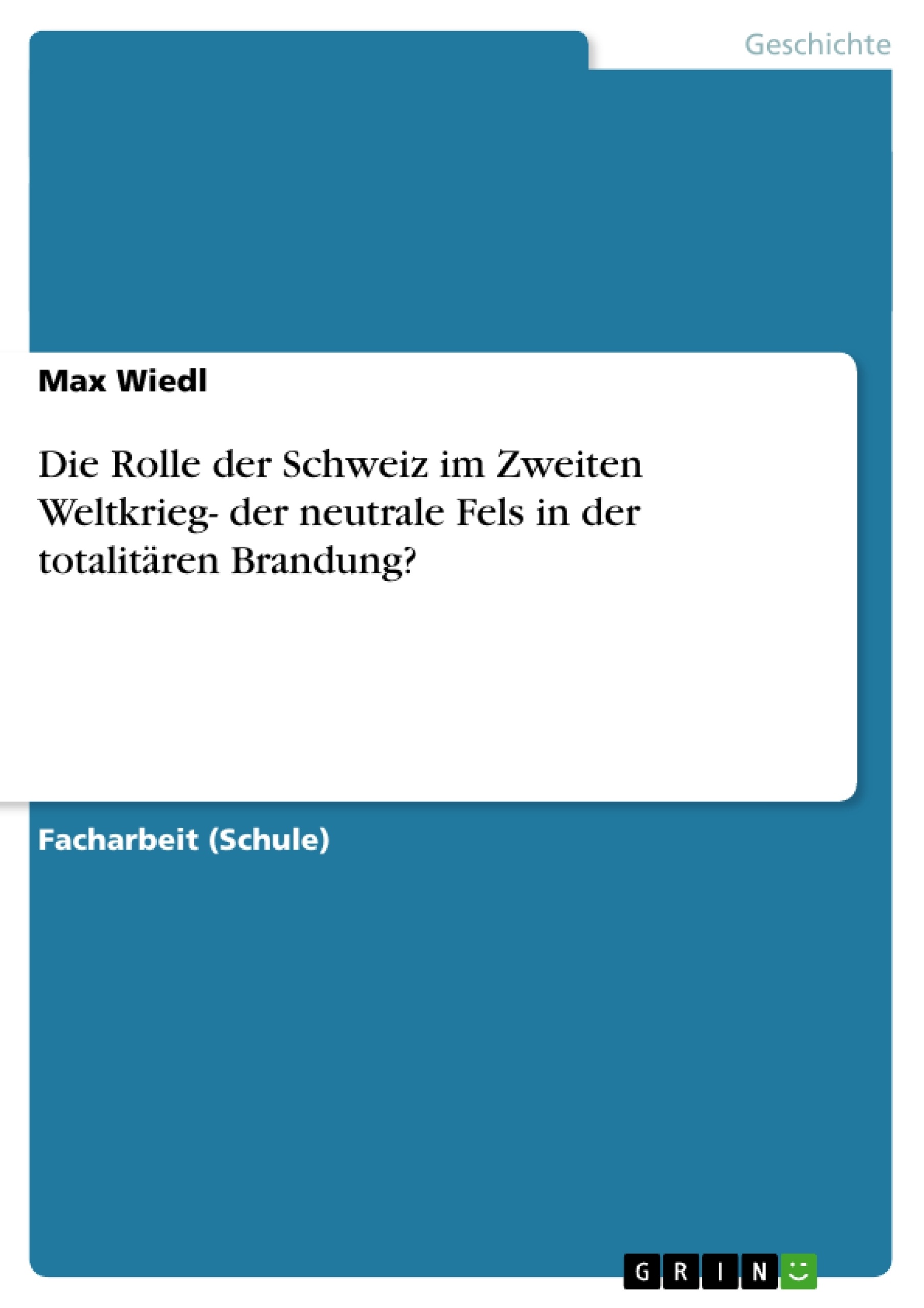Wie neutral war die Schweiz wirklich im Zweiten Weltkrieg? Tauchen Sie ein in eine erschütternde Analyse der Rolle der Schweiz während einer der dunkelsten Epochen der Menschheitsgeschichte. Dieses Buch enthüllt die komplexen Verflechtungen zwischen der Schweiz und dem nationalsozialistischen Deutschland, beleuchtet die heikle Balance zwischen Neutralität, Wirtschaft, und Humanität. Es untersucht die völkerrechtliche Stellung der Schweiz, die Haltung von Regierung und Bevölkerung gegenüber dem NS-Regime und die kontroverse Frage der Flüchtlingsaufnahme vor und während des Krieges. Detaillierte Recherchen enthüllen die Schattenseiten der schweizerischen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Dritten Reich, die Exporte von kriegswichtigem Material und die geheimen Goldtransaktionen der Deutschen Reichsbank mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB). War die Schweiz wirklich nur ein unbeteiligter Beobachter, oder spielte sie eine aktivere Rolle in der Finanzierung und Unterstützung der deutschen Kriegswirtschaft? Erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Neutralität der Schweiz für die Kriegsparteien, die diplomatischen Verstrickungen und die humanitären Aktivitäten des Roten Kreuzes. Die schwierige Entscheidung der Flüchtlingspolitik, die Rolle von Schlüsselpersonen wie Heinrich Rothmund und die tragischen Schicksale abgewiesener Flüchtlinge werden schonungslos aufgedeckt. Diese umfassende Analyse, basierend auf umfangreichen Recherchen und brisanten Dokumenten, wirft ein neues Licht auf das Verhalten der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs, und regt zur kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit an. Schlüsselwörter: Schweiz, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, Neutralität, Flüchtlinge, Goldtransaktionen, Reichsbank, SNB, Wirtschaftsbeziehungen, Rothmund, Holocaust, Raubgold, Kriegswirtschaft, Aussenpolitik, Geschichte, Deutschland, Archivforschung, Judenstempel, Antisemitismus, Krieg. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Geschichte, Politik und die moralischen Dilemmata des Krieges interessieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Der völkerrechtliche Status der Schweiz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
2.1. Von 1933 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
2.1.1. Die Haltung der Regierung und öffentliche Meinung
2.1.2. Die Frage der Aufnahme von Flüchtlinge
2.2. Von Beginn bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges
2.2.1. Die Haltung der Regierung und öffentliche Meinung
2.2.2. Die Frage der Aufnahme von Flüchtlinge
2.2.3. Die Wirtschaftsbeziehungen der schweizerischen Industrie mit dem Dritten Reich
2.2.3.1. Die Importe bzw. Exporte der eidgenössischen Industrie an das Dritte Reich
2.2.3.2. Die Goldtransaktionen der deutschen Reichsbank mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
2.2.4. Die Bedeutung des neutralen Staates ,,Schweiz" während des Krieges
3. Resümee: Das Verhalten der Schweiz gegenüber dem Nationalsozialismus
Anhang:
Verzeichnis der Literatur
- Berber, Dr. Friedrich: Lehrbuch des Völkerrechts. Zweiter Band Kriegsrecht (i. A.) C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 2.Auflage 1969
- Bower, Tom: Das Gold der Juden Karl Blessing Verlag 1997
- Fink, Jurge: Die Schweiz aus der Sicht des Dritten Reiches 1933-1945 Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1985
- Häsler, Alfred: Das Boot ist voll. Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933-1945 Pendo Verlag, Zürich 9. Auflage 1992
- Heiniger, Markus: 13 Gründe. Warum die Schweiz im 2. Weltkrieg nicht erobert wurde Limmat-Verlag, Zürich 2. Auflage 1989
- Inglin, Oswald: Der stille Krieg. Der Wirtschaftskrieg zwischen Großbritannien und der Schweiz während des 2. Weltkrieg Verlag Neue Züricher Zeitung, Zürich 1991
- Kreis, Georg: Juli 1940 Die Aktion Trump Helbing & Lichtenhahn, Basel/Stuttgart 2. Auflage 1973
- Meyer, Alice: Anpassung oder Widerstand: Die Schweiz zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus Verlag Huber & Co. AG, Frauenfeld 1965
- Picard, Jacques: Die Schweiz und die Juden 1933-1945. Schweizerischer Antisemitismus, jüdische Abwehr und internationale Migration - und Flüchtlingspolitik Chronos Verlag, Zürich 3. Auflage März 1997
- Piekalkiewicz, Janusz: Schweiz 1939-45. Krieg in einem neutralem Land F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München/Berlin 1997
- Rings, Werner: Schweiz im Krieg 1939-45 Chronos Verlag, Zürich 9. Erweiterte Auflage 1997
- Rings, Werner: Raubgold aus Deutschland. Die ,,Golddrehscheibe Schweiz im Zweiten Weltkrieg R. Piper GmbH & Co. KG, München 1996
- Trepp, Gian: Die Bank für Internationalem Zahlungsausgleich im Zweiten Weltkrieg: Bankgeschäfte mit dem Feind Rotpunktverlag, Zürich 3. Auflage 1997
- Ziegler, Jean: Die Schweiz, das Gold und die Toten Goldmann Verlag, München 1998
Links in das Internet (Angabe der betreffenden Homepage)
http://www.nzz.online.ch Das Dossier ,,Schatten des Zweiten Weltkrieges"
http://www.uek.ch Der Untersuchungsbericht der Unabhängigen Experten Kommission
http://www.parlament.ch Der Untersuchungsbericht der sog. Task Force
http://www.eda-tf.ethz.ch Die Internetseite des schweizerischen Außenministeriums, auf der die sog. Task Force ihre bisherigen Ergebnisse publiziert
1. Der völkerrechtliche Status der Schweiz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
Während des Zweiten Weltkrieges durch den die meisten Staaten in Europa verwüstet wurden und in Europa etwa 50 Millionen Tote beklagt werden mußten, blieben nur wenige Staaten von diesem Blutvergießen ausgespart. Diese wenigen Staaten - es waren Spanien, Portugal, Schweden, Türkei, und die Schweiz - blieben unter anderem nur wegen ihrer Neutralität von der Besetzung verschont. Von den fünf oben genannten Staaten, ich zähle auch die Türkei zu den neutralen Staaten, da sie erst gegen Ende des Krieges und nur auf Druck der Alliierten den Achsenmächten den Krieg erklärte, ist die Schweiz nicht nur aufgrund ihrer geographischen Lage im Herzen von Europa - eingekeilt zwischen Deutschland im Norden, Frankreich im Westen, Italien im Süden und Österreich im Osten - einer genaueren Betrachtung wert, sondern besonders wegen der durch das Ende des kalten Krieges erst jetzt ermöglichten Diskussion über das Verhalten der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Denn, wie oben schon erwähnt, galt damals wie noch heute die Schweiz als ein neutraler Staat. Dies bedeutet, daß die Schweiz im Falle eines Krieges nach den betreffenden Bestimmungen des Völkerrechts darauf drängen kann, daß die kriegsführenden Parteien die territoriale Integrität, also die Unverletzbarkeit des schweizerischen Gebietes anerkennen müssen. Ferner hat die Schweiz das Recht, sowohl mit der einen Seite - im Zweiten Weltkrieg den Alliierten - als auch mit der anderen Seite - den Achsenmächten - friedliche Beziehungen zu unterhalten und weiterhin Handel zu treiben, solange keine der beiden Parteien, also weder die Alliierten, noch die Achsenmächte, im Laufe des Handels benachteiligt oder bevorzugt wird. Überdies kann die Eidgenossenschaft Flüchtlinge und Deserteure bei sich aufnehmen, wobei sie keine Menschen aufnehmen muß; zumindest verstößt dies nicht gegen geltendes Recht, auch wenn sich gegenüber Flüchtlingen fast ein moralischer Zwang für die Aufnahme ergibt1.
2.1. Die Schweiz von 1933 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
Damit man nun das Verhalten der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges - worauf sich auch der Hauptteil dieser Arbeit bezieht - besser verstehen und beurteilen kann, ist es notwendig, die Betrachtungen nicht erst am 1. September 1939 mit dem Kriegsausbruch zu beginnen, sondern schon etwa sechs Jahre früher, genauer gesagt um den 30.1.1933 mit der Machtergreifung Hitlers. In diesem Zeitraum, von 1933 bis 1939, sind zwei Punkte zu erläutern: einmal die Haltung der schweizerischen Regierung zusammen mit der öffentlichen Meinung, und zum zweiten die - schon zu dem Zeitpunkt aktuell werdende - Problematik der Flüchtlinge vor allem aus dem Dritten Reich. Die Fragen hinsichtlich wirtschaftlicher Zusammenarbeit und der Goldtransaktionen stellen sich erst nach Ausbruch des Krieges, weshalb ich darauf auch erst im weiteren Verlauf meiner Arbeit zusammen mit der Politik, der öffentlichen Meinung und den die Flüchtlinge betreffenden Fragen eingehen werde. Im Anschluß daran kommt noch ein anderer, ebenso wichtiger Punkt zur Sprache: die Bedeutung der Schweiz als neutraler Staat mitten im Herzen von Europa für die Alliierten und Achsenmächte, von welchen die Schweiz die meiste Zeit des Krieges umgeben war.
2.1.1. Die Haltung der Regierung und die öffentliche Meinung vor Kriegsausbruch
Die neue Regierung unter dem Reichskanzler Hitler wurde als die neunte Regierung der Weimarer Republik seit dem Ende des Ersten Weltkrieges angesehen; auch die folgende Neuwahl des Reichstages wurde als normal beurteilt, da in der Regierung Hitler von elf Ministern acht aus konservativen Parteien stammten und ,,nur" drei aus dem rechten Lager. Aber dennoch hatte man in der Regierung teilweise Furcht vor dem großen Nachbarn im Norden infolge seiner militärischen Stärke, deren Aufbau unter Hitler seit seiner Machtergreifung forciert wurde und spätestens seit dem Anschluß Österreichs vor einem Einmarsch deutscher Truppen in die Schweiz. Diese Befürchtung sollte sich allerdings erst im Krieg voll bewahrheiten, als abzusehen war, daß Hitler sich in keiner Weise an die internationalen Verträge und Abmachungen hielt. So zum Beispiel die Entführung von deutschen Emigranten unter anderem auch aus der Schweiz, wie die Entführung von Berthold Jacobs am 9. März 1935: Jacobs wurde von einem Agenten der Gestapo aus der Schweiz nach Deutschland entführt, um durch Vernehmung bei der Gestapo die Quellen seiner Berichte über den Nationalsozialismus zu erfahren. Der schweizerische Außenminister Mottas persönlich intervenierte in Berlin - es lagen sichere Beweise dafür vor, daß Jacobs von der Gestapo nach Deutschland verschleppt worden war - und brachte Berlin soweit, daß der deutsche Außenminister bereit war, alle Bedingungen der Schweiz zu erfüllen. Doch bevor es dazu kommen konnte, gab Mottas wahrscheinlich aus Angst vor einer möglichen Revanche des Dritten Reiches für diese diplomatische Niederlage nach und war mit den von Berlin vorgeschlagenen Bedingungen - Jacobs solle gleich, nachdem er aus Deutschland zurück sei, nach Frankreich abgeschoben werden, die ganze Entführung sollte vertuscht werden - einverstanden. Jacobs wurde 1941 aus Portugal entführt und starb Februar 1944 in einem deutschen Gefängnis2. Das Verhalten der eidgenössischen Regierung gegenüber den Flüchtlingen werde ich unten ausführlich behandeln; einzig eine Angelegenheit soll hier noch erwähnt werden: nachdem zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz kein Visum notwendig war, um über die Grenze zu kommen, wurde die schweizerische Regierung beim deutschen Außenministerium vorstellig, was man machen könne, um die Ein- und Ausreise in die Schweiz und nach Deutschland kontrollieren zu können. Noch am 13. August 1938 lehnte die deutsche Regierung eine besondere Kennzeichnung von nichtarischen Pässen ab; jedoch bereits am 4. Oktober 1938 stimmte der eidgenössische Bundesrat - so wird in der Schweiz die Regierung bezeichnet - einem Abkommen mit Deutschland zu, demnach die Pässe von Juden mit einem ,,J" gekennzeichnet werden mußten. Hauptverantwortlicher für diese Maßnahme war der Chef des Polizeidepartement des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) Heinrich Rothmund, der die Verantwortung für den Judenstempel, welcher am 10. November 1938 bekannt gegeben wurde, ablehnte3. Von Heinrich Rothmund wird weiter unten, im Abschnitt über die Flüchtlingspolitik noch öfters die Rede sein. Nachdem nun die eidgenössische Regierung den Regierungswechsel in Berlin als einen ganz alltäglichen beurteilte - und damit wahrscheinlich die Meinung von jeder anderen Regierung in Europa wiedergab - wurde die Machtergreifung von Hitler in Deutschland von den Schweizern fast gänzlich ignoriert. Anders als in Deutschland, gab es in der Schweiz keine Zusammenarbeit von weiten Kreisen der Konservativen mit den sogenannten Frontisten, aus deren Lager sich die schweizerische Auslandsorganisation der NSDAP rekrutierte. Dies lag zu einem guten Teil an den verschiedenen Größenordnungen der Parteien. Als die NSDAP in Deutschland in der Wahl am 5. März 1933 zusammen mit der DNVP, DVP einen Anteil von etwas über 50% der Stimmen stellte, erhielten die Frontisten in der Schweiz bei den Wahlen im Durchschnitt etwa 1,5% und hatten maximal 9200 Mitglieder; die Kommunisten bewegten sich die ganze Zeit ebenfalls in diesen Größenordnungen4. Man kann daraus zwar ableiten, daß die Schweizer dem Nationalsozialismus eher ablehnend gegenüberstanden, jedoch dessen Antisemitismus insofern teilten, als es sich eher um einen geistigen Antisemitismus als um einen praktisch tätigen Antisemitismus handelte. Um dies zu verdeutlichen, sind zweierlei Sachen nötig: einmal die Anzahl und der Anteil der Ausländer und der Juden gemessen an der Einwohnerzahl der Schweiz von 1910, 1920 und 1930, um darüber orientiert zu sein, wie groß der Anteil und die Anzahl der Juden an den Einwanderern und den Schweizern war und - gleichsam als Gegensatz - zwei Dokumente, die weiter unten näher erläutert werden: 1910 gab es insgesamt 18.462 Juden, was einem Anteil von 0,49% der Gesamtbevölkerung entspricht; von diesen 18.462 Menschen waren 34,0%, also 6.275, von schweizerischer Herkunft, der Rest von 12.187 oder 66,0% waren Ausländer. In demselben Zeitraum kamen unter anderem 219.530 Deutsche, 202.809 Italiener und 63.695 Franzosen in die Schweiz. Von diesen insgesamt 552.011 Ausländern waren 12.187 oder 0,0221% (gerundet) Juden. 1920 waren in der Schweiz 20.979 Juden (0,54%), von denen 9.428 (44,9%) Schweizer und 11.551 (55,1%) Ausländer waren; Zu der selben Zeit kamen u.a. 149.833 Deutsche, 134.628 Italiener und 57.196 Franzosen in die Schweiz. Von diesen 402.385 Ausländer waren nur 0,0287% (11.551) Juden. 1930 gab es in der ganzen Schweiz 17.973 Juden, was einem Anteil von 0,44% entspricht. Davon waren 9.803 (54.5%) Schweizer und 8.170 (45.5%) Ausländer; zur selben Zeit kamen 355.522 Ausländer, 134.561 aus Deutschland, 127.093 aus Italien und 37.303 aus Frankreich, in die Schweiz. Daraus ergibt sich ein Anteil von 0,0230% (aufgerundet) für jüdische Ausländer, die in die Schweiz kamen5. Angesichts solcher Zahlen kann man nicht von einer besonderen Gefahr der Überfremdung der Schweiz durch Juden sprechen, vor allem schon deshalb, weil kein ernstzunehmender Mensch von einer Gefahr der Überfremdung durch bestimmte Völker oder ethnische Gruppen reden kann. Dieser Statistik stehen zwei Dokumente als Gegensatz gegenüber: zum einen der Brief des deutschen Gesandten in der Schweiz, Freiherr von Weizsäcker, geschrieben im April 1934; zum anderen das Ergebnis einer Leserumfrage des ,,Emmenthaler Blattes", demnach 10 von 12 Leserbriefen auf die Frage einer möglichen Judengefahr hin einen antisemitischen Inhalt haben6. Der deutsche Gesandte Freiherr von Weizsäcker kommt in seinem Lagebericht über die schweizerische Haltung zu dem ,,Judenproblem" zu folgendem Schluß: "Ernsthafte Schweizer gestehen im Zwiegespräch gern ein, daß ihnen am deutschen Vorgehen in der Judenfrage nur die Form mißfällt."7. Dies zu einer Zeit, in der es in der ganzen Schweiz 9.803 inländische und 8.170 ausländische Juden gab, was zusammen einem Anteil von 0,44% an der Gesamtbevölkerung (Schweizer und Ausländer) ergibt; der Anteil der schweizerischen Juden betrug zu dem Zeitpunkt gerade etwa 0,3% der Bevölkerung. Gleichwohl reagierte die Presse und Öffentlichkeit empört, als die zuständigen schweizerischen Behörden nach dem Anschluß von Österreich die Flüchtlinge zum Teil an der Grenze zurückwies, zum Teil aufspürte und nach Deutschland auslieferte. So schrieb zum Beispiel die ,,Zürichsee-Zeitung", daß ein ,,großzügiges Entgegenkommen gegenüber diesen Flüchtlingen"8 angebracht sei; ähnlich äußerte sich auch ,,Die Entscheidung", eine Zeitung von Jungkatholiken in Luzern.
2.1.2. Die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen vor Kriegsausbruch
Soweit zur Haltung der eidgenössischen Regierung und der öffentlichen Meinung; daß die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen aus z.B. dem Dritten Reich von der öffentlichen Meinung beeinflußt wurde, erscheint mir als weniger wahrscheinlich. Die dafür entscheidende Stelle war, wie schon erwähnt, der Chef der schweizerischen Polizei, Heinrich Rothmund. Bevor man sich weiter mit diesem Thema beschäftigt, sollte man die maßgebliche Person, also Heinrich Rothmund, mit einigen Sätzen genauer betrachten. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges bekleidete Heinrich Rothmund noch nicht seine Stellung als oberster Chef der eidgenössischen Polizei, sondern war (noch) einfacher Oberleutnant und Führer eines Zuges. Alfred Häsler beschreibt ihn in seinem Buch ,,Das Boot ist voll. Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933-1945" als einen mitleidslosen, manchmal harten, manchmal sanften Menschen; er sei ,,zornig und mild, despotisch und charmant, witzig und zynisch, launisch wie eine Primadonna und väterlich jovial."9. Nach Ende des Ersten Weltkrieges baute Rothmund die Fremdenpolizei auf, eine neue Abteilung der Polizei, deren Aufgabe ausschließlich die Überwachung und Überprüfung von Immigranten und anderer Ausländern war. Während eines Besuches in Deutschland schreibt er in seinem Bericht über die Verhandlungen, die er in Berlin zwischen dem 12. Oktober und 6. November 1942 führte, zu einem Besuch in dem KZ Oranienburg, folgendes: "Ich versuchte den Herren (Rothmund berichtet hier über ein Essen in dem Konzentrationslager Oranienburg) klarzumachen, daß Volk und Behörden in der Schweiz die Gefahr der Verjudung von jeher deutlich erkannt und sich stets so dagegen gewehrt haben, daß die Nachteile der jüdischen Bevölkerung durch die Vorteile wettgemacht wurden, während das in Deutschland nicht der Fall war. Der Gefahr kann nur dadurch begegnet werden, daß ein Volk sich von allem Anfang an gegen die jüdische Ausschließlichkeit wehrt und sie verunmöglicht. (...) Die jüdische Rasse ist geschichtlich erprobt, zäh und stark gegenüber Verfolgungen. Sie hat bisher allen Ausrottungsversuchen standgehalten und ist immer wieder gestärkt daraus hervorgegangen. Aus diesen Überlegungen scheine mir, so schloß ich meine Ausführungen, die heutige deutsche Methode falsch zu sein und gefährlich für uns alle, weil sie uns letzten Endes die Juden auf den Hals jage."10
Soweit der Bericht; nun muß man aber bedenken, daß dieser Mann infolge seines Postens als Chef der eidgenössischen Polizei die Macht hat über die Aufnahme von Flüchtlingen zu entscheiden oder die Grenze zu schließen. Vor dem Krieg bestand für Reisen zwischen der Schweiz und dem Dritten Reich keine Visumspflicht, d.h. man konnte relativ ungehindert von dem einen in das andere Land reisen, wenn man von den Grenzkontrollen einmal absah. Um nach dem Anschluß von Österreich einen unkontrollierten Zuzug von Flüchtlingen, vor allem aber von Juden, die größtenteils aus der Ostmark, dem Gebiet des ehemaligen Österreich stammten, kontrollieren und gegebenenfalls verhindern zu können, ohne gleich die ganze Grenze schließen zu müssen, wies Rothmund den schweizerischen Gesandten in Berlin am 13. August 1938 - der 13. August wird noch einmal etwas später eine Rolle spielen - über das Amt für Auswärtiges des Eidgenössischen Politischen Departements an, bei dem Auswärtigen Amt vorstellig zu werden und zu prüfen, mit welchen Mitteln die deutsche Regierung einverstanden sei, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Der Gesandte in Berlin, Minister Dr. Hans Fröhlicher, berichtete folgendes nach Berlin: ,,Bei meiner Vorsprache hob ich überdies hervor, daß unbedingt eine Regelung gefunden werden müsse, die es der Schweiz ermögliche, einreisende Emigranten zu kontrollieren und zu sieben. (...) Eine besondere Bezeichnung der Pässe von nichtarischen deutschen Staatsangehörigen scheint man hier nicht durchführen zu wollen, da damit den Staaten, die deren Einreise erschweren wollen, ein Mittel in die Hand gegeben würde."11. Als daraufhin Rothmund drohte, die schweizerische Regierung zu einer Kündigung von jenem Abkommen, das den sichtvermerkfreien Verkehr zwischen dem Dritten Reich und der Schweiz vom 9. Januar 1926 zum Inhalt hatte, zu bewegen - die fragliche Machtposition hatte er durch den Posten als Chef der eidgenössischen Polizei inne - gab die Regierung in Berlin nach und wurde bei dem schweizerischen Gesandten in Berlin vorstellig. Aus dessen Bericht vom 7. September 1938 über diese Besprechung geht eine Bereitschaft von Berlin hervor, ,,eine Kennzeichnung der an Juden ausgestellten Pässe vorzunehmen, die sich sowohl auf das Altreich als auch auf Österreich und endlich auf die im Ausland ausgestellten Pässe für Juden erstrecken würde. Gleichzeitig wäre die deutsche Regierung damit einverstanden, daß schweizerischerseits für die so gekennzeichneten Pässe der Sichtvermerkszwang eingeführt wird."12. Des weiteren weigert sich die schweizerische Regierung die Pässe der Juden aus der Schweiz aus ,,praktischen und verfassungsmäßigen Gründen" irgendwie zu kennzeichnen. Nach einigen weiteren Verhandlungen wurden die getroffenen Abmachungen am 3. Oktober auf Antrag des EJPD dem Bundesrat vorgeschlagen, der am 4. Oktober die Abmachungen einstimmig ratifizierte und veröffentlichte. Am 10. November 1938, einen Tag nach der sogenannten ,,Reichskristallnacht" in Deutschland wurden die getroffenen Abmachungen durch einen Wechsel von Noten zwischen der schweizerischen und deutschen Regierung bestätigt. In dieser Abmachung, mit der die Verhandlungen zwischen dem Dritten Reich und der Schweiz endeten, gab es drei wesentliche Punkte: zum einen die Kennzeichnung der ,,Pässe von reichsangehörigen Juden (...), die zur Ausreise in das Ausland oder für den Aufenthalt im Ausland bestimmt sind". Dies war Aufgabe der betreffenden Stellen im Dritten Reich. Aufgabe d0123
2.2. Von Beginn bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges
Noch aber herrschte die Ruhe vor dem Sturm, infolgedessen fast ganz Europa in der totalitären Brandung unterging und nur mit erheblichen menschlichen Verlusten wieder geborgen werden konnte. Am 1. September 1939 um 4:45, gemäß Hitlers Weisung vom 31. August1939 wurden von deutscher Seite aus die Feindseligkeiten gegen Polen eröffnet. Daraufhin stellten England und Frankreich, aufgrund der Ende März abgegebenen Garantieerklärungen für Polen und eines englisch-polnischen Bündnisses von 25. August, am 3. Sptember 1939 um 9 Uhr ein bis 11 Uhr bzw. bis 5 Uhr britischer Sommerzeit befristetes Ultimatum, den Krieg gegen Polen einzustellen und sich zurückzuziehen. Aufgrund der deutschen Ablehnung der beiden Ultimaten, erklärten daraufhin England und Frankreich dem Dritten Reich den Krieg. Binnen kurzem stieg die braune Flut derart an, daß nur noch die gebirgige Schweiz wie ein neutraler Fels in dieser totalitären Brandung herausragte. Wie aber der Kriegsausbruch auf die Politik und die öffentliche Meinung, die Haltung bezüglich der Flüchtlingsfrage in diesen kleinen Rettungsboot, die zudem jetzt akuter war als zuvor, die Wirtschaftsbeziehungen der schweizerischen Industrie, also die Verflechtungen und mögliche Unterstützung der deutschen Kriegswirtschaft seitens der schweizerischen Industrie, und die Transaktionen der deutschen Reichbank mit der schweizerischen Nationalbank (SNB), wirkte, soll im folgenden dargelegt werden.
2.2.1. Die Haltung der Regierung und die öffentliche Meinung während des Krieges
Die Regierung tat das, was auch jede andere Regierung der Welt gemacht hätte - soweit das Land von dem Kriegsausbruch irgendwie betroffen war - und auch gemacht wurde: das Militär wurde mobilisiert und ein Oberbefehlshaber ernannt, um die Grenzen zu sichern, da nicht sicher war, wie Hitler Frankreich angreifen würde. Das deutsche Oberkommando hatte im Grund drei verschiedene Möglichkeiten: die erste wäre, die Maginot-Linie - jener Festungswall, der im Norden etwa bei Sedan beginnt und sich über Nancy bis nach Mülhausen bzw. fast bis nach Basel erstreckte - direkt durch einen Frontalangriff, der sehr hohe Verluste fordern würde, anzugreifen; diese Möglichkeit wurde von dem französischen Generalstab auch erwartet, weshalb die französische Armee den größten Teil ihren Streitmacht dort in Stellung brachte. Die zweite Möglichkeit war, in einem Überraschungsangriff durch das neutrale Belgien, Holland und Luxemburg hindurch, die rechte Flanke, die nur durch ein englisches Expeditionskorps gedeckt war, anzugreifen und die Maginot-Linie von Norden nach Süden aufzurollen und, je nach Gelegenheit, größere Verbände einzukreisen oder in die neutrale Schweiz abzudrängen, wo die Verbände interniert, das heißt entwaffnet und in Lagern gesammelt werden würden. Diese Möglichkeit hatte noch den Vorteil, daß man durch eine schnelle Besetzung der Nordseeküste die Landung einer weiteren englischen Armee verhindern könnte und darüber hinaus noch Basen für die Bombardierung von England und Feindaufklärung gewonnen werden würden. Da die zweite Möglichkeit darin bestand, die französischen Linien von Norden aus aufzurollen, war die dritte Möglichkeit, durch die Schweiz hindurch die Maginot-Linie von Süden aufzurollen. Dazu hätte die deutsche Armee ,,nur" von etwa Schaffhausen aus über Zürich nach Basel in Richtung der burgundischen Pforte, die etwa 160 km westlich von Dijon liegt, oder von Zürich aus weiter nach Bern, Lausanne und Genf in Richtung Lyon Vorstoßen müssen. Diese Möglichkeit hätte dazu geführt, daß das deutsche Reich zusammen mit Italien die strategisch wichtigen Alpentransversalen besetzen und beide Länder somit schneller Material und andere Güter austauschen hätten können. Ein weiterer Vorteil bestand darin, daß Frankreich die Maginot-Linie nicht vollkommen bis zur Grenze hatte ausbauen können - da die Schweiz auf dem Wiener Kongreß von 1815 die Schleifung der Festung Hüningen, etwa 5 km nördlich von Basel, für alle Zeiten festgelegt hatten15 - , sodaß ein Teil der Befestigungen fehlte, wodurch der Festungswall ein wenig von seiner Bedrohung einbüßte. Die von der Regierung angeordnete (1.) Mobilmachung wurde am 28. August 1938 bekanntgemacht; am nächsten Tag, dem 29. August, wurde der General Henri Guisan zum Oberbefehlshaber des eidgenössischen Militärs ernannt. Zeitgleich mit der Ernennung des Oberbefehlshaber waren zwei andere Ereignisse: die schweizerische Bundesrat war für die Dauer einer möglichen bewaffneten Auseinandersetzung zwar nicht mehr an die eidgenössische Verfassung gebunden, mußte aber der Bundesversammlung regelmäßig berichten und von dem Bundesrat beschlossene Maßnahmen bedurften der Genehmigung der Bundesversammlung16. Ferner wurden gegen Abend die Botschafter der wichtigsten Nationen davon verständigt, daß die Schweiz während eines Konfliktes neutral bleiben würde. Wenn auch die militärische Rüstung der schweizerischen Armee vollkommen unzureichend war - die 21 Fliegerkompanien der schweizerischen Luftwaffe hatten insgesamt 18 neuere, einsatzbereite und 36 veraltete Jäger, wobei in 5 Kompanien am Tag der Mobilmachung kein einziges Flugzeug vorhanden war, ferner gab es in der ganzen Schweiz nur 4 Suchscheinwerfer, 3 Horchgeräte und etwa 31 Flugabwehrgeschütze; die Armee hatte keine Benzinvorräte, keinen Wetterdienst, es waren nur 46% der benötigten Gewehrmunition und 23% der benötigten Maschinengewehrsmunition vorhanden17 -, verlief die erste Mobilmachung von 80.000 Mann als Grenztruppen reibungslos. Bis zum Beginn der Westoffensive am 10. Mai, dem Tag der zweiten Mobilmachung, wodurch fast eine Halbe Million Soldaten in der schweizerischen Armee aktiv dienten, wurde noch fieberhaft versucht, die bestehenden Verteidigungsanlagen auszubauen. Mit Beginn der Westoffensive der Wehrmacht begann auch in der Schweiz eine Zeit der Anspannung, Nervosität und (trügerischen) Ruhe, die erst durch die öffentliche und im Radio übertragenen Rede des Bundespräsidenten Pilet-Golaz am 25. Juni 1940 - zeitgleich mit der Unterschrift Frankreichs unter den Waffenstillstand - wieder gebrochen wurde. In dieser Rede wurde eine teilweise Demobilisierung der Armee von 440.000 auf 180.000 Mann angekündigt und von neuen Verhältnissen außerhalb veralteter Formen in Europa gesprochen18. Abgesehen von der Tagespolitik hatte die schweizerische Regierung keine große Rolle mehr zu spielen; es blieb nur noch die Entgegennahme und Beantwortung von deutschen Protestnoten wegen angeblicher Verletzung der Neutralität durch das Militär, welches in den schweizerischen Luftraum eingedrungene Flugzeuge versuchte zur Landung zu zwingen, oder durch die unabhängige Presse, die durch die Abteilung für Presse und Funkspruch versucht wurde zu kontrollieren, was zum Teil streng durchgeführt wurde, da manche Kreise der Regierung bereit waren, die Pressefreiheit weitgehend einzuschränken, wenn dafür - quasi als Tausch oder Ausgleich - die Freiheit der Schweiz gewahrt bliebe. So meinte zum Beispiel der Oberbefehlshaber der schweizerischen Armee General Guisan: ,,Über der Pressefreiheit steht die Freiheit selber"19. Eben jene Presse, die General Guisan im Austausch für die Freiheit opfern würde, war infolge der Berichterstattung gegen Deutschland selber in das Visier des Auswärtigen Amts geraten, wodurch es zu einer komischen diplomatischen Offensive gegen die schweizerische Presse kam. Die Aktion Trump, benannt nach dem Presseattaché der deutschen Botschaft Dr. Georg Trump, die am 9. Juli 1940 in Bern, genauer in der Redaktion des ,,Bund", mit einer Unterredung zwischen dem damaligen Verleger Fritz Pochon und dem Presseattaché der deutschen Botschaft in Bern, Dr. Georg Trump, ihren Anfang nahm, hatte zum Ziel, gewisse Redakteure von schweizerischen Zeitungen, unter anderem der ,,Bund", die ,,Neue Zürcher Zeitung" und die ,,Baseler Nachrichten", wegen ihrer gegen Deutschland gerichteten Artikel aus der Redaktion heraus zu bringen; das Druckmittel von Trump, um seine Forderung nachdrücklicher zu gestalten, waren die deutsch-schweizerischen Beziehungen: entweder würden die betreffenden Redakteure zu weniger wichtigeren Themenbereichen versetzt bzw. würden bei der betreffenden Zeitung kündigen oder Deutschland werde die Auslandskorrespondenten der jeweiligen Zeitungen ausweisen und - quasi als letztes Druckmittel - die betreffende Zeitung sei Schuld an einer Verschlechterung der ohnehin schon gespannten und schlechten Beziehungen beider Länder20. Was auch immer die Motivation für diese merkwürdige Aktion war, im Endeffekt wurde genau das Gegenteil davon bewirkt: es trat die, aus Zeitungsverlegern und den Journalisten 1938 gebildete, ,,Gemischte Pressepolitische Kommission" in Aktion, die einerseits scharf bei der Regierung gegen das Vorhaben Trumps als Einmischung in die Pressepolitik protestiert, und andererseits ein Verbot für die Zeitungen erließ, mit ausländischen Gesandten zu Verhandeln. So wurde im Grunde nur die gemeinsame Linie von Verlegern und Journalisten gestärkt. Ein persönlicher Wandel verdeutlicht die veränderte Stimmung in der Schweiz: Dr. Max Weber, der auf dem Schlachtfeld vor Reims 1919 gelobte, zukünftige Kriege um jeden Preis zu verhindern, wurde nach seiner Rückkehr in die Schweiz wegen Wehrdienstverweigerung verurteilt und aus der Armee ausgestoßen. Angesichts der drohenden Gefahr von Deutschland besetzt zu werden, bat Weber in einem Brief an den General Guisan um Wiederaufnahme in die Armee, was freilich abgelehnt wurde. Doch damit war er nicht zufrieden, sodaß im März 1940 Weber sich das letzte in Bern erhältliche Gewehr kaufte und sich der Ortswehr seiner Heimatgemeinde anschloß21. Auch wenn besonders die Presse gegen den deutschen Nationalsozialismus Partei bezog und so die Öffentlichkeit über den Kriegsverlauf informierte, wurde eine Gefahr im Inneren der Schweiz, der schweizerische Nationalsozialismus oder auch Frontismus genannt, zum Teil überschätzt, was sich aber erst am Ende des Krieges herausstellen sollte. Die Anzahl der Schweizer, die sich zu dem Nationalsozialismus bekannten und von deutscher Seite als die Fünfte Kolonne bezeichnet wurden, in Anlehnung an Franko, der während des Marsches seiner aus allen vier Himmelsrichtungen auf Madrid marschierende Armee die in Madrid lebenden Sympathisanten so nannte, betrug nach Angabe der schweizerischen Behörden etwa 16.000 Mann, etwas mehr als die Nominalstärke einer Division; der Leiter der schweizerischen Nationalsozialisten von Bibra sprach allerdings davon, daß die Zahl von 800 im Jahr 1936 auf 80.000 im Jahr 1940 stieg und dann bis 1943 auf 30.000 zurückging. Diesen Zahlen kann man allerdings auf Grund von Übertreibungen kaum Glauben schenken22. Die von den Frontisten ausgehende Gefahr wird dadurch verdeutlicht, daß die eidgenössische Polizei für den Fall eines Putschversuches oder eines Angriffes von Deutschland schon ausgestellte Haftbefehle besaß, mit denen die im Vorfeld des Krieges aktenkundig gewordenen Anführer verhaftet werden sollten. Etwa 1.000 Schweizer schlossen sich der SS an, 33 wurden bis zum Rang eines Führer der SS befördert, wobei etwa 200 bei der Division Wiking waren; der Rest verteilte sich auf verschiedene andere SS-Verbände23. Auch wenn die Polizei die Frontisten unter Beobachtung stellte und gegen verschiedene Personen wegen Landesverrat vorging, wie zum Beispiel 1943, als allein in Zürich, Basel und Bern 51 Frontisten zu Zuchthaus und 4 zum Tode verurteilt wurden, unterstreicht der im April 1942 begangene Mord an einem Viehhändler aus Bern die latente Gefahr. Arthur Bloch wurde von fünf Bürgern aus Payerne, zwischen 34 und 19 Jahre alt, zuerst mit einer Stange aus Eisen niedergeschlagen und nachher erschossen. Seine Leiche wurde zerstückelt in drei Milchkannen in den nahegelegenen See geworfen, wo die Polizei sie später fand. Die Täter begründeten ihre Tat während der Vernehmung nur mit dem Umstand, daß Bloch ein Jude gewesen sei. Der Anführer der Mörder, die alle mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft wurden, stand auf der Agentenliste der Abwehr im Ausland, Sektion III F24. Dies war aber, neben Aufmärschen und Kundgebungen die einzige Tat der Frontisten, auf welche die Öffentlichkeit auch mit Empörung und Abscheu reagierte.
2.2.2. Die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen während des Krieges
Doch nicht nur der Frontismus war der Gegenstand von vielen Zeitungsartikeln, sondern schon damals die Flüchtlingspolitik der Regierung. Über kein anderes Thema wurde seit dem Buch von Alfred Häsler, der als erster die Flüchtlinge in den Mittelpunkt stellte, aus dem Jahr 1967 mehr geschrieben als über die Flüchtlingspolitik. Am 13. August 1938 wurde, wie bereits schon geschildert, der ,,Judenstempel" eingeführt, an dem die schweizerische Regierung nicht ganz unschuldig ist; ferner wurde schon früher den Juden der Status eines politischen Flüchtlings aberkannt. Die Schweiz nahm im Verlauf des Krieges alles in allem 295.381 Flüchtlinge auf, die zum größten Teil nur vorübergehend in der Schweiz waren. Von diesen 295.381 waren 103.869 Soldaten, die entweder aus der Kriegsgefangenschaft geflohen waren, sich freiwillig hatten internieren lassen, Fahnenflucht begannen hatten oder von dem Roten Kreuz aufgrund besonderer Verwundungen zur Erholung in die Schweiz gebracht wurden. Rund ein Fünftel (55.018) waren Zivilpersonen, die nach Kriegsausbruch in die Schweiz kamen, 9.909 Personen waren Emigranten, die noch vor Kriegsausbruch in die Schweiz gekommen waren. Ferner gab es 59.785 Kinder, die von dem Roten Kreuz zur Erholung in die Schweiz transportiert wurden oder sich in die Schweiz vor dem Krieg flüchteten; zu den 66.549 Grenzflüchtlinge kamen noch 251 politische Flüchtlinge in die Schweiz25. Soweit zu denen, die es in das volle Boot schafften; verläßliche Zahlen über die Personen, die abgewiesen wurden, gibt es nicht. Dies liegt zum einen daran, daß erst am 13. August 1942 - auf die Bedeutung des Datums für die Flüchtlinge komme ich noch später - auf Anweisung des Chefs der eidgenössischen Polizei Heinrich Rothmund über die Anzahl der abgewiesenen Flüchtlinge ein Bericht zu verfassen war; zum anderen liegt es daran, daß nach dem Kriegsende offensichtlich viele von diesen Berichten verloren gegangen und vernichtet worden sind26. Aufgrund der erhaltenen Berichte kam Alfred Häsler in dem Buch ,,Das Boot ist voll" zu der offiziellen Zahl von 9751 abgewiesenen Flüchtlingen während des ganzen Krieges; Jacques Picard kommt in seinem Buch ,,Die Schweiz und die Juden" zu dem Schluß, daß allein im August 1942 etwa 9.700 Flüchtlinge abgewiesen wurden und heute knapp 24.400 Abweisungen nachzuweisen sind27. Die wahrscheinliche Zahl liegt wohl um einiges höher. Am 8. Mai 1945, also zu dem Zeitpunkt, zu dem in Europa die Waffen wieder schwiegen, waren immer noch etwa 115.000 Flüchtlinge in der Schweiz; während des 2. Weltkrieges wurden in der Schweiz etwa 21.000 Juden aufgenommen, etwa 7.000 Juden waren schon vor Kriegsausbruch in die Schweiz geflüchtet, also zusammen etwa 28.000 Juden, die in der Schweiz Zuflucht gesucht und gefunden haben28. Wenn man von der Flüchtlingspolitik der Schweiz redet, kommt man unweigerlich auch darauf zu sprechen, seit wann die planmäßige Vernichtung eines ganzen Volkes, der Holocaust oder die Shoa, bekannt war. Am 20. Januar 1942 fand in einer Villa am Wannsee eine Zusammenkunft statt, die als ,,Wannseekonferenz" bekannt werden sollte. Aufgrund verschiedener Aussagen von Leuten, die Zeugen von Exekutionen wurden oder mit Augenzeugen sprachen, kann man davon ausgehen, daß frühestens seit Mai 1942, spätestens aber seit Herbst 1942 der Grund für die jetzt in verstärktem Maße durchgeführten Deportationen in dem Machtbereich der Nationalsozialisten der eidgenössischen Regierung und der Öffentlichkeit zum Teil bekannt war29. Alfred Häsler hat in seinem Buch ,,Das Boot ist voll" einige Berichte und Aussagen abgedruckt. Angesichts der bekannt gewordenen Verfolgungen von unter anderem den Juden und der dadurch ausgelösten zu erwarteten Steigerung der Flüchtlinge, die in die Schweiz fliehen wollten, reagierte der Bundesrat und der Chef der schweizerischen Polizei, Dr. Heinrich Rothmund. In einem Bericht von dessen Assistenten Dr. Jezler von Juli 1942 schreibt dieser zwar, daß aufgrund von Berichten über die den Juden drohende Deportation ,,eine Rückweisung kaum mehr verantwortet werden kann", aber wegen einer Reihe von Gründen, die Ernährung, die Anzahl der Flüchtlinge, die innere Sicherheit und ,,außenpolitische Erwägungen"30, weniger Flüchtlinge aufgenommen werden sollten. Mit diesem Bericht und einer ähnlichen Empfehlung von Heinrich Rothmund beschloß der Bundesrat am 4. August 1942 eine strengere Anwendung des Artikel 9 des Bundesratsbeschluss vom 17. Oktober 1939. In diesem Artikel wurde die Ausweisung von illegal in das Land gekommenen Flüchtlingen geregelt. Um diesen Beschluß besser durchsetzen zu können und zukünftige illegale Einreise zu be- oder zu verhindern, ließ Rothmund am 13. August die Grenzen schließen und später am 9. Oktober von Militär unter anderem mit Stacheldrahtzäunen sichern31. In dem Schreiben an die Polizei der Kantone hieß es ferner: ,,Flüchtlinge nur aus Rassengründen, zum Beispiel Juden, gelten nicht als politische Flüchtlinge"32. Erst am 12. Juli 1944 wurde diese Passage durch folgendes ersetzt: ,,Aufzunehmen sind vorläufig nur noch: (...) Ausländer, die aus politischen oder anderen Gründen wirklich an Leib und Leben gefährdet sind und keinen anderen Ausweg als die Flucht nach der Schweiz haben, um sich der Gefahr zu entziehen "33. Die Folge dieser Anordnung vom 13. August war ein öffentlicher Aufschrei in den Zeitungen, in Briefen an den Bundesrat oder in öffentlichen Reden und Vorträgen, der einem Sturmangriff auf Heinrich Rothmund und die betreffende Weisung gleich kam. So schrieb zum Beispiel die ,,Basler Nachrichten" vom 22. August folgendes: ,,Die Schweiz darf auch in der großen Katastrophe unserer Zeit ihr Asylrecht nicht preisgeben. Die Haltung unserer Fremdenpolizei gegenüber den armen Flüchtlingen hat Entsetzen erregt, und die vorgebrachten Gründe erscheinen als nicht stichhaltig ..." oder ,,Der Landbote" aus Winterthur am selben Tag: ,,Wenn sich eidgenössische Behörden auf den Standpunkt stellen, Deportation und Rassenverfolgung, Flucht vor dem Schicksal der Gefangennahme als Geisel sei kein völkerrechtlicher Begriff der Anspruch auf Asylgewährung gebe, so muß man sich nur wundern über einen solchen Zynismus und solche kaltherzige Buchstabenreiterei Hier liegt eine Verbeugung vor dem Ausland vor, die sich mit den Souveränitätsrechten der Schweiz (...) nicht verträgt."34 ; aufgrund der enormen öffentlichen Reaktion wurde die vollständige Schließung der Grenzen durch ein Rundschreiben an die kantonalen Polizeibehörden am 25. August 1942 gelockert. Um die bisherige Flüchtlingspolitik zu verteidigen, hielt der Bundesrat Eduard von Steiger, der Vorgesetzte von Heinrich Rothmund, am 30. August eine Rede vor etwa 8.000 Schweizern, worin die Schweiz mit einem Schiff verglichen wurde: ,,Wer ein schon stark besetztes kleines Rettungsboot mit beschränktem Fassungsvermögen und ebenso beschränkten Vorräten zu kommandieren hat, indessen Tausende von Opfern einer Schiffskatastrophe nach Rettung schreien, muß hart scheinen, wenn er nicht alle aufnehmen kann. Und doch ist er noch menschlich, wenn er beizeiten vor falschen Hoffnungen wart und wenigstens die schon Aufgenommen zu retten sucht."35. Die bloße Aufnahme von Flüchtlingen war und ist die eine Sache; eine andere Sache ist die Unterbringung, Ernährung und die dadurch entstandenen Kosten. Die Kantone, in denen die Flüchtlinge in Lagern untergebracht wurden, verlangten von einem Flüchtling eine gewisse Summe als Garantie; so erhielt zum Beispiel Thurgau 1941 für 142 Flüchtlinge insgesamt 468.000 Schweizerfranken als Garantiesumme, pro Flüchtling etwa 3.300 Schweizerfranken36, wofür die Flüchtlinge die Erlaubnis erhielten, das Kanton zu betreten und sich dort aufzuhalten. Ausgaben für Lebensmittel und Kleidung war in der Summe nicht enthalten. Diese Ausgaben wurden den Hilfsorganisationen, der Bevölkerung und, zu einem großen Teil, den in der Schweiz lebenden Juden überlassen. So zahlten die verschiedenen Hilfsorganisationen, der Verband schweizerischer Jüdischer Fürsorgen/Flüchtlingshilfen (VSJF), der schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), der American Jewish Joint Distribution Comitee (JDC) und Hias-Ica-Emigdirect (HICEM), von 1933 bis 1952 zusammen 120.106.631 Schweizerfranken, die sich wie folgt auf die Organisationen verteilte: VSJF zahlte 65.995.000 sFr, SIG, der das Geld durch Sammlungen bei Schweizer Juden bekam, 10.049.000 sFr, JDC und HICEM zusammen 44.062.631 Schweizerfranken; Der VSJF bekam von der Regierung in dem selben Zeitraum 9.640.000 Franken als Unterstützung, zu denen noch 1.600.000 Franken aus einer Sondersteuer für Juden. Allein während des Krieges in Europa zahlte der VSJF 25.380.677 Franken an Unterstützung für Flüchtlinge, während der SIG durch Sammlungen in der Schweiz auf 4.902.000 Franken und durch das JDC zusammen mit HICEM durch Sammlungen und Spenden in Amerika 21.210.000 Franken aufgebracht wurden37. Zu Ende des Abschnittes über die Flüchtlinge ist es nun an der Zeit, zum einen ein Flüchtlingsschicksal herauszugreifen und schildern und zum anderen - quasi exemplarisch für die vielen anderen, die in der Literatur zum Teil genannt werden, zum Teil auch nicht - ein Schicksal von einer Person, die in jener Zeit sich nicht an die Verordnungen des EJPD hielt, sondern sich von ihrem Gewissen leiten ließ. Am 24. August 1942 wurde in der ,,National-Zeitung" aus Basel das Tauziehen um ein junges jüdisches Ehepaar geschildert, das von Belgien über das besetzte Frankreich in die Schweiz kam, wo es sich auf der belgischen Botschaft meldete. Von dort mit Geld unterstützt, wurden die beiden an die Flüchtlingshilfe verwiesen, verbrachten aus Angst, der Polizei übergeben und abgeschoben zu werden, die Nacht aber auf dem israelitischen Friedhof. Am nächsten Morgen, als sie von dem Gärtner gefunden wurden, nahm sich die Flüchtlingshilfe ihrer an und verständigte die Polizei. Von der Polizeiwache aus, wo die beiden aus Mitleid zuvorkommend behandelt wurden, sollte das Paar in das besetzte Frankreich zurückgeführt werden. Die Ausweisung wurde zwei Tage später vollstreckt, nachdem Vertreter der Flüchtlingshilfe und andere Persönlichkeiten erfolglos versuchten, ein Aufenthaltsrecht für das Ehepaar zu erwirken. Nach dem Krieg gab die israelitische Kultusgemeinde in Bern bekannt, daß der Mann, etwa 22 Jahre alt, in Frankreich erschossen und die Frau, etwa 19 Jahre alt, deportiert worden sei. Aufgrund von Dokumenten aus Yad Vashem soll der Historiker Guido Koller das Ehepaar identifiziert haben: der Mann, Simon Zagiel, soll die Deportation nach Ausschwitz am 24. August überlebt haben, hingegen seine Frau, Celine Zagiel, direkt von der Rampe aus vergast worden sein38. Das Schicksal von Paul Grüninger, der 1938 zwischen 2.000 und 3.000 Flüchtlinge, zum größten Teil Juden aus Österreich, als Leiter der Polizei in Sankt Gallen in die Schweiz ließ, mutet ähnlich an: am 31. März 1939 wurde er von der Regierung des Kantons Sankt Gallen entlassen und im Herbst 1940 wegen Amtsmißbrauches verurteilt. Er starb 1972 verarmt, da Grüniger aufgrund der Verurteilung seine Pensionsansprüche verloren hatte. 1993 wurde Paul Grüninger auf betreiben einiger Privatpersonen in Sankt Gallen von der Kantonsregierung wieder rehabilitiert39.
2.2.3. Die Wirtschaftsbeziehungen der schweizerischen Industrie mit dem Dritten Reich
Mit Ausbruch des Krieges wurde noch ein anderes Themengebiet akut: die Wirtschaft. Ähnlich wie im Ersten Weltkrieg bekam die Wirtschaftsblockade des Feindes eine wichtige Rolle, die mit Hilfe von Zertifikaten über die (End-) Bestimmung von Gütern und der schwarzen Liste zugunsten der Alliierten entschieden werden konnte. Wie kein anderes Land in Europa war und ist die Schweiz von Importen aus dem Ausland abhängig, besonders von Lebensmittelimporten, der Lieferung von Kohle, Beton und anderen Rohstoffen. Dafür exportierte die Schweiz vor allem feinmechanische Instrumente, die für Präzisionsgeräte wie eine Stoppuhr oder auch Annäherungszünder nötig sind. Das Völkerrecht sieht für einen neutralen Staat vor, daß im Zuge seines Außenhandels keine der kriegführenden Parteien benachteiligt werden darf. Kurz nach Ausbruch des Krieges beschloß der Bundesrat, die Ausfuhr von Kriegsmaterial unter staatlicher Aufsicht zu erlauben. p>2.2.3.1. Die Importe und Exporte der schweizerischen Wirtschaft mit Deutschland Nach dem Fall Frankreichs wurde die Schweiz wirtschaftlich in das Dritte Reich eingebunden; so wuchsen die Exporte von Eisen- und Stahlwaren von 1939 bis 1943 von 5,9 auf 107,3 Millionen Franken, von Maschinen- und Maschinenbestandteilen von 25,3 auf 156,6 Millionen, der Export von Instrumenten und Apparaten von 3,7 auf 97 Millionen Franken. Der deutsche Anteil am Export stieg von 15,5% 1937 bis auf 41,7% im Jahr 1942, während der Anteil am Import von 22,2 % 1937 bis auf 36,4% 1944 anstieg. Der Handel mit kriegswichtigen Materialien, also zum Beispiel Waffen, Munition, Maschinen zur Herstellung von Waffen oder Munition, sogenannte Präzisionsgeräte und anderes, nahm in den entscheidenden Jahren 1942 und 1943 stark zu: während die Alliierten 1942 Waren in einem Gegenwert von 13,8 Millionen bekamen, wurde in das Dritte Reich für 353 Millionen Franken exportiert. Noch deutlicher 1943: Deutschland bekam Rüstungsgüter im Wert von 425 Millionen Franken, während sich die Alliierten mit 17,8 Millionen begnügen mußten40. Ende 1942 arbeitete der größte Teil der schweizerischen Industrie für das Dritte Reich: 80% der Industrie für Präzisionsinstrumente, 75% der Industrie für Uhrwerke, 70% der Elektroindustrie und 60% der schweizerischen Waffenindustrie41.
Bezahlt wurden die Lieferungen zum einen in Naturalien, also Rohstofflieferungen, welche die Schweiz benötigte, zum anderen mit Krediten, die von der eidgenössischen Regierung gewährt wurden. Die Schweiz erhielt 1952 einen Teil der Kredite von der Bundesrepublik zurück; insgesamt wurden von den 1.119 Millionen Franken 665 Millionen zurückgezahlt42. Der Exportschlager der schweizerischen Waffenindustrie in das Dritte Reich war die 20 mm Flugabwehrkanone des Konzerns Buhrle-Oerlikon, was ein Beispiel für die schweizerische Geschäftstüchtigkeit liefert: Ein Teil der Waffen, die zwar von Deutschland noch 1945 bestellt wurden, aber aufgrund der Niederlage nicht mehr zugestellt werden konnten, wurde einfach exportiert. So wurde für die Waffen doppelt bezahlt, das erste Mal von der deutschen Seite mit Hilfe der schweizerischen Kredite, und das zweite Mal von dem neuen Käufer. Von UN-Inspektoren 1969 wurde eine große Anzahl von jenen 20 mm Kanonen in den Lagern des General Ojukwu gefunden, der in Biafra, einem kleinen Teil von Nigeria an der südlichen Grenze zu Kamerun, einen unabhängigen Staat ausrufen wollte; ein Teil noch mit deutschen Seriennummern43. Wenn man die Kredite, etwa 1,2 Milliarden Franken, und die Goldlieferungen von etwa 1,6 Milliarden Franken, auf die ich weiter unten genauer eingehen werde, zusammenzählt, wie etwa Werner Rings in dem Buch ,,Raubgold aus Deutschland" es macht, kommt man auf eine Summe von etwa 3 Milliarden Franken, mit denen die deutsche Kriegswirtschaft von der Schweiz unterstützt wurde44 ; gemessen an den gesamten Kriegskosten des Dritten Reiches, die von Professor Boelcke in einer Mitteilung an Werner Rings vom 24.1.1984 auf etwa 1.200 Milliarden geschätzt werden45, mutet der Schweizer Beitrag eher gering an. Dabei wird aber vergessen, daß dieser Betrag von einem ,,neutralen" Land zum Teil freiwillig geleistet wurde und qualitativ hochwertiges Material umfasste.
2.2.3.2. Die Goldtransaktionen der deutschen Reichsbank mit der Schweizerischen Nationalbank
Die sogenannten Clearingkredite der Schweiz an Deutschland, also die Verrechnung von einer Schuld mit einer (Waren-) Lieferung, - in diesem Fall wurden die Kredite an Deutschland mit Materiallieferungen wie Kohle oder Lebensmittel auf Grund eines Wirtschaftsabkommen von 1934 miteinander verrechnet, wodurch die Schulden des Dritten Reiches wohl ziemlich gemildert wurden46 - betrugen trotzdem im Endeffekt etwa 1,119 Milliarden Schweizer Franken zu lasten des Dritten Reiches; ein Teil war durch die Goldlieferungen der deutschen Reichsbank an die Schweizerische Nationalbank (SNB) gedeckt, wobei ein Teil des Goldes, das die Reichsbank an die SNB schickte, dazu benutzt wurde, um strategische Rohstoffe zu bezahlen, teils direkt von dem Depot der Reichsbank aus, teils über den Umweg der SNB, wodurch das Gold gewaschen wurde. Diese Goldwäsche wurde notwendig, da schon ab 1942 die Alliierten neutrale Staaten vor der Annahme von deutschem Gold warnten, weil ihnen Informationen vorlagen, daß auch illegal in Besitz genommenes Gold über die Schweiz verkauft werden würde. Bevor ich nun weiter darauf eingehe, erachte ich es als notwendig zuvor zu erklären, was man unter legaler beziehungsweise illegaler Inbesitznahme von Gold versteht und warum das Gold so wichtig ist. Gemäß dem während des Zweiten Weltkrieges gültigen Völkerrecht darf ein siegreicher Staat zwar das Eigentum des besiegten Staates als Kriegsbeute behandeln, aber eben nur das staatliche und nicht das private Eigentum. Ebenso wie die Schweizerische Nationalbank hatten sich auch unter anderem die Niederländische und Belgische Nationalbank schon vor dem Krieg in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, damit das Gold der Notenbanken auch durch das Völkerrecht geschützt ist. Dementsprechend wird von legalem Beutegold gesprochen, wenn es sich um staatliches Eigentum gehandelt hat; analog dazu besteht illegales Raubgold aus Gold privater Herkunft, also in diesem Fall auch das Gold der Holländischen und Belgischen Nationalbank47. Ein weiterer, geringer Anteil an dem ,,looted gold", wie das Raubgold von den Alliierten während und nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wurde und auch noch heute wird, stammt aus einer anderen Quelle: das sogenannte Melmer-Gold, das Gold derer, die in den Konzentrationslagern umgebracht wurden; benannt wurde das Gold aus den Konzentrationslagern nach dem Leiter des Amtes AII des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, dem SS-Hauptsturmführer Bruno Melmer, der diese Transaktionen vornahm48. Bevor ich nun auf die Zahlen zu sprechen komme, eine kleine Anmerkung, um die Wichtigkeit des Goldes zu unterstreichen. Die deutsche Kriegswirtschaft war im großen Maße von Importen der wichtigen Rohstoffe abhängig: so mußte Mangan, das man zur Herstellung von unter anderem Kanonenrohren oder Gewehrläufen brauchte, zum 100% aus Spanien importiert werden; Wolfram, ein Grundstoff der Stahl-Wolfram- Legierungen, die in der Luftfahrt noch heute benötigt werden, wurde zu 75,9% aus Portugal importiert. Chrom, benötigt für rostfreien Stahl, Kugellager oder Granathülsen, wurde 1943 zu 99,8% aus der Türkei importiert49. Bezahlt wurden diese Lieferungen entweder in Gold oder in Schweizer Franken. Während des Krieges lieferte die deutsche Reichsbank Gold für insgesamt 594,3 Millionen Dollar in das Ausland. Davon entfielen 4,6 Millionen Dollar auf die Schwedische Nationalbank, 5,7 Millionen auf die Türkische Nationalbank, was direkt und ohne Umweg über die Schweiz an das Land geliefert wurde; der Anteil des in die Schweiz gelieferten Goldes betrug 450,2 Millionen Dollar, von denen 389,2 Millionen der Schweizerische Nationalbank (SNB) zufielen und 61,2 Millionen direkt schweizerischen Geschäftsbanken zugute kamen. Insgesamt wurde in der kommentierten Übersicht der Unabhängigen Experten Kommission, auf die ich mich beziehe, die gesamte Goldmenge der Reichsbank mit 909,2 Millionen Dollar beziffert. Diese Menge splittet sich wie folgt auf: 29,5 Millionen Dollar in Gold wurden aus dem Ausland gekauft, wobei allein 23 Millionen aus der Sowjetunion kamen. Die Vorkriegsbestände, also die Reserven und das Gold der österreichischen, tschechoslowakischen Notenbanken sowie das Gold der Länderbanken, wurden mit 258,7 Millionen beziffert. Soweit das legale Gold, dem zum Teil Beutegold angehört. Das Gold von Privatpersonen, das von sogenannten Devisenschutzkommandos eingesammelt wurde, belief sich auf 146,0 Millionen Dollar, von denen etwa 2,5 Millionen - die Zahlen schwanken zwischen 2,5 und 4 Millionen - auf das sogenannte Melmer-Gold entfielen. Doch fast die Hälfte des Goldbetrages war das Gold von anderen Zentralbanken, zusammen 475,0 Millionen Dollar; das Gold aus der belgischen und niederländischen Zentralbank machte dabei mit 137,2 und 225,9 Millionen Dollar den Hauptteil aus. Wenn man einen Kurs von 4.20 Franken für einen Dollar zugrundelegt, kommt man auf eine Summe von etwa 1.890,84 Millionen Schweizer Franken für das Gold, das während des Krieges in die Schweiz gelangt ist. In den Büchern der Reichsbank wird die Summe mit 1.949,8 Millionen Franken zusammen und mit 1.685,0 Millionen Franken allein an die SNB beziffert; nach der schweizerischen Handelsstatistik, allerdings ohne die Jahre 1944 und 1945, hatte der Goldhandel ein Volumen von 1.751,2 Millionen Franken, von denen etwa 35 Millionen Franken das Industriegold, also das Gold, das in der Industrie verarbeitet wurde, ausmachte. Nach Berechnungen der SNB wurden während des Krieges 1.654,6 Millionen Franken in das Golddepot der Reichsbank geliefert. Von diesen 1.669,8 Millionen Franken, um den Mittelwert von der Reichsbank und der SNB zu nehmen, wurden 7,1 Millionen an Spanien, an Schweden 88,2 Millionen und 214,6 Millionen an Portugal weiterverkauft. Die SNB erstand in den Jahren 1940-1945 Gold für 1.224,2 Millionen Gold, wobei allein in den beiden wichtigen Jahren 1942/43 Gold für 802,6 Millionen Franken von der SNB gekauft wurden; zum Vergleich: 1940 betrug die Summe noch 67,1 Millionen, 1941 schon 142,7 Millionen, 1944 immer noch 182,1 Millionen und im Jahr 1945 wurde noch für 29,8 Millionen Gold gekauft. Was fing die SNB nun mit den 1.224,2 Millionen Franken in Gold an? Ein Teil des Goldes wurde an andere Zentralbanken weiterverkauft, so daß durch diese Vorgänge 876,684 Millionen Franken wieder weiterbewegt wurden; Empfänger waren zum Beispiel Spanien mit 185,149 Millionen, oder Portugal mit 536,601 Millionen. Aus Portugal wurde Wolfram, aus Spanien Mangan nach Deutschland exportiert, wodurch die deutsche Kriegsmaschinerie am Laufen erhalten wurde. Der Grund für diese großen Summen an Gold, welche von der SNB gekauft wurden, wird anhand von folgenden Dokumenten recht schnell deutlich. In einem Telegramm an die schweizerische Botschaft in Washington am 13.4.1942 steht zu den Goldgeschäften folgende Stelle: ,,Wenn Deutschland Gold in der Schweiz verkauft, so geschieht es, weil es Schweizer Franken für Zahlungen an Drittländer benötigt. Wir kaufen deutsches Gold und verkaufen es an Länder, die von Deutschland Schweizer Franken erhalten haben.". Deutlicher wird auf dieses Thema in einem Brief vom 31.5.1944 an dieselbe Adresse eingegangen: ,,Im ganzen genommen ist die Schweiz für Schweden eine Art spanische Wand. Sie liefert ihm ein Alibi.". In einem Brief der SNB an den schweizerischen Außenminister von dem 7.8.1944 heißt es wörtlich: ,,Ein Teil des von Deutschland gelieferten Goldes bleibt bisweilen nur kurze Zeit bei der Schweizerischen Nationalbank liegen, da die Notenbanken der südwest- und südosteuropäischen Staaten ihre Frankenguthaben nach Bedarf wieder in Gold umwandeln."50. An Warnungen, daß ein Teil des deutschen Goldes nicht legal erworben worden sein soll, hat es nicht gefehlt. Im Sommer 1942 wurde durch britische Radiosendungen verbreitet, daß Deutschland auch Raubgold verbreiten würde, während etwa ein halbes Jahr später im Januar 1943 die offizielle Warnung durch ein von mehreren Regierungen unterzeichnetes Memorandum den nicht vom Krieg betroffenen Ländern zugestellt wurde, in dem es hieß, daß die Alliierten alle Transaktionen mit Waren oder anderen Sachen aus dem besetzten Einflußbereich von Deutschland für nichtig erklären würden; die Warnungen nehmen von Mal zu Mal an Deutlichkeit zu. Von schweizerischer Seite aus wird dagegen argumentiert, daß es nicht erwiesen sei, daß Deutschland mit Raubgold handeln würde, daß infolge von höherer Gewalt die Schweiz fast gegen ihren Willen zu dem einzigen Markt geworden sei, auf dem man Gold und Devisen kaufen könne; schließlich würde mit dem Gold die eigene Versorgung sichergestellt, da infolge der Blockade seitens der Alliierten, wodurch die Finanzmittel derer, die von Hitler überfallen und besetzt wurden oder sich mit Hitler verbündet hatten, eingefroren wurden, der Export und Import erschwert worden war51. Nun soll der Weg des holländischen und belgischen Goldes aufgezeigt werden, zum einen, weil beides jeweils etwa ein Drittel des gesamten Goldwertes ausmachten, der während des Krieges in die Schweiz floß, zum anderen weil man daran das Vorgehen der deutschen Behörden sehen kann, die auf Wahrung einer Scheinlegalität achteten. Der Fall des holländischen Goldes liegt einfach und ist schnell geschildert: die holländische Zentralbank hatte zwar im März 1940 einen beträchtlichen Teil der Goldreserven, etwa 1,7 Milliarden Franken, nach Übersee bringen lassen, währenddessen weitere 382 Millionen in Gold im Keller der Nationalbank auf die Evakuierung warteten. Infolge des schnellen Zusammenbruchs des Militärs blieben um die 500 Millionen Franken in Rotterdam in einer Filiale zurück; bei dem Versuch jenes Gold abzutransportieren, lief das Schiff auf eine Mine und sank, woraufhin es von den deutschen Behörden geborgen und vorerst der Nationalbank zurückgegeben wurde. Nach dem Rücktritt des bisherigen Notenbankenchefs wurde Rost van Tonningen der Nachfolger, der das holländische Gold nach Berlin als Besatzungskosten verkaufen und das geborgene Gold ohne Entschädigung nach Berlin bringen ließ; das ganze hatte noch ein kleines gerichtliches Nachspiel, als im März 1941 ein Prisengericht in Hamburg entschied, daß die Requirierung des geborgenen Goldes nach dem Völkerrecht rechtens sei.52. Da aber das Schiff nicht auf hoher See aufgebracht wurde, konnte die betreffende Rechtsordnung des Völkerrechts nicht angewendet werden. Der Fall des belgischen Goldes ist etwas abenteuerlicher: in 4944 Kisten verpackt wurde das Gold nach Dakar in das französische Kolonialreich verschickt, da das Gold in der französischen Nationalbank deponiert war. Aufgrund eines Schwindels - anstelle des belgischen Gouverneur, der angeblich plötzlich erkrankt sei, wurde ein von deutschen Behörden eingesetzter Kommissar zu der Konferenz am 24. Oktober 1940 als Vertreter der belgischen Nationalbank geschickt - wurde von der Banque de France die Kisten mit dem Gold im November 1940 der Rücktransport nach Frankreich veranlaßt. Nach einer 18 monatigen Odyssee durch Afrika, das Gold konnte nur auf dem Landewege transportiert werden, traf das erste Gold Ende 1941 in Marseilles ein, wo es den deutschen Behörden übergeben wurde. Der letzte Transport von jenem Gold kam am 26.5.1942 in Berlin an. Dort wurde daraufhin der Gegenwert in Reichsmark hinterlegt und das Gold in die Schweiz gebracht und zu Devisen gemacht53. Dieses Vorgehen war ebenso illegal, wie das gegenüber dem holländische Gold: der angebliche Vertreter der belgischen Reichsbank wurde durch nichts legitimiert; das Gold wurde in Marseilles an deutsche Vertreter der Reichsbank ausgehändigt; und zum Schluß fehlte die Zustimmung der belgischen Nationalbank zum Verkauf des Goldes vollkommen. Deshalb kann man bei dem Gold sowohl aus Holland als auch aus Belgien von Raubgold reden, das widerrechtlich in die Schweiz und weiter verkauft wurde.
2.2.4. Die Bedeutung des neutralen Staates ,,Schweiz" während des Krieges
Doch es gab nicht nur negative Aspekte einer neutralen Schweiz während des Zweiten Weltkrieges, wie die Wirtschaftsbeziehungen oder das Verhalten bei der Flüchtlingsthematik, sondern auch durchaus positive, wie zum Beispiel die Schutzmachtstellung der Schweiz oder die Aktivitäten des Roten Kreuzes von Genf aus um nur zwei Aspekte zu nennen. Aufgabe der Schutzmacht ist es dafür zu sorgen, daß Kriegsgefangene und andere internierte Personengruppen gemäß den internationalen Bestimmungen behandelt werden, sie organisiert gegebenenfalls mit Hilfe des Roten Kreuzes einen Austausch und sorgt dafür, daß Personen, die von dem Kriegsausbruch im Ausland überrascht und sonst interniert werden, in das Heimatland reisen können. Während des Zweiten Weltkrieges betreute die Schweiz auf diese Weise 43 Staaten, wobei sich diese Unterstützung nicht immer nur auf Menschen bezogen hat, sondern auch auf Lebensmittel, Kleider und andere Dinge. So hat zum Beispiel der schweizerische Botschafter in Budapest als Vertreter der Schutzmacht gehandelt, als er angesichts einer drohenden Massendeportation 1944/45 an Juden sogenannte Schutzpässe ausstellte, mit denen der jeweilige Inhaber nicht deportiert werden durfte. Nachdem dieser Vorgang in Bern bekannt wurde, beurteilte der Bundesrat die Handlung als ,,Kompetenzüberschreitung" und erteilte Lutz eine Rüge54. Ein anderer Aspekt, den ich oben schon erwähnte, waren die Aktionen des Roten Kreuzes, was sich besonders um die Kriegsgefangenen kümmerte. Allerdings bezog sich dieses Engagement wohl nicht auf die Juden, was folgendes Beispiel verdeutlicht: Der Gesandte des Roten Kreuzes Louise Häfliger verhandelte in dem KZ Mauthausen mit den amerikanischen Truppen, die auf dem Vormarsch waren und mit der SS-Besatzung des Lagers solange, bis die SS das Lager ohne Kampf räumte und dadurch den Insassen, etwa 60.000 Menschen das Leben rettete. Nach bekanntwerden dieser Aktion wurde er von dem Roten Kreuz entlassen55. Doch nicht nur wegen humanitärer Aufgaben war die Schweiz mit ihrer Neutralität während des Krieges wichtig; ebenso war die Schweiz, auch infolge ihrer geographischen Lage mitten in dem von Hitler besetztem Europa, eine Art Drehscheibe für Informationen und Agenten geworden, was hier kurz Erwähnung finden soll. So war zum Beispiel Allan W. Dulles, der Chef des amerikanischen Geheimdienstes für Zentraleuropa OSS, aus dem nach dem Krieg der CIA und das FBI hervorgehen sollten, als Sonderbeauftragter von Roosevelt an der Botschaft in Bern akkreditiert, der chinesische Geheimdienst für Europa lief über den Minister Chi Tsai- hoo, ebenfalls in Bern In der französischen Gesandtschaft, in Bern, arbeiteten gleich drei Angestellte für das mit den Alliierten verbündete Frankreich, während der russische Geheimdienst in Genf und Lausanne seine Aktivitäten entfaltete und der japanische Nachrichtendienst von Zürich aus arbeitete56.
3. Resümee: Das Verhalten der Schweiz gegenüber dem Nationalsozialismus
Doch können solche durchaus positive Aspekte der Schweiz nicht den verheerenden Gesamteindruck des Verhaltens gegenüber dem Nationalsozialismus beschönigen. Die Schweiz unterstützte die nationalsozialistische Kriegsmaschinerie mit etwa 3 Milliarden sFr. nach damaligen Wert; davon waren etwa 1,8 Milliarden sFr Gold, das von der Reichsbank in die Schweiz verkauft wurde. Knapp zwei Drittel stammten von der Belgischen und Holländischen Nationalbank und waren damit Raubgold. Die schweizerischen Kredite an Deutschland wurden mit Lieferung von Materialien, die in der Schweiz benötigt wurden, verrechnet; dennoch blieben etwa 1,2 Milliarden sFr zu Lasten des Dritten Reiches übrig, von denen knapp die Hälfte (665 Millionen sFr) nach dem Krieg von der Bundesrepublik Deutschland bezahlt wurden. Die letzte Goldlieferung an die SNB traf am 6. April 1945, etwa drei Wochen vor dem Selbstmord von Hitler, in Bern über 15,8 Millionen sFr ein57. Während des ganzen Krieges wurden ganze 21.000 Juden aufgenommen, für deren Unterkunft die Hilfsorganisationen und zum Teil die schweizerischen Juden fast allein aufkommen mußten; nach der Schließung der Grenzen wurden, nach offiziellen Zahlen, zwischen 10.000 und 25.000 Flüchtlinge abgewiesen, obwohl man wußte, was Juden und anderen Flüchtlingen erwartet; die Dunkelziffer der Abweisungen dürfte um einiges höher gelegen haben. Jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges sind auch die Archive der ehemaligen Sowjetunion zugänglich, zumal in den nächsten Jahren, knapp 50 Jahre nach Kriegsende, einige Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, da die Geheimhaltungsfrist schon abgelaufen ist oder in Kürze abläuft. So gesehen steht einer Aufarbeitung der Vergangenheit in der Schweiz nichts oder nur wenig im Wege. Wenn ich dann allerdings in der Zeitung lese, daß Jean Ziegler aufgrund des Buches ,,Die Schweiz, das Gold und die Toten" wegen Landesverrat angeklagt wurde58, überkommen mich doch Zweifel, ob eine detaillierte Diskussion über das Verhalten der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges nicht von sogenannten ,,Patrioten", zum Teil 80 oder mehr Jahre alt, verhindert wird.
[...]
1 siehe Dr. Friedrich Berber, Lehrbuch des Völkerrechts, zweiter Band: Kriegsrecht, Kap. 9
2 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg 1933-1945, S.32-44
3 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S. 315-326
4 siehe Werner Rings, Die Schweiz im Krieg, S.92/92
5 siehe Jacques Picard, Die Schweiz und die Juden 1933-1945, S.61
6 siehe. Jacques Picard, Die Schweiz und die Juden, S.46
7 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.316-321
8 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.321
9 siehe Alfred A. Häsler, Das Boot ist voll. Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933-1945, S.116ff.
10 siehe Alfred A. Häsler, Das Boot ist voll, S.117-118
11 siehe Alfred A. Häsler, Das Boot ist voll, S.41
12 siehe Alfred A. Häsler, Das Boot ist voll, S.46-48
13 siehe Alfred Häsler, Das Boot ist voll, S.54/55
14 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.325
15 siehe Janusz Piekalkiewicz, Die Schweiz am Rande des Krieges, S.10f
16 siehe Alice Meyer, Anpassung oder Widerstand, S.92f.
17 siehe Werner Rings, Die Schweiz im Krieg, S.150ff.
18 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.175ff und Alice Meyer, Anpassung oder Widerstand, S.113ff
19 siehe Alice Meyer, Anpassung oder Widerstand, S.97
20 siehe Georg Kreis, Juli 1940 die Aktion Trump, S.7ff.
21 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.123f.
22 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.285ff.
23 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.247f.
24 siehe Jacques Picard, Die Schweiz und die Juden, S.59 und Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.113f.
25 siehe Alfred Häsler, Das Boot ist voll, S.338
26 siehe Jean Ziegler, Die Schweiz das Gold und die Toten, S.229f
27 siehe Jacques Picard, Die Schweiz und die Juden, S.415
28 siehe das Dokument ,,Die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg" von Guido Koller, von der Internetseite des Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten, was beigelegt wird
29 siehe Alfred Häsler, Das Boot ist voll, S.71-88
30 siehe Alfred Häsler, Das Boot ist voll, S.88f
31 siehe Werner Rings, Die Schweiz im Krieg, S.336
32 siehe Alfred Häsler, Das Boot ist voll, S.88-90
33 siehe Alfred Häsler, Das Boot ist voll, S.290f.
34 siehe Alfred Häsler, das Boot ist voll, S.154-159
35 siehe Alfred Häsler, Das Boot ist voll, S.122
36 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.341
37 siehe Jacques Picard, Die Schweiz und die Juden, S.370f.
38 siehe Jean Ziegler, Die Schweiz das Gold und die Juden, S.233ff. und Werner Rings, Die Schweiz im Krieg, S.328f. und Alfred Häsler, Das Boot ist voll, S.13f.
39 siehe Jean Ziegler, Die Schweiz das Gold und die Toten, S.260
40 siehe Heiniger Markus, Dreizehn Gründe, S.66ff.
41 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.135
42 siehe Heiniger Markus, Dreizehn Gründe, S.106
43 siehe Jean Ziegler, Die Schweiz das Gold und die Toten, S.149f.
44 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.167ff
45 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.221
46 siehe Heiniger Markus, Dreizehn Gründe, S.105ff.
47 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.17f.
48 siehe den 25 Seiten langen Bericht ,,Goldtransaktionen im Zweiten Weltkrieg: Kommentierte statistische Übersicht" der Unabhängigen Experten Kommission Schweiz - Zweiter Weltkrieg, Bern im Dezember 1997, S.8 (geschrieben für die Goldkonferenz in London vom 2.-4. Dezember 1997)
49 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.30f. und Jean Ziegler, Die Schweiz das Gold und die Toten, S.45f
50 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.69f.
51 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.71-80
52 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.41ff.
53 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.10-30
54 siehe Heiniger Markus, Dreizehn Gründe, S.155ff.
55 siehe Heiniger Markus, Dreizehn Gründe, S.160ff.
56 siehe Werner Rings, Schweiz im Krieg, S.360f.
57 siehe Werner Rings, Raubgold aus Deutschland, S.164f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der völkerrechtliche Status der Schweiz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges?
Die Schweiz blieb aufgrund ihrer Neutralität von der Besetzung im Zweiten Weltkrieg verschont. Sie konnte friedliche Beziehungen zu allen Kriegsparteien unterhalten und Handel treiben, solange keine Seite benachteiligt wurde. Sie durfte Flüchtlinge und Deserteure aufnehmen, war aber nicht dazu verpflichtet.
Wie war die Haltung der Regierung und die öffentliche Meinung der Schweiz von 1933 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges?
Anfangs wurde die Regierung Hitlers als eine von vielen Regierungen der Weimarer Republik angesehen. Es gab Furcht vor dem deutschen Nachbarn aufgrund seiner militärischen Stärke, aber die Machtergreifung Hitlers wurde von den Schweizern weitgehend ignoriert. Es gab keinen weitverbreiteten Zusammenschluss von Konservativen mit Frontisten wie in Deutschland. Die Schweizer standen dem Nationalsozialismus eher ablehnend gegenüber, teilten aber dessen Antisemitismus in geistiger Hinsicht.
Wie war die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen vor Kriegsausbruch in der Schweiz geregelt?
Heinrich Rothmund, Chef der schweizerischen Polizei, war maßgeblich an der Entscheidung über die Aufnahme von Flüchtlingen beteiligt. Auf sein Betreiben hin wurde der "Judenstempel" in Pässen eingeführt, um die Einreise von Juden zu kontrollieren. Die Regierung war bemüht, die Ein- und Ausreise in die Schweiz und nach Deutschland zu kontrollieren.
Wie war die Haltung der Regierung und die öffentliche Meinung während des Zweiten Weltkrieges?
Die Regierung mobilisierte das Militär, um die Grenzen zu sichern. Die Schweiz blieb neutral und versuchte, ein Gleichgewicht zwischen den Kriegsparteien zu wahren. Es gab deutsche Protestnoten wegen angeblicher Verletzungen der Neutralität, und die Presse wurde kontrolliert. Die "Aktion Trump" zielte darauf ab, kritische Journalisten aus den Redaktionen zu entfernen, stärkte aber letztendlich die gemeinsame Linie von Verlegern und Journalisten.
Wie wurde die Flüchtlingsfrage während des Krieges behandelt?
Die Schweiz nahm während des Krieges 295.381 Flüchtlinge auf, von denen die meisten nur vorübergehend blieben. Es gab jedoch auch viele Abweisungen, deren genaue Anzahl unklar ist. Der "Judenstempel" wurde eingeführt, und der Status politischer Flüchtlinge wurde Juden aberkannt. Die Schließung der Grenzen im August 1942 führte zu öffentlicher Kritik und einer Lockerung der Maßnahmen. Hilfsorganisationen und jüdische Gemeinden trugen einen Großteil der Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge.
Wie sahen die Wirtschaftsbeziehungen der schweizerischen Industrie mit dem Dritten Reich aus?
Nach dem Fall Frankreichs wurde die Schweiz wirtschaftlich in das Dritte Reich eingebunden. Der Handel mit kriegswichtigen Materialien nahm stark zu. Ein Großteil der schweizerischen Industrie arbeitete für das Dritte Reich. Die Zahlungen erfolgten in Naturalien und durch Kredite der eidgenössischen Regierung.
Wie waren die Goldtransaktionen der deutschen Reichsbank mit der Schweizerischen Nationalbank geregelt?
Die Clearingkredite der Schweiz an Deutschland wurden durch Goldlieferungen der deutschen Reichsbank an die Schweizerische Nationalbank (SNB) gedeckt. Ein Teil des Goldes war Raubgold, das von den Nationalbanken besetzter Länder stammte. Die Schweiz fungierte als Drehscheibe für den Goldhandel und versorgte Deutschland mit Devisen.
Welche Bedeutung hatte der neutrale Staat Schweiz während des Krieges?
Die Schweiz übernahm Schutzmachtstellungen für viele Staaten und betreute Kriegsgefangene. Das Rote Kreuz von Genf aus war aktiv. Die Schweiz diente als Drehscheibe für Informationen und Agenten.
Was ist das Resümee: Das Verhalten der Schweiz gegenüber dem Nationalsozialismus?
Die Schweiz unterstützte die nationalsozialistische Kriegsmaschinerie mit etwa 3 Milliarden sFr. Ein Teil des Goldes stammte aus Raub. Nur 21.000 Juden wurden aufgenommen und nach Schliessung der Grenzen gab es viele Abweisungen von Flüchtlingen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges wird gefordert.
- Quote paper
- Max Wiedl (Author), 1999, Die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg- der neutrale Fels in der totalitären Brandung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95049