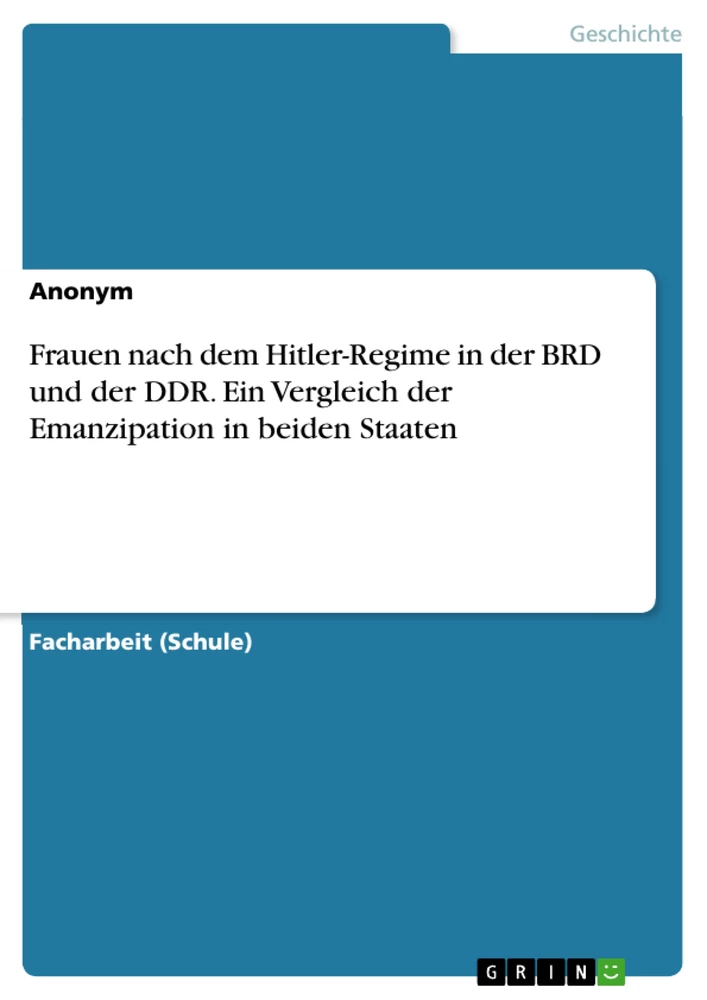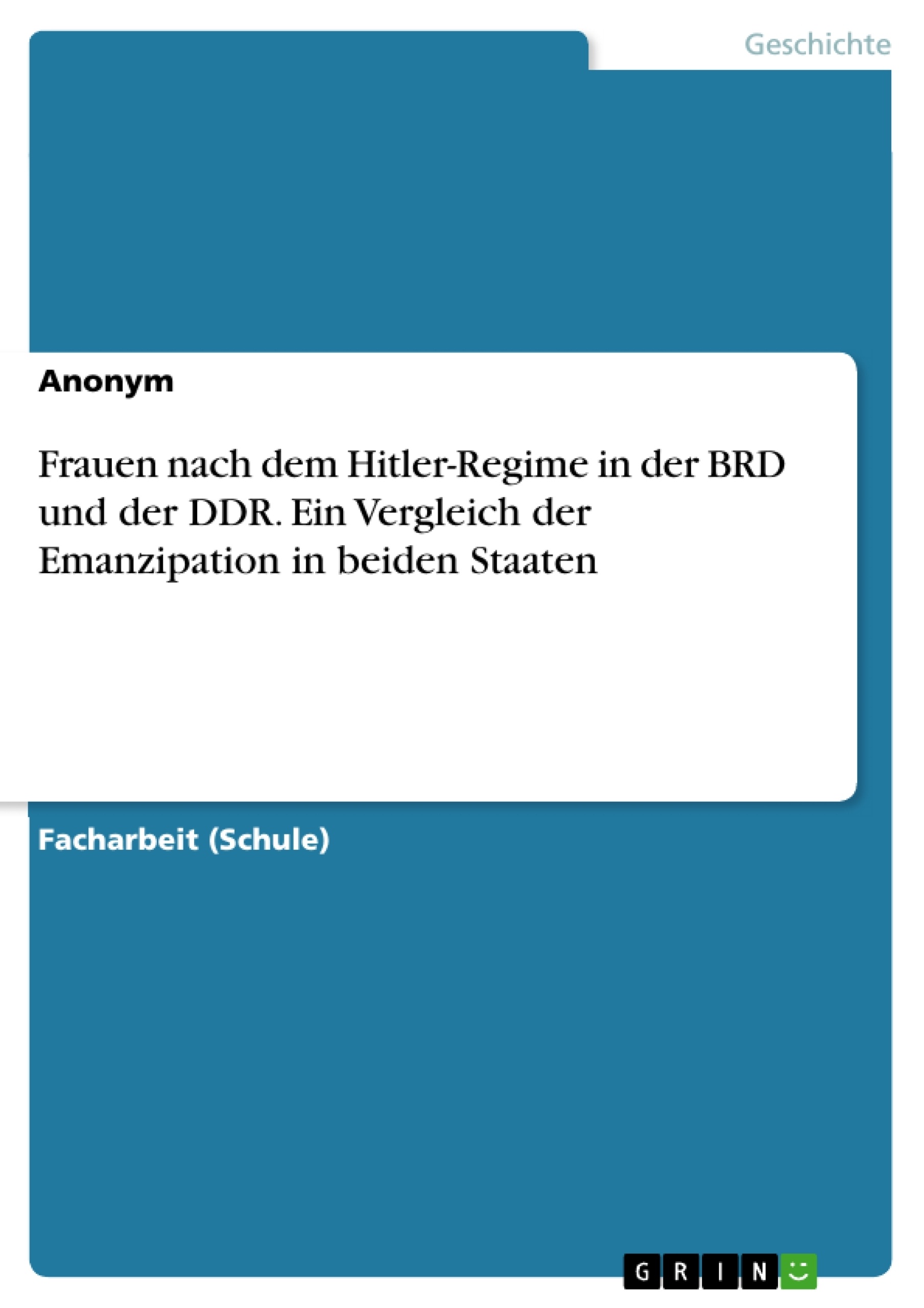Diese Arbeit untersucht die Frage, ob sich etwas nach dem Hitler-Regime in beiden deutschen Staaten, die sich jeweils die Gleichberechtigung von Mann und Frau ins Grundgesetz bzw. in die Verfassung geschrieben hatten, verändert hat, oder ob alte Geschlechterrollen aus der NS-Zeit schlicht konserviert und in eine neue staatliche Ordnung hinübergerettet wurden.
Nun soll hier untersucht werden, inwieweit sich das Frauenbild, aber auch die Stellung von Frauen in Gesellschaft und Politik im Vergleich zur Periode des Nationalsozialismus gewandelt haben. Hatte jede Frau als einziges „die Pflicht, heiter und anmutig zu sein“, wie der renommierteste Eheberater der jungen Bundesrepublik, Walter von Hollander, in seiner Zeitschrift schrieb? Oder war es ihr mittlerweile gelungen, veraltete Wertvorstellungen zu durchbrechen und so einen weiteren Schritt Richtung Emanzipation zu machen?
Nicht zuletzt muss bei der Untersuchung dieser Fragen berücksichtigt werden, inwieweit die frauenpolitischen Realität in beiden deutschen Staaten divergierten, um sich ein vollständiges Bild davon machen zu können, wie die verschiedenen Systeme mit dem gesellschaftlichen Erbe des Nationalsozialismus umgingen. Hierzu wird der Zeitraum von 30-40 Jahren nach Kriegsende berücksichtigt werden.
Der Kollaps des dritten Reiches war in vielerlei Hinsicht der Beginn einer neuen Ära. Die Besatzung durch die Siegermächte machten eine völlige Neuorientierung in Politik, Ökonomie und Gesellschaft möglich. Frauen waren zum damaligen Zeitpunkt in ein neues Spannungsverhältnis geraten: Zunächst noch durch die Propaganda zu „Gebärmaschinen“ umfunktioniert, übernahmen sie nach Kriegsende die Rolle des Ernährers der Familie, da die Männer unabkömmlich waren. Dieses „Matriarchat“ wurde aber in Frage gestellt, als die Ehemänner zurückkamen und die Wiederherstellung des patriarchalischen Familienmodells auf Basis der absoluten Gehorsamkeit der Frau gegenüber dem Mann zurückforderten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gleichberechtigung im Sozialismus
- Der Anfang der DDR-Frauenpolitik
- Frauen in der Theorie des Sozialismus
- ,,Staatliche“ Emanzipation
- Bevölkerungspolitik in den 70ern
- Das Revidieren des Vereinbarkeitskonzeptes
- Frauen in der jungen Bundesrepublik
- Die arbeitende Frau im Widerspruch zum konservativen Gesellschaftsbild
- Die Währungsreform und ihre Konsequenzen für Arbeitnehmerinnen
- Gleichberechtigung durch Gewerkschaften?
- ,,Familienpolitik“ und Frauenbild in der Adenauer-Ära
- Die katholische Kirche und Kritik an Frauenerwerbsarbeit
- Ein Ministerium als Abwehrinstanz gegen Emanzipation
- Frauenbewegung im Zeichen der 68er-Proteste
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit befasst sich mit der Situation von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie untersucht die Veränderungen des Frauenbildes und der Stellung von Frauen in Gesellschaft und Politik im Vergleich zur NS-Zeit. Dabei wird besonders auf die Frauenpolitik in beiden deutschen Staaten eingegangen und analysiert, wie die jeweiligen Systeme mit dem gesellschaftlichen Erbe des Nationalsozialismus umgegangen sind.
- Vergleich der Emanzipation in beiden deutschen Staaten
- Wandel des Frauenbildes in der Nachkriegszeit
- Frauenpolitik in der DDR und der Bundesrepublik
- Die Rolle von Frauen in Gesellschaft und Politik
- Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Situation von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Herausforderungen, denen sich Frauen in der Nachkriegszeit stellen mussten. Sie stellt die Frage, ob sich das Frauenbild und die Stellung von Frauen in Gesellschaft und Politik im Vergleich zum Nationalsozialismus verändert haben und wie die Frauenpolitik in beiden deutschen Staaten divergierte.
Das zweite Kapitel analysiert die Frauenpolitik in der DDR und zeigt, dass die SED-Führung die Eingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt aus ökonomischen und ideologischen Gründen anstrebte. Die „Frauenfrage“ wurde jedoch als Teil der sozialen Frage des Klassenkampfes betrachtet. Trotz der hohen Frauenerwerbstätigenquote blieb der Einfluss von Frauen auf der politischen Ebene begrenzt.
Im dritten Kapitel wird die Frauenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland untersucht. Die arbeitende Frau stand im Widerspruch zum konservativen Gesellschaftsbild. Die Familienpolitik in der Adenauer-Ära zielte darauf ab, die traditionelle Familienstruktur zu bewahren und Frauenerwerbsarbeit einzuschränken. Die Frauenbewegung im Zeichen der 68er-Proteste forderte jedoch eine Veränderung der traditionellen Geschlechterrollen.
Schlüsselwörter
Frauenpolitik, Emanzipation, Gleichberechtigung, Frauenbild, Nachkriegszeit, DDR, Bundesrepublik, Nationalsozialismus, Sozialismus, Familienpolitik, Frauenbewegung, 68er-Proteste.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Frauen nach dem Hitler-Regime in der BRD und der DDR. Ein Vergleich der Emanzipation in beiden Staaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950128