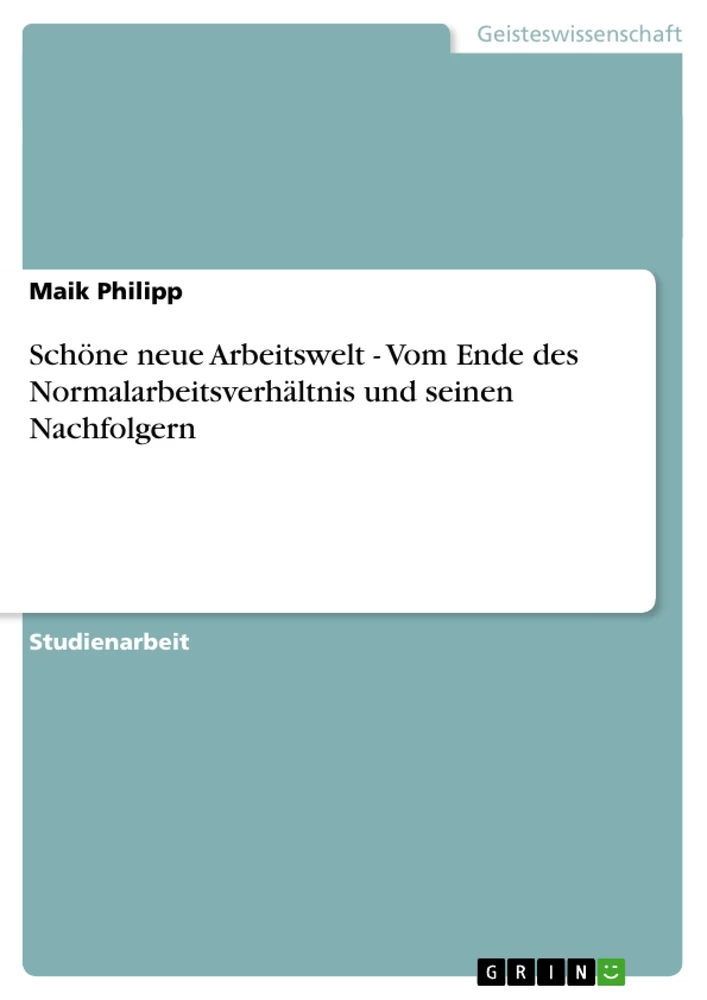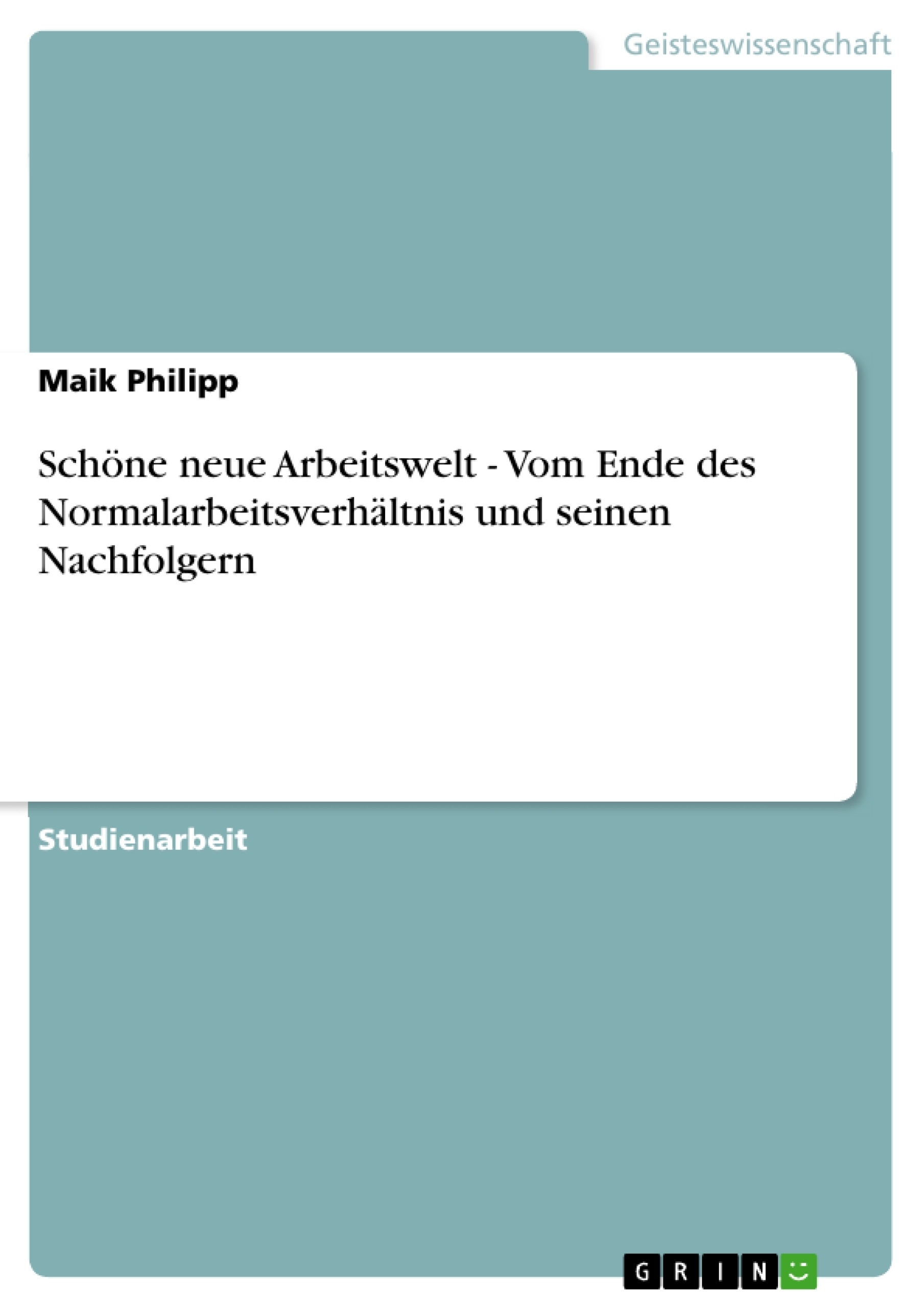Im Juli 1998 wurde der Verfasser von der Parchimer Lokalredaktion der „Schweriner Volkszeitung“ mit der Wiederbelebung der Reportageserie „Nachts, wenn Parchim schläft“ beauftragt. Portraits von Menschen, die nachts arbeiten, sollten entstehen und Einblick gewähren in eine Arbeitssphäre, die den Lesern bislang verborgen geblieben war. Der Verfasser schrieb sechs Artikel über Menschen, „die ihren Tagesablauf aus beruflichen Gründen auf den Kopf gestellt haben.“1 Eine Angestellte einer Tankstelle,2 zwei Nachtportiers eines Hotels, 3 ein Gastwirt,4 ein Fernfahrer,5 eine Krankenschwester6 und eine McDonald’s-Angestellte7 waren Gegenstand der Betrachtung. Alle vorgestellten Personen zeichneten sich – neben der Nachtarbeit – durch eine Kongruenz aus: Sie arbeiteten alle im Dienstleistungssektor.
Nachtarbeit hatte zu jener Zeit in der ostdeutschen Kleinstadt den Charakter, außergewöhnlich oder bizarr zu sein. Daran dürfte sich bis heute einiges geändert haben.
Modifikationen haben sich gleichfalls in anderen Bereichen der Arbeit ergeben. Die Bedeutung des Normalarbeitsverhältnis’ „in der Form unbefristeter Voll-Erwerbsarbeit im erlernten Beruf“8 sinkt; andere „atypische“ Formen der Erwerbsarbeit sind entstanden und gewinnen an Boden. Mit diesen Tendenzen will sich diese Hausarbeit beschäftigen. Zwei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt. Erstens: Wieso verschwindet der sichere 7,5 Stunden-Arbeitstag? Zweitens: Welche Alternativen treten an seine Stelle?
Zunächst wird herausgestellt, weshalb das Phänomen Arbeit eine zentrale Position im Leben des Einzelnen einnehmen konnte. Basis ist hierbei das traditionelle Normalarbeitsverhältnis. Anhand jüngerer Entwicklungen, allen voran Technisierung und Globalisierung, stellt der Verfasser dann die Veränderungen der Arbeitswelt dar. Es folgt eine Darstellung und kritische Diskussion der neuen Arbeitsformen Telearbeit, Freelancing und Zeitarbeit. Die zukünftigen Anforderungen an Arbeitnehmer werden im Anschluss behandelt. Im Fazit werden Kerngedanken gebündelt, die Entwicklungen gewertet und prospektive Tendenzen aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Laboro ergo sum
- Das Phänomen Arbeit - von der Plage zum Ideal
- Die Abkehr vom 33-Tag
- Substitution per Innovation: die Auswirkungen des technischen Fortschritts
- Die Effekte des „global playing“
- Innovation und Globalisierung - ein Danaergeschenk?
- Schöne neue Arbeitswelt? Die Alternativen zum Normalarbeitsverhältnis.
- Die Rückkehr der Arbeit ins eigene Heim: Telearbeit
- Jeder sein eigener Unternehmer: Freelancing
- Der Tätige als Leihware: Zeitarbeit
- Die Reise in die Zukunft - wer den Anforderungen genügt, darf partizipieren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Veränderungen der Arbeitswelt im Kontext des schwindenden Normalarbeitsverhältnisses. Sie beleuchtet die Ursachen für diesen Wandel, die sich in der fortschreitenden Technisierung und Globalisierung manifestieren, und diskutiert die sich daraus ergebenden alternativen Arbeitsformen. Die Arbeit möchte die Frage nach dem Verschwinden des 7,5 Stunden-Arbeitstages sowie die sich abzeichnenden Entwicklungen in der Arbeitswelt beantworten.
- Entwicklung und Bedeutung des Normalarbeitsverhältnisses
- Einfluss von Technisierung und Globalisierung auf die Arbeitswelt
- Analyse und Diskussion der neuen Arbeitsformen Telearbeit, Freelancing und Zeitarbeit
- Zukünftige Anforderungen an Arbeitnehmer
- Prospective Tendenzen in der Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prolog führt den Leser in die Thematik ein, indem er die Entwicklung der Arbeitssphäre in einer ostdeutschen Kleinstadt in den späten 1990er Jahren schildert und gleichzeitig den Fokus auf die Veränderungen im Arbeitsmarkt richtet. Im ersten Kapitel „Laboro ergo sum“ wird der Begriff Arbeit definiert und seine Bedeutung im menschlichen Leben beleuchtet. Es wird argumentiert, dass Arbeit eine zentrale Rolle in der Gesellschaft und im Leben des Einzelnen spielt, indem sie Identität, Selbstwertgefühl, soziale Strukturen und finanzielle Sicherheit schafft. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Einfluss von Technisierung und Globalisierung auf die Arbeitswelt. Der Verfasser untersucht, wie sich die „Substitution per Innovation“ durch technischen Fortschritt, die Auswirkungen des „global playing“ und die kombinierte Kraft von Innovation und Globalisierung auf das Normalarbeitsverhältnis auswirken.
Schlüsselwörter
Normalarbeitsverhältnis, Technisierung, Globalisierung, Telearbeit, Freelancing, Zeitarbeit, Arbeitsmarkt, Arbeitswelt, Arbeitnehmer, zukünftige Anforderungen, Entwicklungen
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „Normalarbeitsverhältnis“?
Es bezeichnet eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung im erlernten Beruf, die lange Zeit als Standard in der Arbeitswelt galt.
Warum verschwindet der klassische 7,5-Stunden-Arbeitstag?
Hauptursachen sind die fortschreitende Technisierung, die Globalisierung und der damit verbundene Strukturwandel hin zu flexibleren Arbeitsformen.
Welche Alternativen zum Normalarbeitsverhältnis gibt es?
Zu den sogenannten „atypischen“ Arbeitsformen zählen Telearbeit, Freelancing (Freiberuflichkeit) und Zeitarbeit.
Was bedeutet „Substitution per Innovation“?
Dieser Begriff beschreibt die Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch technologische Neuerungen und Automatisierung.
Welche Anforderungen stellt die Zukunft an Arbeitnehmer?
Arbeitnehmer müssen zunehmend flexibel sein, sich ständig weiterbilden und bereit sein, sich an neue, oft weniger sichere Arbeitsstrukturen anzupassen.
- Quote paper
- Maik Philipp (Author), 2002, Schöne neue Arbeitswelt - Vom Ende des Normalarbeitsverhältnis und seinen Nachfolgern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9496