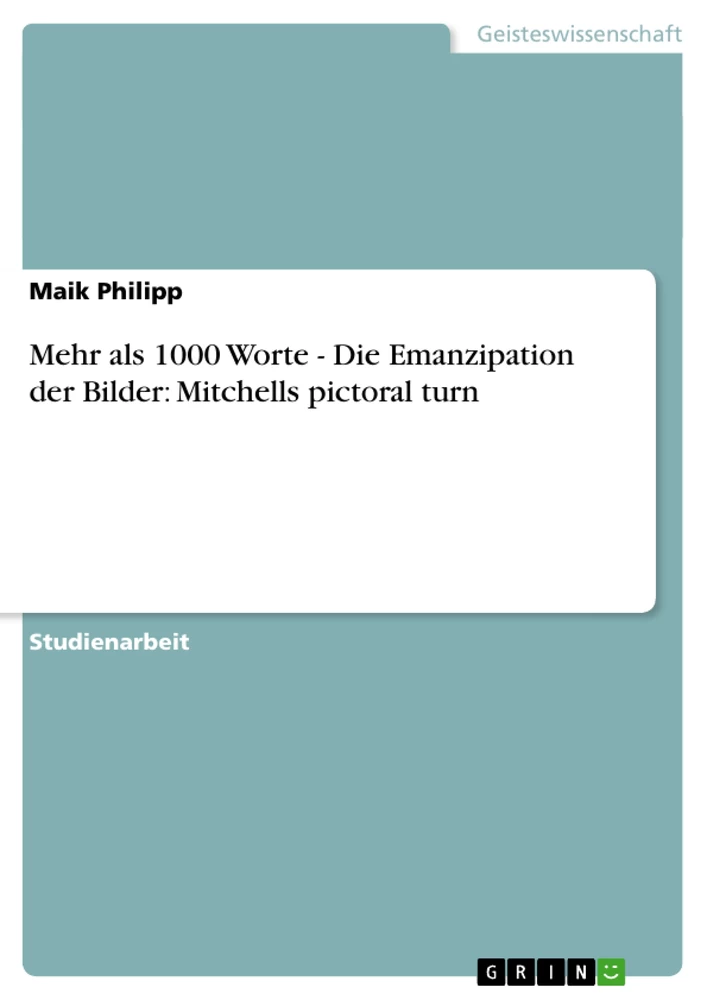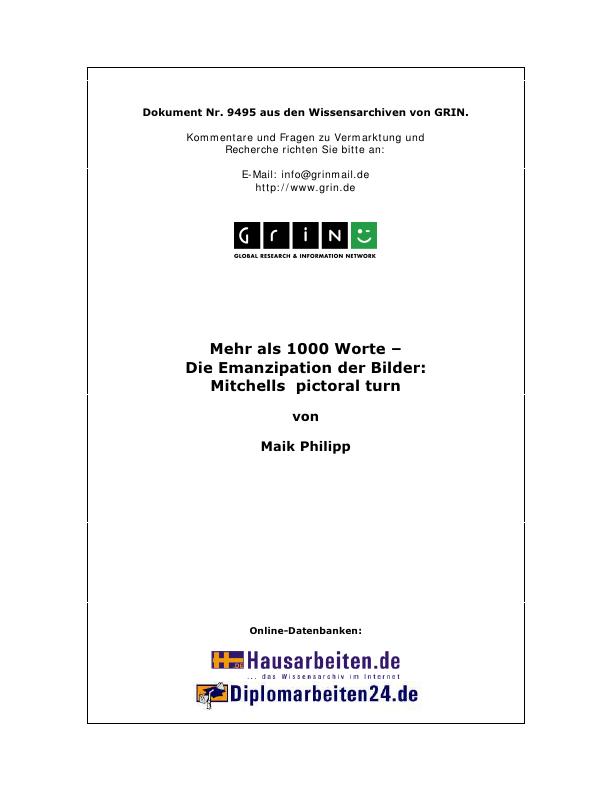Einleitung
Die Kultur des ausgehenden 20. und des beginnenden 21. Jahrhunderts wird als "visuelle Kultur" bezeichnet: "Wir leben in einem visuellen Zeitalter, einem Zeitalter der Bilder."1 In einer Spirale wachsen die Bilderflut auf der einen Seite und die Bedürfnisse der Rezipienten nach mehr Visuellem. Diese "Wendung zum Bild […] findet kontinuierlich und mit großem Tempo statt."2 Das Phänomen, das die visuelle Kultur forciert, wird als "pictorial turn"3 bezeichnet, ein Ausdruck, den der Literaturwissenschaftler William John T. Mitchell im Jahr 1997 aufs Tableau brachte.
Bilder in ihrer Eigenschaft, optisch und zweidimensional Inhalte zu (re)präsentieren, haben zu einer "utopistischen Spekulationswut über die erlösende und umwälzende Macht der Bilder"4 im weltweiten wissenschaftlichen und interdisziplinären Diskurs geführt. "Stichworte wie ‚Simulation′, ‚Immaterialität′, ‚Sehen ohne Blick′, ‚Universum der technischen Bilder′, ‚Unsichtbarkeit der Welt′, ‚Hypersichtbarkeit′ agitieren die Debattierenden."5
So ausführlich der Dialog ist, so skurril erscheint er angesichts Mitchells Aussage, dass wir heute
"[…] immer noch nicht genau wissen, was Bilder sind, in welchem Verhältnis sie zur Sprache stehen, wie sie sich auf Beobachter und die Welt auswirken, wie ihre Geschichte zu verstehen ist und was mit ihnen bzw. gegen sie gemacht werden kann."6
Dem Phänomen des "pictorial turn" und einer kritischen Beurteilung will sich diese Hausarbeit widmen. Zunächst wird Mitchells Theorie des "pictorial turn" dargelegt. Daran knüpfend werden Sprache und Bild als Koexistenten, Komplementäre und Rivalen dargelegt. Es folgt eine Diskussion der Frage, ob das Bild die Sprache ersetzen kann, und die kurze Illustration bislang vorgenommener Versuche. Im Anschluss werden ältere und aktuelle Fälle der Machtschöpfung durch Bilder, vornehmlich durch Fotografien, vorgestellt. Das Fazit bündelt Kerngedanken und fasst den Inhalt der vorangegangenen Kapitel zusammen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mitchells „pictorial turn“ – Theorie und immanente Probleme
- Die bislang friedliche Koexistenz von Sprache und Bild
- Mehr als tausend Worte? Sprache und Bild als Komplemente und Kontrahenten
- Ist die Substitution der Sprache durch Bilder möglich?
- Die Triade Bilder, Macht und Manipulation
- Ein Exempel lügender Bilder: Stalins Bilderregime
- Die Kontinuität der Bildmanipulationen in den Medien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem „pictorial turn“, einem Wandel von der Textualität hin zum Bild, wie er von William John T. Mitchell beschrieben wird. Ziel ist es, Mitchells Theorie zu erläutern und kritisch zu betrachten, die Koexistenz, Komplementarität und Rivalität von Sprache und Bild zu untersuchen und die Frage nach der möglichen Substitution von Sprache durch Bilder zu diskutieren. Darüber hinaus werden Beispiele für die Machtausübung durch Bilder, insbesondere Fotografien, analysiert.
- Mitchells Theorie des „pictorial turn“ und deren immanente Probleme
- Das Verhältnis von Sprache und Bild als komplementäre und konkurrierende Systeme
- Die Möglichkeit der Substitution von Sprache durch Bilder
- Die Rolle von Bildern in der Machtausübung und Manipulation
- Analyse von Beispielen aus der Geschichte der Bildmanipulation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der „visuellen Kultur“ ein und beschreibt den „pictorial turn“ als einen bedeutenden Wandel hin zu einer bildorientierten Gesellschaft. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Wesen von Bildern und ihrem Verhältnis zur Sprache und kündigt den Aufbau der Arbeit an, der Mitchells Theorie erläutert und kritisch hinterfragt, die Interaktion von Sprache und Bild analysiert und die Macht von Bildern in der Manipulation beleuchtet.
Mitchells „pictorial turn“ – Theorie und immanente Probleme: Dieses Kapitel erläutert Mitchells Theorie des „pictorial turn“ als eine Abkehr vom „linguistic turn“ und setzt diese im Kontext der Philosophiegeschichte. Es wird die „Angst der Sprachphilosophie vor visueller Repräsentation“ diskutiert und der Einfluss des technischen Fortschritts auf die Emanzipation der Bilder hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet auch kritische Auseinandersetzungen mit Mitchells Theorie und stellt die Frage nach der eindeutigen Definition und Einordnung des „pictorial turn“ in den Fokus.
Die bislang friedliche Koexistenz von Sprache und Bild: (Annahme: Dieses Kapitel existiert im Originaltext, aber der Text wurde nicht vollständig zur Verfügung gestellt. Die Zusammenfassung würde hier den Inhalt dieses Kapitels beschreiben, welches die historische und kulturelle Koexistenz von Sprache und Bild beleuchtet und deren jeweilige Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Darstellung von Informationen erörtert.)
Mehr als tausend Worte? Sprache und Bild als Komplemente und Kontrahenten: (Annahme: Dieses Kapitel existiert im Originaltext, aber der Text wurde nicht vollständig zur Verfügung gestellt. Die Zusammenfassung würde hier den Inhalt dieses Kapitels beschreiben, welches die komplementären und konkurrierenden Aspekte von Sprache und Bild im Kontext der Informationsvermittlung analysiert. Es würde die jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen beider Systeme im Hinblick auf die Übermittlung von Botschaften beleuchten und deren Interaktion detailliert untersuchen.)
Ist die Substitution der Sprache durch Bilder möglich?: (Annahme: Dieses Kapitel existiert im Originaltext, aber der Text wurde nicht vollständig zur Verfügung gestellt. Die Zusammenfassung würde hier den Inhalt dieses Kapitels beschreiben, welches die Frage nach der vollständigen Ersetzbarkeit von Sprache durch Bilder diskutiert. Es würde verschiedene Ansätze und Theorien zu diesem Thema beleuchten und die Vor- und Nachteile einer solchen Substitution kritisch bewerten.)
Die Triade Bilder, Macht und Manipulation: Dieses Kapitel untersucht die enge Verbindung zwischen Bildern, Macht und Manipulation. Es analysiert, wie Bilder zur Herstellung und Ausübung von Macht eingesetzt werden und welche Strategien der Manipulation dabei zum Einsatz kommen. Anhand von Beispielen wie dem Stalinschen Bilderregime wird die gezielte Instrumentalisierung von Bildern zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und zur Durchsetzung politischer Ziele verdeutlicht. Die Kontinuität solcher Manipulationstechniken in modernen Medien wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Pictorial turn, visuelle Kultur, Bildwissenschaft, Sprache und Bild, Bildmanipulation, Macht, Propaganda, Medien, Mitchell, Wittgenstein, Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Der Pictorial Turn – Sprache, Bild und Macht"
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den "pictorial turn", den Wandel von einer textorientierten hin zu einer bildorientierten Gesellschaft, wie er von William John T. Mitchell beschrieben wird. Sie analysiert das Verhältnis von Sprache und Bild, deren komplementäre und konkurrierende Aspekte sowie die Rolle von Bildern in der Machtausübung und Manipulation.
Welche Theorie steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf Mitchells Theorie des "pictorial turn" und deren kritische Betrachtung. Sie diskutiert die "Angst der Sprachphilosophie vor visueller Repräsentation" und den Einfluss des technischen Fortschritts auf die Emanzipation der Bilder. Die Arbeit hinterfragt auch die eindeutige Definition und Einordnung des "pictorial turn".
Wie wird das Verhältnis von Sprache und Bild dargestellt?
Die Hausarbeit analysiert Sprache und Bild als komplementäre und konkurrierende Systeme. Sie untersucht ihre Koexistenz, Komplementarität und Rivalität in der Informationsvermittlung und diskutiert die Frage nach der möglichen vollständigen Substitution von Sprache durch Bilder. Dabei werden die jeweiligen Stärken und Schwächen beider Systeme im Hinblick auf die Darstellung von Informationen beleuchtet.
Welche Rolle spielen Macht und Manipulation im Kontext von Bildern?
Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit ist die Untersuchung der engen Verbindung zwischen Bildern, Macht und Manipulation. Es wird analysiert, wie Bilder zur Herstellung und Ausübung von Macht eingesetzt werden und welche Strategien der Manipulation dabei zum Einsatz kommen. Das Stalinsche Bilderregime dient als Beispiel für die gezielte Instrumentalisierung von Bildern zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und zur Durchsetzung politischer Ziele. Die Kontinuität solcher Manipulationstechniken in modernen Medien wird ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Mitchells „pictorial turn“ – Theorie und immanente Probleme, Die bislang friedliche Koexistenz von Sprache und Bild, Mehr als tausend Worte? Sprache und Bild als Komplemente und Kontrahenten, Ist die Substitution der Sprache durch Bilder möglich?, Die Triade Bilder, Macht und Manipulation (inkl. Ein Exempel lügender Bilder: Stalins Bilderregime und Die Kontinuität der Bildmanipulationen in den Medien) und Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Pictorial turn, visuelle Kultur, Bildwissenschaft, Sprache und Bild, Bildmanipulation, Macht, Propaganda, Medien, Mitchell, Wittgenstein, Repräsentation.
Welche Forschungsfrage(n) werden in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist das Wesen von Bildern und ihr Verhältnis zur Sprache. Weitere Fragen betreffen die kritische Auseinandersetzung mit Mitchells Theorie, die Analyse der Interaktion von Sprache und Bild sowie die Untersuchung der Macht von Bildern in der Manipulation.
- Quote paper
- Maik Philipp (Author), 2002, Mehr als 1000 Worte - Die Emanzipation der Bilder: Mitchells pictoral turn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9495