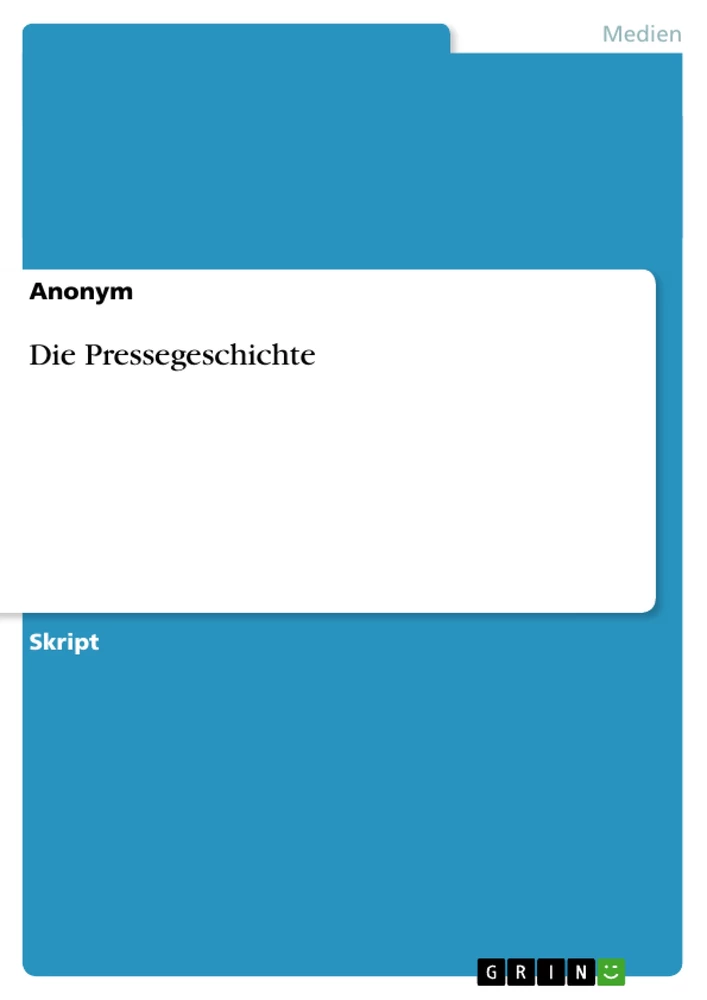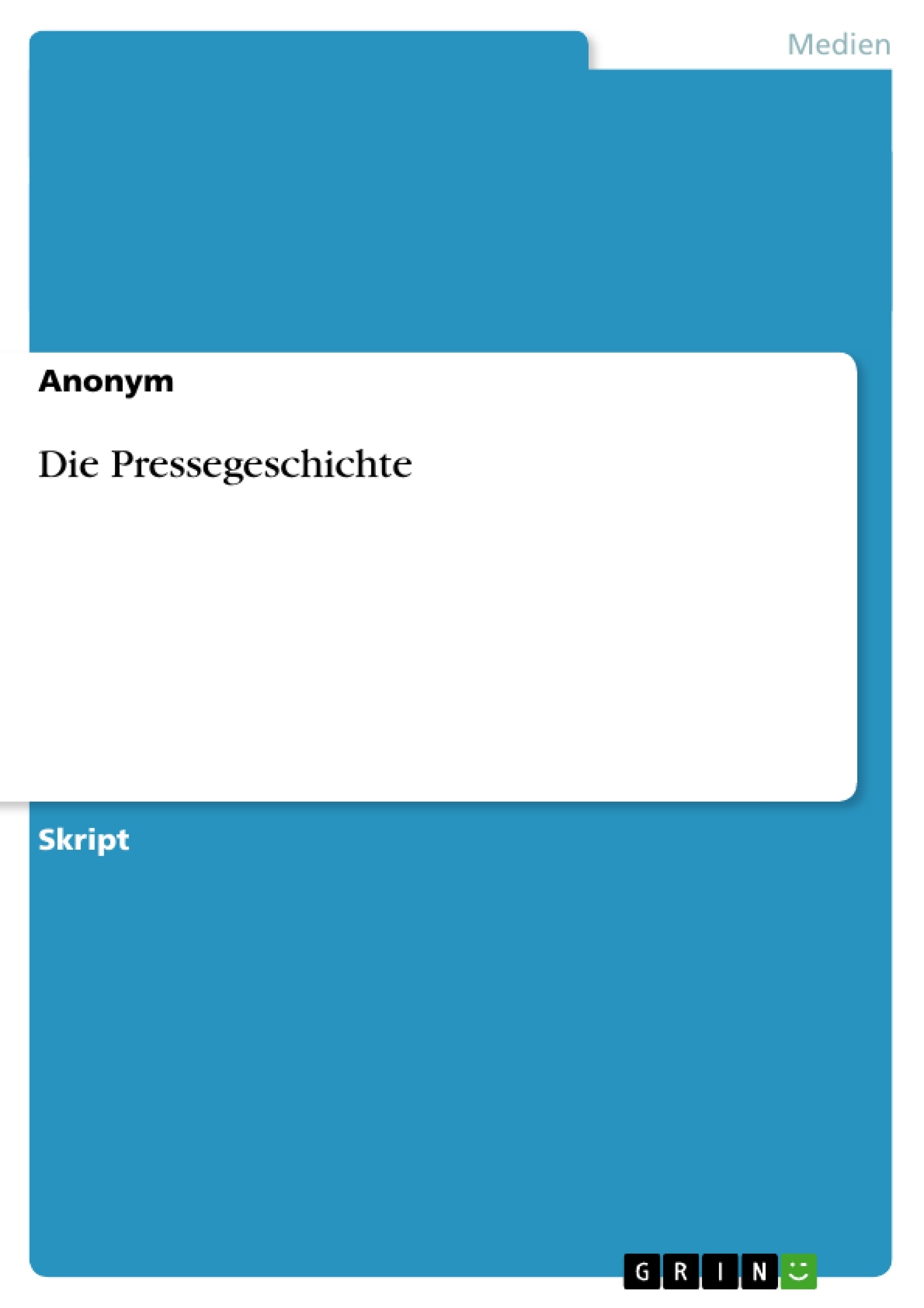Pressegeschichte
- Presse ist das älteste publizistische Massenmedium
- Ihre Geschichte bildet den wesentlichen Teil der Mediengeschichte
- Vier Merkmale kennzeichnen die Zeitung:
- Publizität, alsoöffentlichkeit, allgemeine Zugänglichkeit
- Aktualität, auf die Gegenwart bezogen, die gegenwärtige Existenz betreffend, sie beeinflussend, neu, gegenwärtig wichtig
- Universalität, kein Thema ist ausgenommen
- Periodizität, in regelmäßigen Abständen wiederkehrend, fortlaufende Erscheinungsweise
- Bei allen vier Kriterien wird immer das Höchstmaß angestrebt
- Dovifat: "Die Zeitung vermittelt jüngstes Gegenwartsgeschehen in kürzester regelmäßiger Folge der breitestenöffentlichkeit"
Vorläufer der Zeitung
- Gesprochene oder gesungene Kommunikation;öffentliche Aussagen, wie Gesetzestexte, Lieder, religiöse und politische Rhetorik ⇒ Publizität; z.B. Walther von der Vogelweide referieren und räsonnieren zugleich
- "acta urbis" in Rom anöffentlichen Plätzen: Chronik der Tagesereignisse: Aktualität und Universalität in geringem Maße
- Privatbrief: geschichtlicher Kern der Zeitung
- Seit 14. Jahrhundert: "zidunge", steht für Botschaft, Nachricht, aus dem mitteldeutschen, noch bis ins 19. Jh. So verwendet
- Fürsten, Kirchen, Unis und Handel: im ausgehenden Mittelalter ein zunehmender Briefverkehr, Korrespondenten: Brief zweigeteilt: an Private Mitteilungen wurden Nachrichten angehängt
- Kaufmannsbriefe (ab 1380), wie z.B. Fugger-Zeitungen: nicht für dieöffentlichkeit bestimmt, interne Zusammenstellung von Nachrichten die im liefen Büro des Augsburger Handelshauses einliefen ⇒ Wurzeln der schriftlichen Kommunikation
- Geschriebene Zeitungen erreichen ihre Hochblüte in der ersten Hälfte des 16. Jh. als es schon gedruckte Nachrichtenblätter gibt: sie konnten sich besser der Zensur entziehen, als gedruckte; sie sind exklusiv, schneller und vertraulicher
- Johann Gutenberg (1400-1468) erfindet die Druckerpresse (1440 in Mainz); Tontafeln und Ton-Rollzylinder gab es schon in Babylon (2000 vor Chr.) Druckstempel schon bei den Römern. Gutenberg: bewegliche Letter, aus denen der Druckstock zusammengesetzt wurde. Mithilfe eines Gießgeräts konnten Buchstaben und Zeichen aus Metall hergestellt werden. Das Gerät wurde Jahrhunderte lang ohne Veränderung benutzt, ebenso die Druckerpresse.
- Publizität: Ende des 15. / Anf. des 17. Jh. verschiedene nicht-periodische Druckgattungen: Einblattdrucke, Neue Zeitungen (großformatig, ein- oder mehrseitig, aktuelle Ereignisse, Berichte), Flugblatt (Meinungsbildung, Polemik, Aufruf, Stellungnahme, Warnung), Flugschriften (mehrseitig, propagandistisch, agitatorisch ⇒ Luthers Flugschriften (über 3000)) Hier schon medienspezifische Trennung von Nachricht und Meinung.
- Flugblätter und "Neue Zeitungen": Illustrationen (Holzschnitt, Kupferstich),Aktualität, schlagzeilenartige Überschriften, Vertrieb auf Marktplätzen, Vorläufer der Sensationspresse (erst wieder im 19. Jh.). Neue Zeitungen bis 1700, Anzahl: 5000- 8000.
- Periodizität fehlt jedoch noch: als erste besitzen dies die "Meßrelationen" halbjährlich zu Frühjahrs- und Herbstmessen herausgegebene Chroniken. 1.: Relatio historica 1583, Michael von Aitzing, in Köln), dann 1591 Frankfurter Meßrelationen, 1601 in Magdeburg, 1605 in Leipzig, jedoch: keine Aktualität: eher chronologische Geschichtsschreibung. 1597 monatliche Rorschache Monatsschrift (1597).
Erste Zeitungen
- Charakteristika mit Langzeitwirkungen der frühen deutschen Zeitungsgeschichte: 1.) territoriale Zersplitterung, 2.) Kommunikationskontrolle 3.) Medienkomplementarität
- 1. 962: Das durch Otto den Großen gegründete Römische Reich Deutscher Nation umfaßte nach seiner Neuordnung im Westfälischen Frieden 1648 noch immer 1789 Glieder (unter der formaljuristischen Hoheit des Kaisers in Wien
- 2. Zeitalter der Entdeckungen, Frühkapitalismus, Religionskriege ⇒ Informationsbedarf Verbreitung geschriebener "Zeitungen", u.ä. (Einblattdrucke oder die "Newen Zeitungen", mehrseitig).
- 3. Eindämmung der kirchenkritischen Publizistik ⇒ Universität Mainz führte um ca.1475 die Endzensur ein, ab 1487 wurde diese durch den Papst auf die gesamte Kirche ausgedehnt; ab 1521 durch ein kaiserliches Edikt Präventivzensur für alle in den Druck gehenden Schriften. Territoriale Zersplitterung: "landesherrliche Obrigkeiten" richteten eigene Institutionen zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit ein
- Zwei Zeitungsjahrgänge 1609: Aviso aus Wolfenbüttel und die Straßburger "Relation": Deutschland ist das Ursprungsland der Zeitung ⇒ periodische Wochenzeitungen; Relation bereits seit 1605. In den Niederlanden erst 1618, England 1621, Frankreich1631, USA 1690 Zeitungen. 1620 zweimal wöchentlich das Frankfurter "Diarium Hebdomadale; 1650 in Leipzig die erste Tageszeitung der Welt: "Einkommende Zeitungen": jedoch Ausnahme. Im 17 Jh. in Deutschland mehr Zeitungen als im gesamten Europa zusammen (wg. Territorialer Zersplitterung, Lage am Schnittpunkt mehrerer Postlinien). Ende des 17. Jh.: 70 Zeitungen.
- Positiv für Zeitungsentwicklung: Eine zunehmende Zahl von Personen macht sich das Sammeln und Austauschen von Nachrichten zum Beruf, Organisation eines regelmäßigen Boten- und Postdienstes ⇒ Ausbau des Transportwesens, Entstehen gesellschaftlicher Gruppen (Nachrichtenbegierig), Gewinnstreben der Drucker, Nachrichtenbedürfnis des Handels, Aufstieg zahlreicher Handels- und Messestädte.
- Wie beim Aufkommen jedes neuen Massenmediums: kulturkritische Alarmstimmung bei geistlichen und Gelehrten im 17 Jh.: gegen "Zeitungssucht", "eitles unnötiges, unzeitiges und daher arbeitsstörendes, mit unersättlicher Begierde getriebenes Zeitunglesen". Andere: positives Mittel zum Wissenserwerb.
- Durchschnittliche Auflage der frühen deutschen Tagespresse: 350 bis 400 Exemplare.Einzelne Blätter höhere Auflagen (Frankfurter Journal 1680: 1500 Exemplare). Ende des 17. Jh. wurden schon ca. 200.000 Personen erreicht
- Universalität war anfangs nur sehr schwach ausgeprägt, v.a. politisch-militärische Berichterstattung, Diversifizierung erst im 19. Jh., dann auch Spartengliederung: Kulturteil schon um 1830 beim "Hamburger Unpartheyischen Correspondenten"; Feuilleton: 1800 (Abbé de Geoffroy); Handels- und Wirtschaftsteil im Laufe und Sportteil Ende des 19. Jh..
- In der Frühzeit der Zeitung keine journalistische Aufmachung, sondern einfache Aneinanderreihung, Gliederung mit Überschriften erst im 19. Jh., zusammen mit Stoffvermehrung (auch phantasiebetonte Stilformen: Zeitungsroman, Kurzgeschichte)
Zensur und Privilegien
- Bis Ende 18. Jh.: Entwicklung der Presse durch staatliche und kirchliche Eingriffe bestimmt und damit wesentlich begrenzt. 1570 erste Kontrolle in Köln; 1486 in Mainz: erste Zensurkommission für das gesamte Bistum. Ein Jahr später päpstliche Zensurrichtlinien.
- Drei Phasen der Kontrolle des Druckwesens: Anfangs rein kirchliche Aufsicht, dann mehrere weltliche Instanzen, dann vor allem weltliche Zensur: Reinerhaltung des Glaubensgutes und moralische Erwägungen ⇒ innere und äußere Staatsräson. Im Laufe des 16. Jh.. Verschärfung: 1529 staatliche Vorzensur für das Reichsgebiet Speyer, 1530 Augsburg: Pflicht der Angabe des Druckers und Druckortes (Impressum), 1540 kaiserliches Verzeichnis verbotener Bücher, 1548 polizeiliche Kontrolle auch nichtgedruckter Kommunikation, 1564 päpstlicher Index verbotener Bücher, 1570 in Speyer Druckereien nur noch in Reichs- und Unistädten. Vorschriften konnten nur unzureichend durchgesetzt werden (Kaiser ⇒ Landesherren ⇒ Gewaltenteilung).
- Positive Maßnahmen staatlicher Pressepolitik: Erteilung von Konzessionen und Privilegien zur Herausgabe u. Gründung von Zeitungen, Mitarbeit als Berichterstatter um die Unterrichtung deröffentlichkeit zu beeinflussen
- Negative Maßnahmen: Vor- und Nachzensur, Impressum, Zulassungsbestimmungen zum Beruf, Entziehung und Verbot von Zeitungen, Konzessionsentzug,Themenuntersagung, Importverbot, Verkaufsverbot, Erwerbs- und Besitzverbot (Index), Berufsverbot, Kerker- und Geldstrafen, Landesverweis, Beschränkung der Erscheinungshäufigkeit, Zeitungssteuer (Stempelsteuer)- um sie teuer zu machen, Kautionszwang, Gebühren ⇒ Kontrollsystem besteht bis zur Auflösung des Reiches 1806. Kampf um die Pressefreiheit erst dann. Innenpolitische Nachrichten wurden vor allem unterdrückt. Meinungsbeiträge waren durch Zensur nicht gestattet bis ins späte 18. Jh.: journalistisches Grundprinzip: unparteiische Berichterstattung.
Anzeigenwesen und Intelligenzblatt
- Heute gibt es in der Zeitung drei Elemente: Nachricht, Meinung und Anzeige. Im 17. Und 18. Jh.: staatliche Anzeigenmonopole zur Kontrolle und Ankurbelung des heimischen Wirtschaftslebens und als Einnahmequelle ⇒ Intelligenzblätter wurden gegründet mit Zwangsabonnement für bestimmte Personenkreise, die amtliche Bekanntmachungen enthielten und bezahlte Anzeigen, die sie allein veröffentlichen oder erst nach der Veröffentlichung hier ("Recht des Erstabdrucks") in anderen eitungen erscheinen durften. Das erste Intelligenzblatt erschien in Paris 1633 (Kaufgesuche und Angebote). Diese Blätter blieben lokal/regional orientiert,politische Meldungen waren untersagt, aber es gab darin Gelehrtenartikel. Im 18. Jh. Beginn einer "staatlichenöffentlichkeitsarbeit"⇒ gezieltes Einsetzen v. Flugblättern und Zeitschriften.
- Das staatliche Anzeigenmonopol wurde in Preußen erst 1850 aufgehoben. Dadurch entstand durch zusätzliche Einnahmequellen die Massenpresse. Die Nachfolger der Intelligenzblätter sind die Anzeigenblätter
- Die ersten Anzeigen (für Bücher und Medikamente) erschienen in deutschen Zeitungen ab 1665, die ersten Intelligenzblätter 1722 in Frankfurt.
Zeitschriften
- Seit dem 17. Jh., Vorläufer: Flugschriften u. Serienzeitungen. Besitzt auch die Merkmale Publizität und Periodizität; Aktualität oder Universalität sind abgeschwächt oder gar nicht vorhanden. Sie hieß auch Journal, Magazin, Monatsschrift etc.
- Zuerst bildeten sich die sogenannten Gelehrtenzeitschriften: sollten den schwerfälligen Gelehrtenbriefwechsel ersetzen: ab 1665 das heute noch erscheinende Journal des Savants in Paris, Philosophical Transactions in London: große Aufsätze, kurze Referate, Buchrezensionen. In Deutschland durch den 30-jährigen Krieg erst ab 1682 in Leipzig: "Acta Eruditorum" in lateinisch; 1668: "Monatsgespräche" (Christian Thomasius) in Deutscher Sprache ⇒ Beginn neuer journalistischer Formen: Populärwissenschaftliche Zeitschrift, Individualzeitschrift, kritische Zeitschrift, literarische Zeitschrift
- Gelehrten-Zeitschrift (privilegirten-Zeitung): Ursprung der Fachzeitschrift Spezialisierung; Wurzel der populärwissenschaftlichen Zeitschrift; verantwortlich für die Entstehung des Meinungsjournalismus ⇒ drängt in die Gelehrten-Artikel und Zeitschriften, da das Zensoramt oft Universitätsprofessoren übertragen wurde oft zensurfreie Artikel.
- 1672 in Frankreich: "Mercure galant": Mitteilungen und Neuigkeiten aus der mondänen Welt: Publikum: Adel, städtisches Patriziat; historisch-politische Blätter, entw. trockene Dokumentensammlung aus diplomatischem Schriftverkehr oder Briefund Gesprächsform (Hofklatsch, meinungsbildendes politisches Material)⇒ Vorläufer des SPIEGEL. 1720 in Dtld. 75 politisch-historische Zeitschriften
- Im frühen 18. Jh.: Beginn der Ära der Familienzeitschriften, Frauenzeitschriften, Gesellschaftszeitschriften (aus England: "moralische Wochenschriften"): originelle Titel, fiktive Verfasserschaft, enge Leserbindung, spez. didaktische Formen. ⇒ Sollen bürgerliche Gesittung und Tugenden verbreiten; Leitbild: Patriotismus, Religiösität, Demut, Sitte und Ordnung (z.B. "der Patriot", Hamburg, 1724, Aufl. 5000). Themen: Kindererziehung, menschliche Tugenden und Laster, Verhältnis zum Mitmenschen, Kritik an der höfischen Welt. Zahlreiche Literaten der Aufklärung zugleich Verfasser moralischer Wochenschriften. 500 dt. Titel. Erste Frauenzeitschrift 1725 die "Vernünftigen Tadlerinnen von Gottsched". 1786 Vorläufer von "Schöner Wohnen" (Journal des Luxus und der Moden). Im 18 Jh.. weit verbreitet: die literarische Zeitschrift: oft kritisch, belletristisch, poetisch ⇒ Nationaljournale des späteren 18. Jh. ("Deutsches Museum"); die "Allgemeine Deutsche Bibliothek" als Hauptrezensionsanstalt der dt. Aufklärung; literarische Publizistik Lessings ⇒ Begründung der Theaterzeitschrift. Oft Kurzlebigkeit; bis 1790 ca. 4000 Titel, Auflage 500-1000 St.
- Anfänge der Medienwirkungsforschung: Ende 16. Jh., ein Jh. später verbreitet sie sich (z.B. das an heutige Texte erinnernde 500-seitige Buch "Zeitungs Lust und Nutz" von Kaspar von Stieler - 1695); in Frankreich ab 1633 jährliche kommunikationswissenschaftliche Betrachungen in der "Gazette", der ersten langlebigen franz. Zeitung. An Unis wurden Zeitungen schon im 17. Jh. als Lehrmittel eingesetzt; das erste "zeitungskundliche" Institut entstand 1916 in Leipzig (1924 München, 1928 Berlin)
Meinungsjournalismus, Kampf um Pressefreiheit
- Aufklärung, Französische Revolution, der Kampf gegen Napoleon und das Erstarken demokratischer und nationaler Ideale ⇒ politische Publizistik mit breitem Publikum (auch in den Unterschichten). Wegbereiter: Chr. F. D. Schubart (Deutsche Chronik 1774-1777), A.L. Schlözer, seine Zensurfreiheit als Göttinger Professor ausnützend (Staatsanzeigen, 1782-1795), W.L. Wekhrlin (Das graue Ungeheuer, 1784-1787), J.H. Trenck von Tonder (DerNeuwieder, Politische Gespräche im Reiche der Todten, 1786-1810). 18. Jh.: Vielzahl von Lesegesellschaften (ca. 500 in Dtld.), wg.mangelnden finanziellen Mitteln Einzelner und wachsendem Bedarf an (der Aufklärung dienender) Lesestoff (Abonnentengemeinschaften).
- Der Kampf um die Pressefreiheit begann in England ein Jahrhundert früher: Puritanische Revolution ⇒ 1644 publiziert John Milton mit der "Areopagitica" die erste große Streitschrift für die Pressefreiheit; viele Argumente, die auch später zu ihrer Verteidigung vorgebracht wurden. 1649 die Leveller Partei an das Parlament: "Wenn eine Regierung gerecht und in Übereinstimmung mit den verfassungsmäßigen Grundsätzen handeln wird, dann wird es für sie...notwendig sein, alle Stimmen und Ansichten zu hören. Aber das ist nur möglich, wenn sie Pressefreiheit gewährt." Ab 1688 war das Parlament oberste Kontrollinstanz für die Presse, die Parteien versuchten, Berichterstattung über Parlamentsdebatten zu verhindern. 1695: der Printing Act wurde nicht verlängert: Pressefreiheit, doch der Staat greift zu wirtschaftlichen Mitteln: Stamp Act, 1712. Ab 1771 war die Parlamentsberichterstattung frei. Im 18. Jh. griff diese Entwicklung auf die britischen Kolonien in Amerika über ⇒ Pennsylvania 1790: 1st Amendment: Garantie der Pressefreiheit, 1791 in der Verfassung der Vereinigten Staaten: jegliche Gesetzgebung gegen die Pressefreiheit ist untersagt.
- Seit 18. Jh. war der Kampf um die Pressefreiheit zunächst ein Kampf um die Meinungs- und Gedankenfreiheit als Menschenrecht. Zwei Argumentationen für das Recht auf Pressefreiheit: 1. Individuell-anthropologisch ⇒ das Recht des Einzelnen, seine Meinung auszusprechen und zu verbreiten, setzte sich vor allem in Frankreich durch;2. Kollektiv-soziologisch: (England) Presse wird verstanden als der Ausdruck der Stimme des Volkes, deröffentlichen Meinung.
- In Deutschland Pressefreiheit im 18. Jh. zunächst allenfalls als fürstlicher Gnadenerweis oder aus Zweckmäßigkeitsgründen. Ab den 70ern auch Forderung nach Pressefreiheit als Menschenrecht. Freiheitskriege 1813/1815 ⇒ Gefühl allgemeiner Übereinstimmung, auch zwischen Volk und Obrigkeit ⇒ Kollektivargumentation setzt sich durch ⇒ Joseph Görres im Rheinischen Merkur (1814-16): Pressefreiheit im Namen des Volkes,öffentliche Meinung in Zeitungen.
- Organ-Theorie: die Presse bringt dieöffentliche Meinung hervor; Spiegel-Theorie: die Presse spiegelt dieöffentliche Meinung.
- Das Wartburg-Fest mit Freiheitlicher Hochstimmung, die Ermordung des konservativen Publizisten A. von Kotzebue im Namen der Freiheit (1819) Anlaß und Vorwand den in der Wiener Bundesakte von 1815 angekündigten Erlaß einheitlicher Gesetze nicht umzusetzen
- Politischer Mord ⇒ Karlsbader Beschlüsse zur Bekämpfung "revolutionärer Umtriebe" von 1819: die Vorzensur wird wieder eingeführt und erst angesichts der Revolution von 1848 abgeschafft, außerdem Möglichkeit eines 5-jährigen Berufsverbot . Journalisten müssen von Staat zu Staat wechseln und ein ausgeklügeltes Spitzelsystem zur Überwachung von Journalisten und Verlegern. Jahre des Vormärz von der Unterdrückung der Presse und dem unablässigen Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit (Lyrik, Flugblätter,öffentliche Demonstrationen u. Emigrantenpresse). Zeit vor 1848 geprägt durch Folgen der napoleonischen Kriege (Auflösung des alten Reiches 1806, Gründung des Deutschen Bundes (1815-66; 34 Fürstentümer, 4 freie Städte), Einführung von Verfassungen in versch. Einzelstaaten.
Entstehung der modernen Presse
- 1780 Gründung der Neuen Zürcher Zeitung, 1788 die der Times in London: die lange getrennten Funktionen der Nachrichtenübermittlung (Information), der Meinungsäußerung (Kommentierung), der Unterhaltung und der Anzeigenwerbung vereint: Alle Standpunkte wurden dargelegt bei gleichzeitiger Distanz zu allen Interessengruppen und Parteien, hohes Niveau, eigenes Korrespondentennetz. Dies wurde 1797 in Dtld. von Cotta (auch: "Die Horen", "Europäische Annalen") mit der Allgemeinen Zeitung ebenso angestrebt (eine der bedeutensten deutschen Zeitungen; der Erscheinungsort wurde aus Zensurgründen mehrmals verlegt). Erstes erscheinen von Pressekonzentration. Ende 18. Jh ca. 300 politische Zeitungen (Aufl. 600 (Mehrzahl) bis 30.000 (Hamb. unp. Corr.). Bedeutende Meinungsblätter später: Leopold Sonnemanns "Frankfurter Zeitung" (1856/1866 bis 1943); 1861 "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" - ab 1919 DAZ-"Deutsche Allgemeine Zeitung"; 1871 - Rudolf Mosse: "Berliner Tageblatt" (bis 1939).
- Ebenfalls auf Meinungsbildung zielend, aber nicht unabhängig: "Parteizeitungen"(Mitte 19. Jh.), Anfangs: "Comité-Zeitungen" (Bsp.: H v. Kleists "Berliner Abendblätter"; konservativ; "Preußische Korrespondent", 1813, .liberal; "Rheinische Zeitung", Karl Marx, 1842). Eigentliche Ära der Parteizeitungen (Gesinnungspresse): nach 1848 (Parlamentarismus, Bildung von Parteien) ⇒ führende konservative Tageszeitung: "Neue Preußische (Kreuz-) Zeitung" u.a. von Bismarck gegründet; führende liberale Tageszeitung: die ebenfalls in Berlin gegründete "National Zeitung" (ab 1910 "Acht-Uhr-Abendblatt"); Katholiken (Zentrum): "Germania" (1871 - 1938); Volkszeitung (demokratissch); Parteizeitung der Arbeiter (erst 1864): der "Sozialdemokrat" - Organ des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins (Mitarbeit v.K. Marx u. W. Liebknecht), Zusammenfassung mehrerer kleiner Parteiorgane ⇒ ab 1876 "Vorwärts", ab 1891 Zentralorgan der SPD
- Erstes Drittel des 19. Jh.: Neue Typen von Zeitschriften, Neuerungen in Druck- und Bildreproduktion (z.B. Holzstich) nach Englischem Muster ab 1833 das "Pfennig- Magazin" (aufl. 60.000 ⇒ Massenpresse) der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, 1843 - 1943 "Leipziger Illustrirte Zeitung" (erste moderne Illustrierte - in Frankreich: "L‘Illustration), am berühmtesten: 1891 (ab 1894 bei Ullstein) - 1945: "Berliner Illustrierte Zeitung". Daneben: Familienzeitschriften: "Gartenlaube" (1853, Auflage 1874 400.000), ab 1864 "Daheim". Erfolgreich auch das Witzblatt "Kladderadatsch".
- 1848: mittelbare Nutznießerin der Februarrevolution in Paris: die deutsche Presse:Pressefreiheit in mehreren Staaten (auch Preußen), nach heftigen Aufstand im März: Presseexplosion in Berlin nach Pariser Muster - bis Ende 49 2000 Flugschriften und 155 periodische Presseorgane; nur drei Tageszeitungen überleben die Revolution ("neue Preußische Zeitung", "National Zeitung", "Volkszeitung"). Ein Kind der Revolution: die liberalen "Münchner Neuesten Nachrichten" (bis 1945, Nachfolger: Süddeutsche Zeitung). Unverwirklicht die Paulskirchen-Verfassung, die nach der französischen Menschenrechtserklärung (1789) jedem Deutschen das Recht zuerkannte, "durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern"; die Pressefreiheit darf in keinster Weise des freien Verkehrs beschränkt, suspendiert oder aufgehoben werden.
- Nach 1848 Rückfall in vormärzliche Methoden (Stempelsteuer, Kautionszwang,Behinderung, Gefängnisstrafen; Rahmengesetzgebung des Deutschen Bunds bis 66), die alte Pressekontrolle konnte aber nicht wiederhergestellt werden; allein im Jahr 1864 in Berlin 175 Prozesse gegen die Presse, nachdem Bismarcks Plan, in Anlehnug an die französische Gesetzgebung unliebsame Zeitungen nach zweimaliger Verwarnung zu verbieten, am Widerstand des Parlaments gescheitert war.
- 1874 (drei Jahre nach Gründung des Deutschen Reiches): Das Reichspressegesetz löst 27 Landespressegesetze ab ⇒ erstmals einheitliche, gesetzliche Gewährleistung der Pressefreiheit in Dtld; politische Beschlagnahmungen erheblich erschwert; Verfolgung bei Bismarck- und Majestätsbeleidigung. Dies Zwang Otto von Bismarck, durch Gerichtsverfahren gegen die Presse vorzugehen und ihre Beeinflussung durch Geldzuwendungen (Reptilienfonds) und einen amtlichen Presseapparat in Gang zu setzen. Auf §30 (Notstandsbestimmungen) stützte der Reichskanzler sein Vorgehen gegen die sozialdemokratische Presse nach Erlaß der Sozialistengesetze 1878 (-90)⇒42 sozialistische Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 150.000 St. wurden verboten.
- Pressefreiheit + wirtschaftlicher Aufschwung ⇒ Expansion der Presse im Deutschen Reich, auch die teilweise verfolgte katholische u. sozialistische Presse. Lokale Dispersion u. politische Differenzierung nahmen zu ⇒ Entwicklung wird erst nach dem Ersten Weltkrieg gestoppt (Pressefreiheit wurde aufgehoben und durch eine strenge Militärzensur ersetzt)⇒ Zahl der Zeitungen ging zurück.
- Ende des 19. Jh.: Bildung der Generalanzeiger-Presse: politisch farblos(oft konservativ), sorgfältige Pflege des Lokalteils (möglichst großer Abonnentenkreis und dadurch Inserenten - Kleinanzeigen, Geschäftsanzeigen (Über-/regional)
- Massenpresse: Idee - Zeitung als wirtschaftliches Kuppelprodukt (redaktioneller Teil:Leser, Inserenten zahlen dafür, ihre Anzeigen neben den red. teil zu stellen Leserkreis=Käuferkreis) ⇒ radikale Senkung des Kaufpreises ⇒ England/USA: Penny Press (The Sun 1833 (B. H. Day), New York Herald 1835 (J. G. Bennet); Dtld.: Vorläufer in Frankfurt u. Köln; dann 1883 "Berliner Lokal-Anzeiger" (August Scherl), zunächst wöchentliches Erscheinen für 10 Pf. Zustellgeld im Monat für Abonnenten (die Nationalzeitung kostete 6,75 Mark) ⇒ Kostendeckung durch Inserate; Zeitung kommt in weite Bevölkerungskreise, Zeitungen wirtschaftlich stark gute Redaktionen und Korrespondentennetze
- Mit der Massenpresse: die großen Pressekonzerne werden errichtet: R. Mosse, L. Ullstein, A. Scherl. Mosse schafft 1872 die große liberale Tageszeitung "Berliner Tageblatt", weitere Zeitungen kamen durch Ankauf dazu. 1898 gründete Leopold Ullstein (Verlag mit Druckerei) als Gegengewicht zum Kaiser- und regierungsfreundlichen "Berliner Lokalanzeiger" (Scherl) die linksgerichtete "Berliner Morgenpost" (1927: Aufl. 700 000; bis 1945, neu ab 53) und 1904 die erste große Straßenverkaufszeitung (Boulevardzeitung) "BZ am Mittag". Der später von den fünf Söhnen weitergeführte Verlag war 1930 das größte deutsche Presseunternehmen (18 Periodika, Aufl. fast 6 Mio.). Bei Ullstein und Scherl wurde die Kostenkonstruktion genutzt: ertragreiche Massenblätter u. Unterhaltungszeitschriften stützen unrentable, aber publizistisch angesehene Tageszeitung ("Vossische Zeitung" - Ullstein, "Berliner Tageblatt" - Mosse); Millionenauflagen wie in Frankreich (Le Petit Journal, Le Petit Parisien) gab es bis 1945 nicht.
- Technischer Fortschritt: Satz- und Drucktechnik (Schnellpresse 1811, Prinzip der Stereotypie 1829, Rotationsdruck 1860 - ab 1872 in Gebrauch, Zweifarbdruck - USA 1863, Vierfarbdruck 1896, Setzmaschine 1869, Linotypie 1884, Monotypie 1897, Papiermaschine 1816, Holzschliff 1844, Eisenbahn 1835, Telegrafie); außerdem: Aufhebung des Postzwangs nach Reichsgründung. Der in Paris längst verbreitete Kiosk: In Berlin erst 1886.
Berlin als Zeitungshauptstadt
- Schon nach Auflösung des Deutschen Bundes und Entstehung des Norddeutschen Bundes (1867) wird Berlin zur Pressestadt Nr. 1: a) Berlin war Sitz des 1849 von B. Wolff gegründeten Telegraphen-Büros (WTB), ab 1865 durch Beteiligung der preuß. Regierung offiziös; b) hier befanden sich dem preußischen Innen- bzw. Außenministerium angegliederten Pressebüros, die das Bismarcksche System der abgestuften Einflußnahme auf dieöffentliche Meinung (offiziell, offiziös, halboffiziös) erst ermöglichten; c) hier erschienen 1871 16 und 1889 bereits 58 Tagesblätter mit einer Gesamtauflage von ca. 800.000 Exemplaren d) Berlin wurde nach Reichsgründung die Stadt der großen Medienkonzerne (Mosse (1843 - 1920), Ullstein (1825 - 1899) u. Scherl (1848 - 1929)). Nach Beendigung der Inflation (1923) wurde die 4,3 Mio.-Stadt mit 147? Tageszeitungen (114 politische/70 Stadtbezirkszeitungen) u. 2.633 Presseprodukten (z.B. "Weltbühne" (ab 1905) v. Siegfied Jacobsohn; überparteilich, pazifistisch; nach Exil erschien sie in der DDR aufs Neue) vorübergehend zur größten Zeitungsmacht der Welt (26% der dt. Presseproduktion). Keine Zeitung erreicht jedoch die renommierte Stellung der Times oder der "Le Temps"; meist wegen alteingesessenen, renommierten Provinzzeitungen (z.B. Frankfurter Zeitung, seit 1856).
Journalistischer Beruf
- Beruf nur schwer abzugrenzen, aber vier Phasen (Baumert):
- präjournalistische Periode; bis zum Ausgang des Mittelalters; Sendboten, Spielleute, die in Wirtshäusern und Jahrmärkten ihre Neuigkeiten vortrugen
- Periode des korrespondierenden Journalismus; seit der frühen Neuzeit; Nachrichten wurden von meist nebenberuflichen (sonst: "Zeitungsschreiber") Korrespondenten (Diplomaten, Stadtschreiber, Sekretäre, Handelsleute) an die Postmeister oder Drucker geliefert
- Periode des schriftstellerischen Journalismus; 18. Jh.; "Journalist": eher kritisch räsonierende Abhandlungen über literarische, pädagogische oder politische Themen als aktuelle Berichterstattung; will zuröffentlichen Meinungsbildung beitragen; vor allem bei Zeitschriften ⇒ viele freie Schriftsteller, die diese Zeitschriften führten (später: Verleger)
- Periode des redaktionellen Journalismus; ab dem 19. Jh., festes Gehalt u.Dienstvertrag, Hauptberuf; Auswahl und Bearbeitung von Nachrichten schon im 18. Jh. von eigenem Personal erledigt; die meinungsbildende Funktion machte festangestellten Redakteure unentbehrlich; Bedarf an Journalisten war anfangs noch begrenzt; der Bildungsstand der Redakteure war im 19. Jh. noch bemerkenswert hoch; in der 2. Hälfte des 19. Jh. gab es mit dem Schub im Pressewesen einen größeren Bedarf an Journalisten ⇒ nicht genug Akademiker ⇒ auch viele Studenten sind Journalisten ⇒ sozialer Abstieg. Auch im 19. Jh.. Bestrebungen zu einem eigenen Berufsverband ⇒ 1864 der erste Deutsche Journalistentag mit berufs-, sozial- und pressepolitischen Forderungen; 1895 Gründung des Verband deutscher Journalistenvereine ⇒ 1910 wird dieser zum Reichsverband der deutschen Presse
Presse in der Weimarer Republik
- Weimarer Reichsverfassung von 1919: Art. 18 gewährleistet Meinungsfreiheit (als Individualrecht); kein besonderer Schutz der Pressefreiheit; der Reichspräsident konnte gemäß Art. 48 die Grundrechte bei erheblicher Störung oder Gefährdung deröffentlichen Sicherheit außer Kraft setzen; außerdem: Republikschutzgesetze von 1922 und 1930 geben den Behörden das Recht zu Zeitungsverboten (bei Aufforderung zu Gewalttätigkeiten oder Beschimpfung von Staatsform, Staatsfarbe oder Regierungsmitgliedern), später Notverordnungen des Reichspräsidenten von 1931 und 1932 (Antworten auf die zunehmende Radikalisierung in Zeitungen und Zeitschriften): In Preußen wurden von April 1931 bis Juni 1932 284 Zeitungen verboten (Dauer zwischen wenigen Tagen und acht Wochen). Nationalsozialistische, nationale und kommunistische Organe führten mit Lügen und harten Worten einen erbitterten Kampf gegen die Republik, ihre Einrichtungen und führende Persönlichkeiten. Wegen parteipolitischer, ideologischer oder wirtschaftlicher Bindungen informierten Zeitungen nur sehr einseitig oder unzulänglich. Die politisch führenden Zeitungen -Vossische Zeitung, Berliner Tageblatt, Frankfurter Zeitung - hatten eine viel zu geringe Auflage, um die Breite zu erreichen, außerdem waren sie zum Teil von anderen Verlagsobjekten abhängig. Eine Presserechtsreform und das Vorhaben eines Journalistengesetzes änderten an der parteipolitischen Zuspitzung nichts.
- Die Zahl der Zeitungen stieg wieder an: 1932 wurden 4703 Tages- und Wochenzeitungen (Gesamtaufl. 25 Mio.) einschließlich Nebenausgaben gezählt; die Hälfte war grundrichtungsbestimmt, viele mußten wirtschaftlich subventioniert werden politische Abhängigkeit.
- Alfred Hugenberg (1865 - 1952) übte schon während des ersten Weltkrieges als Direktor der Krupp AG im Interesse der Industrie und dt.-nationaler Kreise mit einem weitgespannten Netz nach Außen nicht sichtbare Einflußnahme auf das Pressewesen aus: z. T. eigene Gründungen, z. T. Übernahme von Unternehmen. Zur Vergabe von Inserentenaufträgen wurde 1914 die Auslands-Anzeigen-GmbH (ALA) geschaffen. 1916 Übernahme des Scherl-Verlages u. Beteiligung an der Telegraphen-Union, 1917 kam die Vera-Verlagsgesellschaft hinzu ⇒ erster Multimedien-Konzern. 1922 folgten die Wirtschaftsstelle der Provinzpresse zur Lieferung fertiger Artikel, sowie zwei Kreditgesellschaften zur Tarnung von Fremdbeteiligungen am Zeitungswesen; 1927 Erwerb der Universum Film AG (UFA), Eigentümer von 14 Provinzzeitungen, einer Anzeigenagentur, einer Nachrichtenagentur und eine Zeitungsbank in den 20ern die "größte deutsche Medienfabrik"; er trug wesentlich zum Erfolg der Nationalsozialisten bei.
- Auf kommunistischer Seite stand Hugenberg der kleinere Münzenberg-Verlag (1889 -1940) gegenüber; auch für bürgerliche Leser: "Die Welt am Abend" (1926-33) und "Berlin am Morgen" (1931-33); hier erschien auch die von Heinrich Mann als eine "der besten aktuellen Bildzeitungen" bezeichnete "Arbeiter-Illustriert-Zeitung" (Aufl. ca. 500.000; Autoren Mann, Tucholsky, B. Brecht).
- Die meisten Zeitungen waren dem Nationalsozialismus gegenüber zurückhaltend,kritisch oder feindlich eingestellt, die NS-Presse wuchs parallel zum Aufstieg der NSDAP - zwischen 1925 - 1933 336 NS-Zeitschriften, ein Drittel davon ging wieder ein. Seit 1930 immer mehr Tageszeitungen. Wichtig: der Völkische Beobachter (seit 1887 (Münchner Beobachter) ab 1920 im Besitz der NSDAP), der Illustrierte Beobachter (1926) und der Angriff (1927); sehr antisemitisch: Der Stürmer
Presse im Dritten Reich
- Weitreichende Umgestaltung des Pressewesens: Presse als Mittel zur Staatsführung und zur Verwirklichung politischer Ziele im Inneren nach außen. Sie ist keine selbständige politische Kraft, sondern Instrument der Propaganda, der Beeinflussung und Erziehung des Volkes im Sinne des Nationalsozialismus und zur publizistischen Vorbereitung außenpolitscher Erfolge.
- Gleichschaltung der Journalisten und Verlage.
- Adolf Hitler und Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, sahen aber in der Presse nicht das wichtigste Instrument zur Beeinflussung deröffentlichkeit ⇒ eher Großkundgebungen und Rundfunk und Film
- Drei Ebenen der Presselenkung:
- rechtlich-institutionell
-ökonomisch
- inhaltlich
- zunächst: Notverordnungen nach der Machtergreifung (30.1.33) und dem Reichstagsbrand am 27.2.33: "Die Verordnung zum Schutze des Deutschen Volkes" vom 4.3.33: Beschlagnahme und Verbot von Druckschriften; Einzelheiten legte ein neuer Katalog mit Verbotsgründen fest, neu z.B.: Aufruf zum Streik u. erweiterte Verbotsdauer (bis 6 Monate). Vorher schon Notverordnungen des Reichspräsidenten (31,32), Verbote von Zeitungen (auch z.B. der Völkische Beobachter) Am 28.2.33 wurde das Grundrecht der Pressefreiheit außer Kraft gesetzt ("zur Abwehr
kommunistischer und staatsgefährdender Gewaltakte"). 24.3.33: Ermächtigungsgesetz. Ein "Gesetz über die Einbeziehung kommunistischen Vermögens" vom 26.5.33 erlaubte die Enteignung kommunistischer Verlage. Am 14.7.33 Erweiterung auf die sozialdemokratische Presse ("Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens"), das so beschlagnahmte Vermögen wurde in der Regel nationalsozialistischen Verlagen übereignet, die dadurch häufig erst in Besitz ausreichender technischer Anlagen kamen und wurden so konkurrenzfähig und finanziell stark.
- 4.10.1933 (1.1.1934 in Kraft): das Schriftleitergesetz: die Presse wurde in den Dienst des nationalsozialistischen Staates gezwungen. Den Beruf des Schriftleiters konnte nur ausüben, wer in eine Berufsliste eingetragen war (Kontrolle des Berufszugangs einjährige Berufsausbildung, "politische Zuverlässigkeit", arische Abstammung und Eigenschaften, die die "Aufgabe der geistigen Einwirkung auf dieöffentlichkeit erfordert"; beamtenähnlicher Beruf). Über die Eintragung entschied der Leiter des jeweiligen Landesverbandes der Presse, ab 1938 der Gauleiter, bei einer Verweigerung konnte man Beschwerde beim "Reichsverband der deutschen Presse" einlegen.
- Aufgaben von Schriftleiter und Verleger wurden scharf getrennt. Verleger: kaufmännischer und technischer Teil; Schriftleiter: Textteil. Der Verleger durfte den Hauptschriftleiter benennen und zur Innehaltung bestimmter Richtlinien verpflichten, Träger der "öffentlichen Aufgabe" (gesetzlich fixiert, im staatsbezogenen Sinne) und verantwortlich für den gesamten Inhalt waren jedoch die Redakteure, diese innere Pressefreiheit wurde jedoch an den Staat verloren.
- Evangelische und katholische Kirchenblätter waren zunächst vom Schrifleitergesetz ausgenommen (aber nur bis 1936) , ebenso jüdische Periodika. Konfessionelle Zeitungen gab es ab 1935 nicht mehr, jüdische Zeitungen durften nur noch an Juden ausgeliefert werden. Kunstschriftleiter unterlagen einer zusätzlichen Genehmigungspflicht. Kunstkritik war verboten ⇒ "Kunstbetrachtung" war dann weniger wertend und mußte mit vollem Verfassernamen abgedruckt werden.
- Auch die Ausübung des journalistischen Berufes unterlag einer ständigen Kontrolle: Bei Berufsvergehen konnte ein Schriftleiter vom Berufsgericht getadelt oder ein Berufsverbot erhalten massiver Druck. Die Berufsgerichte (höchste Instanz: Pressegerichtshof in Berlin) konnten verwarnen oder eine Löschung aus der Berufsliste vornehmen. Goebbels ernannte alle Mitglieder der Berufsgerichte (Vorsitzende: Volljuristen, Beisitzer: Verleger oder Journalisten). Berufsvergehen: Verstöße gegen Pflichten aus dem Schriftleitergesetz: "politische Zuverlässigkeit" (z.B. Verstoß gegen Anordnungen des Propagandaministeriums oder Beschimpfung der NSDAP) und "sittengerechtes Verhalten"(z.B. Schulden machen, Trunkenheit, Umgang mit Juden, Plagiat).
- Einrichtungen zur Presselenkung: 13.3.33: Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP), Leiter: Joseph Goebbles, zuständig für "alle aufgaben der geistigen Einwirkung auf die Nation, der Werbung für den Staat, Kultur und Wirtschaft, der Unterrichtung der in- und ausländischenöffentlichkeit über sie". Juli 33: In jedem Gau gibt es Landesstellen des Ministeriums, ab 37 zu Reichsbehörden erhoben: Reichspropagandaämter; ihre 45 Leiter: "Landeskulturverwalter". Goebbels als Präsidenten unterstand auch die Reichskulturkammer (gegründet: 22.9.33): umfaßte 7 Einzelkammern für Presse, Rundfunk, Film, Theater, Musik, bildende Kunst und Schrifttum. Der Pressekammer unterstanden alle Presseverbände und -organisationen, also alle mit einem Presseberuf. Präsident der Reichspressekammer: Max Amann, er entschied allein u. ohne Nachprüfung, wer Mitglied in der Kammer sein durfte. Ein eigener Propagandaapparat wurde 1938 im Auswärtigen Amt unter J.v. Ribbentrop aufgebaut.
- Wirtschaftlich wurde die Presse durch Inbesitznahme der Verlage in den Griff bekommen (geplant und durchgeführt von Amann und Max Winkler). Unauffällige, getarnte Zeitungsaufkäufe und - übernahmen. Zuerst stützte man sich auf die oben erwähnten Gesetze, später, als die NS-Führung entschied, von einer Übernahme der gesamten nicht-nationalsozialistischen Presse Abstand zu nehmen, folgte 1935 die zweite Übernahmewelle: Drei Anordnungen Amanns (er war zugleich Generaldirektor des Zentralverlags der NSDAP): "Anordnung über Schließung von Zeitungsverlagen zwecks Beseitigung ungesunder Wettbewerbsverhältnisse"; "Anordnung zur Beseitigung der Skandalpresse"; "Anordnung zur Wahrung der Unabhängigkeit des Zeitungsverlagswesens" (alle vom 24.4.35). Verlage konnten geschlossen werden, wenn an einem Ort mehrere Zeitungen erschienen, die man nicht für lebensfähig hielt. Die "Skandalpresse"-Anordnung ermöglichte den Ankauf der Generalanzeigerpresse: Verlage wurden aus dem "Reichsverband der Deutschen Zeitungsverleger" (und damit der Reichspressekammer) ausgeschlossen, wenn sie in ihren Texten lügen, Anstoß erregen oder der Würde der Presse schaden. Ein Verleger durfte nicht mehrere Zeitungen herausgeben. Verlage mußten Personalgesellschaften sein (d.h. keine Aktiengesellschaften), Zeitungen durften nicht subventioniert werdend. Zeitungen durften nicht auf einen bestimmbaren Personenkreis zielen⇒ 400 Zeitungen verschwanden, bei den meisten noch bestehenden großen und publizistisch wichtigen Zeitungen wurde der Zentralverlag der NSDAP Miteigentümer, indem er mind. 51% der Verlagsanteile erwarb (Androhung der Schließung ⇒ Zwang der Anteilsabgabe). Nationalsozialistisch gesinnte Verleger der Provinzpresse versuchten sich häufig mit Abwerbungs- und Annoncenkampagnen gegen bürgerliche Konkurrenzblätter durchzusetzen.
- Die nächste Enteignungswelle erfaßte im Krieg die kleinen und mittleren Verlage. Im Mai 1941 wurden von der Reichspressekammer 550 Zeitungen stillgelegt (wegen "Kriegserfordernissen").
- Nach der Kapitulation in Stalingrad wurden bis Ende 1943 weitere 950 Zeitungen eingestellt und deren Bezieher der Parteipresse zugewiesen
- Die letzte Stillegungswelle erfolgte nach Stauffenbergs Attentatsversuch ab dem Spätsommer 1944 ⇒ Ende 1944 noch 625 Zeitungen (Aufl. 4.4 Mio/17,5%/Durchschnitt 6500). 352 Tageszeitungen mit einer Auflage von 21 Millionen waren in der Hand der NSDAP (Durchschnitt 65000)
- Mehrere Vorkehrungen und Maßnahmen dienten ebenfalls zur inhaltlichen Presselenkung: 1.1.34 Die einzigen Nachrichtenagenturen "Wolffsches Telegraphenbüro" u, "Telegraphen Union" wurden zum "Deutschen Nachrichtenbüro" fusioniert und verstaatlicht. Goebbels formulierte gelegentlich selbst Nachrichten, die dann zu Auflagenmeldungen (gezwungene Meldungen) gemacht wurden. Verschiedene Geheimhaltestufen für die Verbreitung von Nachrichtenmeldungen des DNB: Der grüne Dienst enthielt die allgemein zur Verbreitung bestimmten Meldungen, der blaue Dienst nicht unmittelbar zur Veröffentlichung bestimmte Informationen und Argumentationsanweisungen (f. Kommentare/Glossen), der gelbe Dienst Propagandakampagnen und Themen wie Antisemitismus, DNB rot für wenige Hauptschriftleiter detaillierte Informationen, DNB-weiß für Minister, Reichs- und Gauleiter und wenige Journalisten streng geheime Nachrichten. Rundrufe der Reichsregierung übermittelte das DNB als eilige Sonderanweisungen.
- Inhaltliche Presseanweisungen: v.a. auf den Berliner Pressekonferenzen im RMVP,nur eigens zugelassene Journalisten: Informationen und Anweisungen aus den einzelnen Abteilungen der Reichskanzlei. Zeitungen, die den Anweisungen nicht entsprachen wurden gerügt und kritisiert. Anzahl der Anweisungen zw. 33 u. 45: 80000 bis 100.000. Anfangs eher differenzierte Anleitungen (zunächst war keine inhaltliche Uniformität bei Zeitungen gewünscht), später die wörtlich fixierte "Tagesparole" (1940). Provinzzeitungen (ohne eigenen Berliner Korrespondenten) erhielten Anweisungen über die Landesstellen des Propagandaministeriums: drei Arten: 1. für die Veröffentlichung zu verwerten, 2. vertraulich, aber Weitergabe, 3. streng vertraulich (f. Mitglieder der Pressekonferenz). Eigene Pressekonferenzen für die ausländische Presse u. auch für Zeitschriften (Kulturpressekonferenz, zudem die "amtliche Zeitschriften-Information, ab 38 der Zeitschriften-Dienst).
- Goebbels war gleichzeitig Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda,Reichspropagandaleiter der NSDAP u. Präsident der Reichskulturkammer. Otto Dietrich war Reichspressechef (unmittelbarer Kontakt zu Hitler, war aber auch Goebbels unterstellt; koordinierte Arbeit der Parteipresse, war als Reichsleiter auf Parteiebene gleichrangig mit G.; ideologische Ausrichtung u. Überwachung aller Schriftleiter) der Regierung und der Partei u. war bis Ende 33 Präsident des Reichsverband der deutschen Presse. Max Amann war Reichsleiter für die Presse der NSDAP und Präsident der Reichspressekammer (erhebliche Weisungsrechte Struktur u. Organisation der Tagespresse; alle Entscheidungen im wirtschaftlichen und technischen Bereich der parteiamtlichen und parteieigenen Presse; zahlte wie Goebbels die Honorare der Journalisten, bestimmte die Auflage, Bezugs- und Anzeigenpreise; befand über Gründung und Erscheinen; erließ allgemeine Anordnungen für das gesamte Presseverlagswesen) ⇒ Übertragung der NS-Ziele auf den Staat.
- Dies führte aber zu Kompetenzstreitigkeiten (Rivalität, "Leistungswirrwarr")⇒ manche Presselenkungsmaßnahmen wurden verhindert oder aufgeschoben. Goebbels setzte sich bei Streitigkeiten mit Dietrich zumeist durch, wenn der Fall vor Hitler gebracht wurde, konnte aber dessen Einfluß nicht ausschalten. An der von Goebbels geleiteten Ministerkonferenz im RMVP nahm Dietrich als einziger Staatssekretär nicht teil. Er machte seinen Einfluß auf der nach einer halben Stunde folgenden Tagesparolenkonferenz geltend. Auch zwischen Gauleiter und Gaupresseämtern und zwischen Amann und seinem Stabsleiter Rolf Rienhardt gab es Rivalität.
- Es kam also nicht zu einer totalen Gleichschaltung der Presse (Rivalität,Kompliziertheit des Apparats), außerdem wurden, um international eine gewisse Glaubwürdigkeit zu behalten, einige nichtkonforme Zeitung eine Zeitlang toleriert (z.B. Frankfurter Zeitung, Verbot 31.8.43). Das 1940 gegründete Wochenblatt "das Reich", für das Goebbels selbst die Leitartikel schrieb, wurde eine größere Freizügigkeit zugestanden höheres Niveau, für Gebildete im In- und Ausland. 1944 erschienen nur noch 997 Zeitungen und 458 Zeitschriften, die letzte Berliner Zeitung war "Der Panzerbär".
- Umstritten ist, inwieweit der Fortbestand der Zeitungen eine gewisse Anpassung voraussetzte, ob das Weitermachen dem System nicht sogar nützte und wie weit Widerstand gehen konnte. Es gab jedenfalls manche Spielräume und Nischen, in denen publizistische Opposition möglich war und betrieben wurde (Aber: große existenzielle Bedrohung der Journalisten): FZ, das Berliner Tageblatt (bis 1939), das katholische "Hochland" oder die "Deutsche Rundschau". Mittel des Widerstandes: Aufgreifen von Themen, noch bevor Anweisungen ausgegeben wurden, Tarnung durch das historische Beispiel, literarische Einkleidung (z.B. Fabel), Indirektheit, Ironie, Camouflage, Konjunktiv. In der FZ: der unpolitische Teil war geprägt von Gedichten gegen die NS-Propaganda.
- Die Erfolge der Presselenkung wurden jedoch durch den "Sicherheitsdienst" (SD) überprüft
- Wichtigster Faktoren für die Wirksamkeit der Propaganda: Ausschaltung von Gegenargumenten, die Blockierung des normalen Selektierverhaltens; und 1. "Sleeper Effect": der Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Argumente verblaßt nach einiger Zeit, 2. Die Massenhaftigkeit erhöht die Chance, Gegner zu überzeugen, 3. Immunisierung gegen Gegenargumente, durch das Erwähnen, das es wertlose Gegenargumente gibt, 4. einseitig-einheitliche Argumentation der Massenmedien macht den Anschein von Übereinstimmung der Majorität, 5. Gruppenbindungen immunisieren gegen Gegenargumente. Gegnergruppen wurden systematisch aufgelöst und neue wurden geschaffen (z.B. Hitler-Jugend, SA), 6. Gruppen üben "Anschließungsdruck" aus nicht-Konformität wird durch soziale Sanktionen bestraft,7. Neu geschaffene Überzeugungen wurden befestigt, indem man Menschen dazu brachte, sich vor anderen darauf festzulegen (Parteiabzeichen, Reden), 8, viele Personen, die überzeugt werden sollten, wurden zu aktiver Teilnahme gebracht, 9. wenn Personen genötigt werden, gegen ihre Überzeugung zu argumentieren, übernehmen sie automatisch einen Teil davon in ihre Überzeugung, 10. wenn jemand gegen seine Überzeugung handelt, versucht er, seine Einstellung nachträglich mit seinem Handeln in Übereinstimmung zu bringen ( ⇒ kognitive Dissonanz), 11, Atmosphäre von Furcht und Bedrohung ⇒ kritische Unterscheidungsvermögen sinkt
- Man muß die Wirkung der Propaganda im Ganzen sehen (Massenveranstaltungen, persönliche Kommunikation, Massenmedien, Vereine, die oben genannten psychologischen Reaktionsweisen)
- Nachwirkungen: keine Presse- und Rundfunkinhalte, die dem Staat Einflußmöglichkeiten sichern
- Außerdem entstand seit 33 eine heterogene Exilpublizistik (ca. 430 Organe, 2000 Autoren z.B. die "Mann"s; Bsp: das "Pariser Tageblatt)
Presse nach dem zweiten Weltkrieg
- Nach der Kapitulation dreimonatiger Pressestop, auch Opern, Kino, Jahmärkte, etc. waren untersagt; die drei Konferenzen der "Anti-Hitler-Koalition" sahen Demokratisierung, Denazifizierung und Demilitarisierung vor: Verbot der NSDAP, die Gesetze des Nazi-Regimes wurden außer Kraft gesetzt. Alle Mitwirkenden der Nazi-Presse wurden von der zukünftigen Presse ausgeschlossen. Neuaufbau der Presse war Teil des alliierten Programms zur politischen Umerziehung, "neuer Typ" der Presse mit inhaltlichen Prinzipien: strenge Trennung von Nachricht und Meinung.
- Vier geplante Etappen: 1. totales Erscheinungsverbot, Schließung aller Druckereien u.Verlagshäusern, Auflösung aller Redaktionen; 2. Militärzeitungen werden durch die Besatzungsmächte herausgegeben; 3. Vergabe von Lizenzen an nicht vorbelastete Verleger und Journalisten; Vorzensur und Nachzensur ⇒ militärische Kontrolle; 4. alliierte Kontrolle aller technischen du personellen Fragen um ein Wiederaufleben des Nazi-gedankenguts zu verhindern; dann Übergabe der Presse in deutsche Hände
- Die Alliierten gründeten eigene Nachrichtenagenturen: Amis - "Deutsche Allgemeine Nachrichtenagentur" (DANA), Briten - "Deutscher Pressedienst" (dpd), Franzosen: "Rheinische Nachrichtenagentur" (RHEINA später SÜDENA), Sowjets: "Sowjetische Nachrichten-Büro" (SNB) später abgelöst von "Allgemeine Deutsche Nachrichtenagentur" (ADN)
- 1945-49: Etappe der Lizensierung von neuen Zeitungen durch die Alliierten
- Amerikaner: Bayern, Hessen, nord-Baden-Württemberg, Bremen; wollen den Prinzipien ihres eigenen politischen System treu bleiben; überparteiliche Blätter, für jede lizensierte Zeitung Lizenzen an mehrere Personen unterschiedlicher politischer Herkunft oder Nähe ("Gruppenzeitung"); exakt festgelegtes Verbreitungsgebiet,zunächst ohne Wettbewerber ⇒Lokalmonopole; Ende 45 knapp 50 solcher Zeitungen; erst Mitte 46 ließen sie in Großstädten Zweitzeitungen zu der erste publizistische Wettbewerb; die erste lizensierte Zeitung: "Frankfurter Rundschau"; Kritik von deutscher Seite, weil es der deutschen Mentalität entsprach.
- Britische Zone (Niedersachsen, Nordrhein-Westphalen, Hamburg, SchleswigHolstein): die Ära der Militärzeitung hält noch bis 1946 an; "Parteirichtungszeitungen", sollen jeweils den Standpunkt einer Partei vertreten, ohne von ihr abhängig zu sein; Lizenzen nicht an die Parteien, sondern an einzelne Sympathisanten oder Mitglieder; Die Briten lassen gleich Konkurrenz aufkommen, Mitte 46 schon drei bis fünf Zeitungen in den Großstädten; Papierzuteilung proportional zu den Wahlergebnissen ⇒ keine freie Konkurrenz; Bsp.: "Westfälische Rundschau" (Dortmund).
- Französische Besatzungszone: (süd-Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz): keine einheitliche Entwicklung: zunächst Lizenzen für unabhängige Lokalzeitungen, ab 47 auch für parteipolitische Zeitungen (aber: echte Parteizeitungen). Bsp.:"Badener Tageblatt"
- Sowjetzone: Nur Parteizeitungen werden zugelassen, bevorzugt KPD (später SED), Benachteiligung der Sozialdemokraten und der bürgerlichen Zeitungen (sehr knappe Papierzuteilungen); die 1. zugelassene Zeitung: "Deutsche Volkszeitung" (KP) (zusammen mit "Das Volk" (SPD) 1946 ⇒ "Neues Deutschland")
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Pressegeschichte und was sind die vier Merkmale einer Zeitung?
Die Presse ist das älteste publizistische Massenmedium und ihre Geschichte bildet einen wesentlichen Teil der Mediengeschichte. Eine Zeitung wird durch Publizität, Aktualität, Universalität und Periodizität charakterisiert.
Was waren die Vorläufer der Zeitung?
Zu den Vorläufern der Zeitung gehören gesprochene oder gesungene Kommunikation, öffentliche Aussagen, "acta urbis" in Rom, Privatbriefe, "zidunge", Kaufmannsbriefe und geschriebene Zeitungen.
Wer erfand die Druckerpresse und welche Auswirkungen hatte das?
Johann Gutenberg erfand die Druckerpresse um 1440 in Mainz. Diese Erfindung führte zu einer Zunahme von Einblattdrucken, Neuen Zeitungen und Flugblättern, was die Publizität steigerte und eine Trennung von Nachricht und Meinung ermöglichte.
Wann erschienen die ersten Zeitungen und welche Merkmale hatten sie?
Die ersten Zeitungen erschienen 1609 in Wolfenbüttel (Aviso) und Straßburg (Relation). Sie waren periodische Wochenzeitungen. Deutschland gilt als Ursprungsland der Zeitung. Frühe Zeitungen hatten eine territoriale Zersplitterung, Kommunikationskontrolle und Medienkomplementarität. Zunächst hatten sie hauptsächlich politisch-militärische Berichterstattung, eine Diversifizierung erfolgte erst im 19. Jahrhundert.
Welche Rolle spielten Zensur und Privilegien in der Entwicklung der Presse?
Bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Entwicklung der Presse durch staatliche und kirchliche Eingriffe bestimmt und wesentlich begrenzt. Es gab Vor- und Nachzensur, Impressumpflicht, Zulassungsbestimmungen, Entzug von Zeitungen, Konzessionsentzug, Themenuntersagung, Importverbote, Verkaufsverbote, Berufsverbote und finanzielle Belastungen. Es gab aber auch positive Maßnahmen durch Erteilung von Konzessionen und Privilegien.
Was sind Intelligenzblätter und Anzeigenwesen?
Intelligenzblätter wurden mit staatlichen Anzeigenmonopolen gegründet, um das heimische Wirtschaftsleben anzukurbeln und als Einnahmequelle zu dienen. Sie enthielten amtliche Bekanntmachungen und bezahlte Anzeigen. Anzeigen für Bücher und Medikamente erschienen ab 1665 in deutschen Zeitungen.
Was sind Zeitschriften und wie entwickelten sie sich?
Zeitschriften entstanden seit dem 17. Jahrhundert und besaßen die Merkmale Publizität und Periodizität. Zuerst bildeten sich Gelehrtenzeitschriften, später folgten populärwissenschaftliche Zeitschriften, Individualzeitschriften, kritische Zeitschriften und literarische Zeitschriften. Es entstanden auch Familien-, Frauen- und Gesellschaftszeitschriften.
Wie entwickelte sich der Meinungsjournalismus und der Kampf um die Pressefreiheit?
Aufklärung, Französische Revolution, die Kämpfe gegen Napoleon und das Erstarken demokratischer und nationaler Ideale führten zu politischer Publizistik mit breitem Publikum. Der Kampf um die Pressefreiheit begann in England im 17. Jahrhundert und breitete sich im 18. Jahrhundert aus. Zwei Argumentationen für das Recht auf Pressefreiheit waren: individuell-anthropologisch und kollektiv-soziologisch.
Wie entstand die moderne Presse?
Die moderne Presse entstand durch die Vereinigung von Nachrichtenübermittlung, Meinungsäußerung, Unterhaltung und Anzeigenwerbung. Es entstanden Parteizeitungen, die Meinungsbildung zum Ziel hatten. Technische Neuerungen wie Holzstiche, neue Drucktechniken und die Eisenbahn trugen zur Entwicklung bei.
Welche Rolle spielte Berlin als Zeitungshauptstadt?
Nach Auflösung des Deutschen Bundes wurde Berlin zur Pressestadt Nr. 1. Hier befanden sich Telegraphen-Büros, Pressebüros, zahlreiche Tagesblätter und die Sitze der großen Medienkonzerne.
Wie entwickelte sich der journalistische Beruf?
Der journalistische Beruf entwickelte sich in vier Phasen: präjournalistische Periode, Periode des korrespondierenden Journalismus, Periode des schriftstellerischen Journalismus und Periode des redaktionellen Journalismus. Im 19. Jahrhundert entstanden Berufsverbände und es gab Bestrebungen zur Professionalisierung.
Wie war die Presse in der Weimarer Republik?
Die Weimarer Reichsverfassung garantierte Meinungsfreiheit, aber es gab Einschränkungen durch Republikschutzgesetze und Notverordnungen. Es gab eine Zuspitzung der parteipolitischen Auseinandersetzungen in den Medien. Alfred Hugenberg und der Münzenberg-Verlag spielten eine wichtige Rolle. Die NS-Presse wuchs parallel zum Aufstieg der NSDAP.
Wie war die Presse im Dritten Reich?
Die Presse wurde im Dritten Reich gleichgeschaltet und als Mittel zur Staatsführung und Propaganda eingesetzt. Es gab rechtlich-institutionelle, ökonomische und inhaltliche Presselenkung. Das Schriftleitergesetz verpflichtete die Presse auf die nationalsozialistischen Ziele. Es wurden Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und Reichskulturkammer geschaffen. Viele Verlage wurden enteignet oder zur Anteilsabgabe gezwungen. Durch das DNB wurde die Nachrichtenübermittlung zentralisiert und gelenkt.
Wie war die Presse nach dem Zweiten Weltkrieg?
Nach der Kapitulation gab es einen Pressestopp und die Alliierten planten einen Neuaufbau der Presse mit Demokratisierung, Denazifizierung und Demilitarisierung. Es wurden Lizenzen an nicht vorbelastete Verleger und Journalisten vergeben. Jede Besatzungszone hatte ein eigenes Lizenzsystem und neue Nachrichtenagenturen wurden gegründet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 1998, Die Pressegeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94920