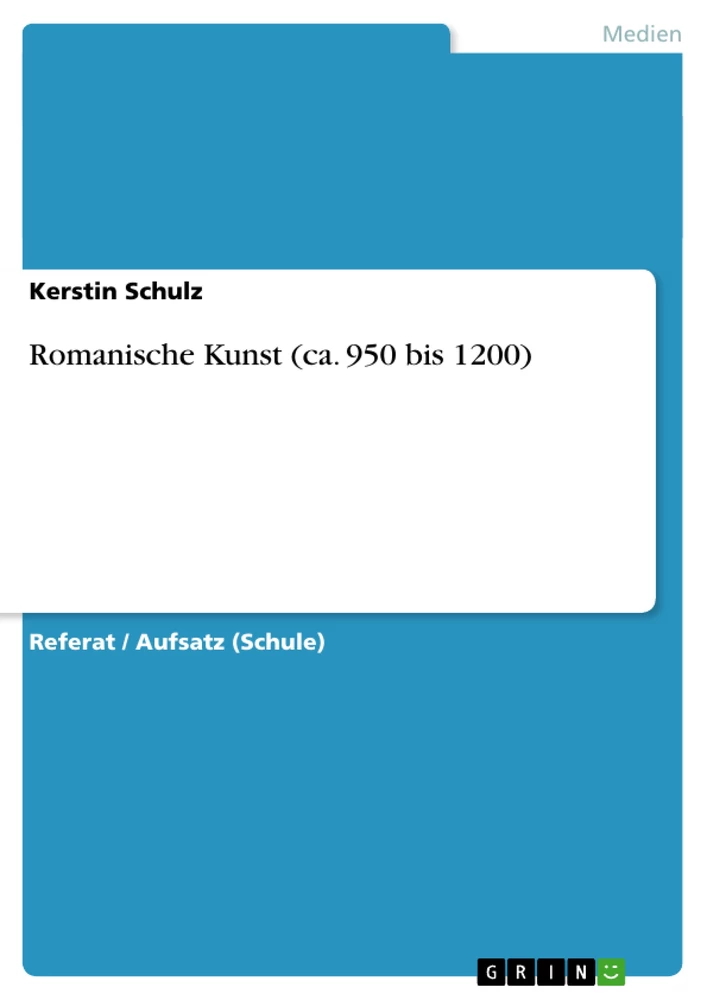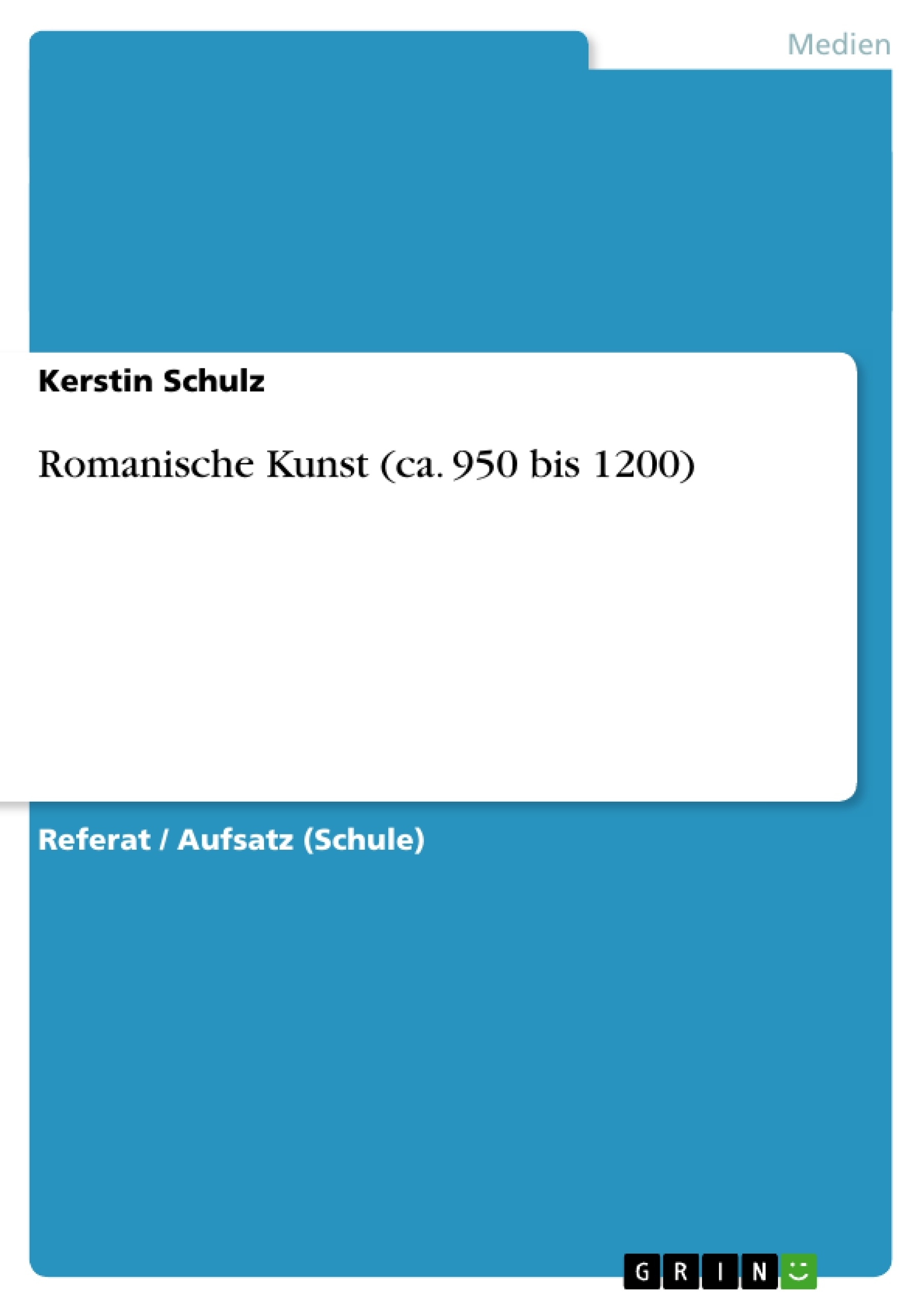Entdecken Sie die faszinierende Welt der Romanik, einer Epoche, die zwischen ca. 950 und 1200 das Abendland prägte und in der sich ein kraftvoller, neuer Kunststil entfaltete. Dieser umfassende Überblick beleuchtet die historischen Wurzeln und die Entwicklung dieser bedeutenden Periode der europäischen Kunstgeschichte, von den Wirren der Völkerwanderung bis zur Etablierung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Tauchen Sie ein in die prachtvolle Sakralarchitektur, die monumentalen Kathedralen und Klosterkirchen, welche als Ausdruck religiöser Macht und spiritueller Hingabe entstanden und mit beeindruckenden Skulpturen sowie Wandmalereien geschmückt wurden. Erfahren Sie, wie die Romanik Elemente der römischen Antike aufgriff und mit germanischen Einflüssen zu einer einzigartigen künstlerischen Synthese verschmolz. Untersuchen Sie die charakteristischen Merkmale romanischer Baukunst, wie die massiven Mauerwerke, die Rundbogenform und die Entwicklung steinerner Gewölbe, die den Übergang vom Holz- zum Steinbau markierten. Erkunden Sie die vielfältige Bildhauerei und Malerei, von den Reliefdarstellungen des Jüngsten Gerichts bis zu den ausdrucksstarken Buchmalereien in den Klöstern. Entdecken Sie die Bedeutungsperspektive und den flächigen Goldgrund, die typisch für die romanische Malerei sind, und lernen Sie, wie die Kunst als Medium zur Vermittlung kirchlicher Lehren diente. Eine Reise durch die romanischen Kunstzentren in Deutschland, Frankreich, Italien, England und Spanien enthüllt die regionalen Besonderheiten und die universale Bedeutung dieses gesamteuropäischen Kunststils. Lassen Sie sich von der Pracht und spirituellen Tiefe der Romanik verzaubern und gewinnen Sie ein tiefes Verständnis für diese einflussreiche Epoche der Kunstgeschichte, die bis heute nachwirkt und ein beeindruckendes Zeugnis des mittelalterlichen Europas darstellt. Dieses Buch bietet eine umfassende Einführung in die Welt der Romanik, ihre historischen Hintergründe, ihre charakteristischen Stilmerkmale und ihre bedeutendsten Kunstwerke. Ein Muss für alle Kunstinteressierten und Studierenden der Kunstgeschichte, die sich mit diesem wichtigen Kapitel der europäischen Kulturgeschichte auseinandersetzen möchten. Die detaillierten Beschreibungen und anschaulichen Beispiele machen die Romanik lebendig und ermöglichen einen fundierten Einblick in die künstlerischen und kulturellen Strömungen dieser Zeit. Erleben Sie die faszinierende Verbindung von Architektur, Skulptur und Malerei und entdecken Sie die spirituelle Kraft, die von den romanischen Kunstwerken ausgeht.
Kerstin Schulz
Romanische Kunst (ca. 950 bis 1200)
- ca. 950 bis 1200 - Entfaltung eines kraftvollen neuen Stils in der Architektur und bildenden Kunst
- Entstehung von Kathedralen und Klosterkirchen von gewaltigen Ausmaß, reich geschmückt mit Skulpturen und Wandmalereien
- Epochenbezeichung Romanik jedoch erst um 1820
- sakral: kirchlich
- profan: weltlich
Historischer Hintergrund
- Untergang des Imperium Romanum und damit des Fundamentes für die Kunst der Spätantike durch die Stürme der Völkerwanderung
- Anpassungsprozess der Kunst an die germanischen Siegervölker - Verlorengehen des Feingefühls für Räumlichkeit und körperliches Volumen und entscheidender Voraussetztungen für malerischer und bildnerischer Tätigkeiten in der Antike
- um 800 Staat Karl des Großen als ein im christlichen Glauben geeintes Großreich unter germanischer Führung
- Bemühung im eine imperiale Reichskunst - wieder Anknüpfung an die römische Antike, jedoch nicht Nachbildung, sondern Aufbauung in kreativer Weise karolingische Kunst
- Abendland um die Jahrtausendwende geographisch, politisch, gesellschaftlich, kulturell und religiös zersplittert, Unsicherheit
- zu Beginn 10. Jh. keine allgemeine Sicherheit durch die zentrale politische Macht mehr - Schutz der Bevölkerung bei lokalen Grundherren
- feudaler Adel drängt somit Königtum allmählich und unmerklich an den Rand politischen Geschehens
- Deutschland: 926 Krönung Otto I. zum Kaiser - Entstehung des "Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation" - als geistiges Erbe des römischen und
karolingischen Imperiums
- neue politische Stabilität, wirtschaftliche Erholung in Stadt und Land
- ottonische Kunst im Dienst der prachtvollen Ausgestaltung von Herrscherbildern
- inspirierende Wirkung der karolinischen und byzantinischen Kunst als Erbe des
Römisches Reiches und (außerdem) als kaiserliche Kunststile
- geistiges und kulturelles Leben in Klöstern
- Kirche im Mittelalter als religiöse Autorität und mit tragender Rolle in Staat und Gesellschaft
- Stärkung durch Reformbewegungen des Mönchtums, Ordensreformen
- Bischöfe und Äbte als Feudalherren und von hohem politischem Amt
- stetige Vermehrung des Kirchengutes durch Schenkungen von Herrschern und Adligen, dadurch großer kirchlicher Grundbesitz - machtvolle Stellung
- weltliche Herren zeigten Macht in Burgen und Schlössern, die Kirche durch Sakralbauten - Entstehung von Kathedralen und Klosterkirchen von gewaltigen Ausmaß, reich geschmückt mit Skulpturen und Wandmalereien - Romanik
- prachtvolle, zur Ehre Gottes errichtete Bauten und kostbare Heligenreliquien zogen in Scharen Pilger an, dadurch Spenden, teilweise Stiftungen ganzer Kloster- und Kirchenbauten oder Ausstattungsfinanzierungen; Verbindungsausbau des Verkehrsnetzes
Romanik
- Romanik als Nachfolger karolingischer Kunst in drei Phasen: Früh-, Hoch- und Spätromanik
- Frühromanik:
- Beschreibung aller künstlerischen Neuschöpfungen seit Ende des 10. Jh. im außerdeutschen Abendland
- Verbreitung in Westeuropa entlang der Handels- und Pilgerstraßen
- Romanik vorallem als ein universaler Stil für das in den Diensten der Kirche stehende Kunstschaffen
- Romanische Kunst: Neuerungen seit dem 12. Jh.,
Aufblühen der Städte (nicht nur sakrale Malerei und Architektur)
- Hochromanik: Blütezeit des Rittertum - Bedeutung des Profanbau durch mächtige Burgen
- romanisch - da Inspirierung von Vorbildern der römischen Antike, jedoch mit zusätzlichen Anteilen aus germanischer, sogar arabischer Tradition - "neue Einheit"
- Zentren romanischer Kunst:
- in Deutschland: am Rhein und im Gebiet des alten Herzogtums Sachsen
- in Frankreich: Normandie, Burgund, die Auvergne, Aqitanien und das Languedoc
- in Italien: die Lombardei, die Toskana und Apulien
- in England normannische Romanik (da 1066 Eroberung durch die Normannen)
- in Spanien südfranzösische Romanik (da Teilnahme zahlreicher franz. Ritter an Kriegen gegen die Mauren) Romanische Baukunst
- (dementsprechend) im wesentlichen Sakralarchitektur
- typisch: massive Mauerwerke,Rundbogenform von Portalen, Fenstern, Arkaden und Gewölben und die Konstruktion von steinernen Gewölben
- Ersetzung des germanischen Holzbaus durch den Steinbau
- Konzentration auf die Fortentwicklung der traditionellen Basilika
- Anpassung an die Erfordernisse der liturgischen Handlung, wie den steigenden Pilgerzahlen
- Bau der Basilika:
Gliederung
- parallel zum Hauptchor erfolgende Angliederung von Nebenkapellen, die sich zum Querschiff öffneten - Erweiterung des ursprünglich rechteckigen Basilikagrundrisses zur Kreuzform
- Vierung als zentraler Schnittpunkt mit dem Längsschiff, zur präsentativen Aufstellung des Hochaltars,
- Vierungsquadrat als Maßeinheit für die Gliederung der gesamten Kirche
- Querhausarme ebenfalls aus jeweils einem solchen Quadrat
- Verlängerung des Mittelschiffes um ein weiteres Quadrat über das Querschiff hinaus - zusammen mit der Apsis Schaffung des Chor
- Mehrfache Übertragung des Vierungquadrates auf das Mittelschiff (Jocheeinteilung) - Betonung der Maßeinteilung durch Pfeiler und rundbogentragende Säulen im doppelten ("sächsischen") oder einfachen ("rheinischen") Stützenwechesl
- Seitenschiffe in halber Breite des Mittelschiffes
- Lichtquelle durch Einfügen von Rundbogenfenstern über den Seitenschiffen
- westliche Baugruppe (Westbau) als Symbol der weltlichen Macht (Platz des
Kaisers beim Gottesdienst), östliche Baugruppe (mit dem Altar) als Sinnbild der geistlichen Macht
- zunächst flache Holzdecken
- später Erhöhung des Mittelschiffes durch Konstruktion von Steingewölben:
- rundbogiges oder spitzbogiges Tonnengewölbe: Form eines Halbzylinders, "auf" das Kirchenschiff gesetzt, mit möglicher Unterteilung in Jochen durch
Gurtbögen
- Kreuzgratgewölbe: rechtwinklige Durchdringung zweier Tonnengewölbe
- Kuppel: möglich als räumliche Verbindung des Mittelschiffes mit dem Querhaus durch Öffnung von gleichartigen Säulen über dem Vierungsquadrat nach allen vier Seiten; Kuppelfolge auch möglich
- Innenwände des Mittelschiffes am Anfang der Romanik noch als plastisch ungegliederte Flächen: Verputzung und Bemalung
- Überlieferung der horizontalen Gliederung von Arkaden-, Bilder- und
Fensterzonen von der frühchristlichen Basilika
- seit Beginn 11. Jh. Auch vertikale Gliederung der Mittelschiffwand durch vorgesetzte Halbsäulen von den Pfeilen bis nach oben - optische Ausgleichung von Horizontale und Vertikale
- später weitere Ausweitung der Schmuckformen durch Verbindung reichen Zierrates an Portalen, Fenstern und Kapitellen mit der wuchtigen Masse der Gebäude
- starke Mauermassen zur Standhaltung der Schubkräfte der Steingewölbe
- massive Mauern nur durch wenig Ornametik gegliedert
- jedoch Herausbildung einzelner Gestaltungselemente: Rundbogen, Rundbogenfries, Zwerggalerie, Doppelrundbogenfenster und ein Sockel für den Gesamtbau
- Baukö01 Romanische Plastik und Malerei Bildhauerei/Plastik:
- diente dem Kirchenbau - vorwiegend sakral bestimmt
- Ausschmückung der architektonischen Schlüsselstellen wie Kapitellen, Gesimsen, Vorhallen und Bogenfeldern über den Portalen (Typanon) mit figürlichen, aber auch ornamentalen Darstellungen - Heilige, Dämonen, Fabelmotive, aber auch germanisches Band- und Flechtwerk
- reiche Reliefdarstellungen - besonders Darstellungen des Jüngsten Gerichts mit Christus als Weltenrichter im Zentrum
- keine naturgetreue Wiedergabe eines Individiums, sondern Verkörperung eines Typus oder Symbole bei figürlichen oder gegenständlichen Darstellungen
- Vollplastiken eher selten - Verwirklichung im Kruzifix,
- dabei Christus vor allem als Erlöser, siegreich über Leben und Tod, weniger
leidend und schmerzgeplagt, Dornenkrone oft durch eine weltliche Krone ersetzt
- der Architektur verwandt: Figuren in blockhafter, statischer Formgebung auf
das Wesentliche beschränkt, ohne detaillierte Darstellung einer Umgebung, gekennzeichnet lediglich durch typische Gesten oder Attribute
- neben Steinbildwerken auch Holzskulpturen, Elfenbeinreliefs für Buchdeckel und Reliquienschreine sowie Bronzeplastiken
- ebenfalls Blütezeit der Goldschmiedekunst, z.B. auch bei ziervollen Bucheinbänden
Malerei:
- Höhepunkt der Buchillustration Deutschlands in Meßbüchern und
Evanglientexten
- oft wertvolle Abschriften in Handschrift in Klöstern - dabei Schmückung vor allem der Heiligen Schrift und liturgischer Bücher mit kostbaren
Miniaturmalereien
- Nähe zur Antike, wie bei der karolingischen Malerei ging verloren
- Kennzeichen:
- Darstellungen weniger prunkhaft und representativ
- Figuren primitiver und derber, mit sparsamer, aber deutlicher Mimik und
Gestik - stark im Ausdruck
- Bedeutungsperspektive: dargestellte Größe einer Figur entspricht ihrer
Bedeutung im Gesamtbild
- fächiger Goldgrund als Hintergrund, statt angedeutete räumliche Tiefe - das
Überirdische, den Bereich des Himmlischen kennzeichnend
- deutliche, oft durch Konturen präzisierte Umrisse
- flächige Farbigkeit mit weitgehendem Verzicht auf Modellierung durch Licht und Schatten
- Frontalansicht bei Einzelfiguren
- Kleider durch wenige stilisierte Gewandfalten angedeutet
- zumeist biblische Szenen, selten weltliche Inhalte
- erhalten meist Buchmalereien
- Wände, Flachdecken und Gewölbe der romanischen Kirchen meist ebenfalls bemalt, jedoch wenig erhalten
- Farbenpracht der Wandbemalungen und Skulpturen vereint frühchristliche, karolingische, ottonische, orientalische und islamische Einflüsse
- Wandmalereien wie Mosaiken jedoch nicht nur Raumdekoration, sondern zur bildhaften Darstellung der Lehre der Kirche für die Gläubigen, die meist nicht lesen konnten
- neben der Temperamalerei vor allem auch Glasmalerei
Quellen:
- Geschichte der Kunst, Ernst Klett Verlag, 1996
- Weltgeschichte (Band 4), Bertelsmann Lexikon Verlag, 1996
- Abiturhilfen Kunstgeschichte I, Dudenverlag, 1996
- Universal Lexikon der Kunst, IP Verlagsgesellschaft, 1995
Häufig gestellte Fragen zu Kerstin Schulz: Romanische Kunst (ca. 950 bis 1200)
Was ist Romanische Kunst und wann war ihre Blütezeit?
Die Romanische Kunst war eine Epoche der europäischen Kunst, die etwa von 950 bis 1200 dauerte. Sie zeichnete sich durch einen kraftvollen neuen Stil in Architektur und bildender Kunst aus, insbesondere durch den Bau von Kathedralen und Klosterkirchen.
Wann wurde der Begriff "Romanik" geprägt?
Die Epochenbezeichnung "Romanik" wurde erst um 1820 geprägt.
Was sind die Merkmale des historischen Hintergrunds der Romanik?
Der historische Hintergrund umfasst den Untergang des Römischen Reiches, die Anpassung der Kunst an die germanischen Völker, die Entstehung des Reiches Karls des Großen und die spätere Zersplitterung des Abendlandes. Otto I. wurde 926 zum Kaiser gekrönt, was zur Entstehung des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" führte, und es gab eine neue politische Stabilität und wirtschaftliche Erholung. Die Klöster spielten eine wichtige Rolle im geistigen und kulturellen Leben.
Welche Rolle spielte die Kirche in der Romanik?
Die Kirche war eine religiöse Autorität und spielte eine tragende Rolle in Staat und Gesellschaft. Sie wurde durch Reformbewegungen des Mönchtums gestärkt und besaß großen Grundbesitz durch Schenkungen.
Wie sah die Entwicklung der Romanik aus?
Die Romanik wird in drei Phasen unterteilt: Früh-, Hoch- und Spätromanik. Die Frühromanik umfasste künstlerische Neuschöpfungen seit dem Ende des 10. Jahrhunderts, während die Hochromanik durch die Blütezeit des Rittertums und die Bedeutung des Profanbaus gekennzeichnet war.
Wo waren die Zentren romanischer Kunst?
Zentren romanischer Kunst befanden sich in Deutschland am Rhein und im Gebiet des alten Herzogtums Sachsen, in Frankreich in der Normandie, Burgund, der Auvergne, Aqitanien und dem Languedoc, in Italien in der Lombardei, der Toskana und Apulien, in England und in Spanien.
Was sind die typischen Merkmale der romanischen Baukunst?
Typisch sind massive Mauerwerke, Rundbogenformen von Portalen, Fenstern, Arkaden und Gewölben sowie die Konstruktion von steinernen Gewölben. Der Steinbau ersetzte den germanischen Holzbau, und es erfolgte eine Fortentwicklung der traditionellen Basilika.
Wie war der Aufbau einer romanischen Basilika?
Die Basilika wurde durch Nebenkapellen erweitert, wodurch eine Kreuzform entstand. Die Vierung diente als zentraler Schnittpunkt, und das Vierungsquadrat diente als Maßeinheit. Das Mittelschiff wurde verlängert, und die Maßeinteilung wurde durch Pfeiler und Säulen betont. Licht kam durch Rundbogenfenster über den Seitenschiffen herein.
Welche Gewölbearten wurden in der Romanik verwendet?
Es wurden rundbogige oder spitzbogige Tonnengewölbe, Kreuzgratgewölbe und Kuppeln verwendet.
Wie war die Innenraumgestaltung romanischer Kirchen?
Die Innenwände des Mittelschiffes waren zunächst plastisch ungegliedert, wurden verputzt und bemalt. Es gab eine horizontale Gliederung von Arkaden-, Bilder- und Fensterzonen, später auch eine vertikale Gliederung durch Halbsäulen.
Welche Merkmale hatte die romanische Plastik und Malerei?
Die Bildhauerei diente dem Kirchenbau und war vorwiegend sakral bestimmt. Es wurden architektonische Schlüsselstellen mit figürlichen und ornamentalen Darstellungen ausgeschmückt. Die Malerei zeichnete sich durch primitive Figuren, Bedeutungsperspektive, Goldgrund als Hintergrund, deutliche Umrisse und flächige Farbigkeit aus. Es wurden zumeist biblische Szenen dargestellt.
Welche Quellen werden im Text genannt?
Die genannten Quellen sind "Geschichte der Kunst" (Ernst Klett Verlag, 1996), "Weltgeschichte (Band 4)" (Bertelsmann Lexikon Verlag, 1996), "Abiturhilfen Kunstgeschichte I" (Dudenverlag, 1996), "Universal Lexikon der Kunst" (IP Verlagsgesellschaft, 1995) und "Wie erkenne ich Romanische Kunst?".
- Quote paper
- Kerstin Schulz (Author), 1996, Romanische Kunst (ca. 950 bis 1200), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94873