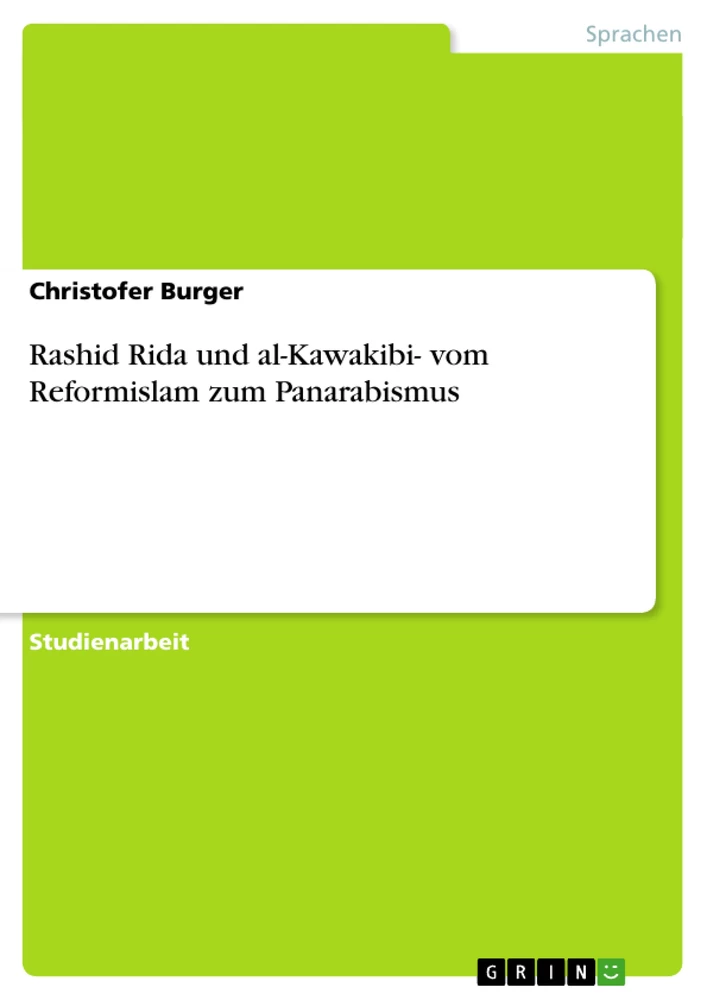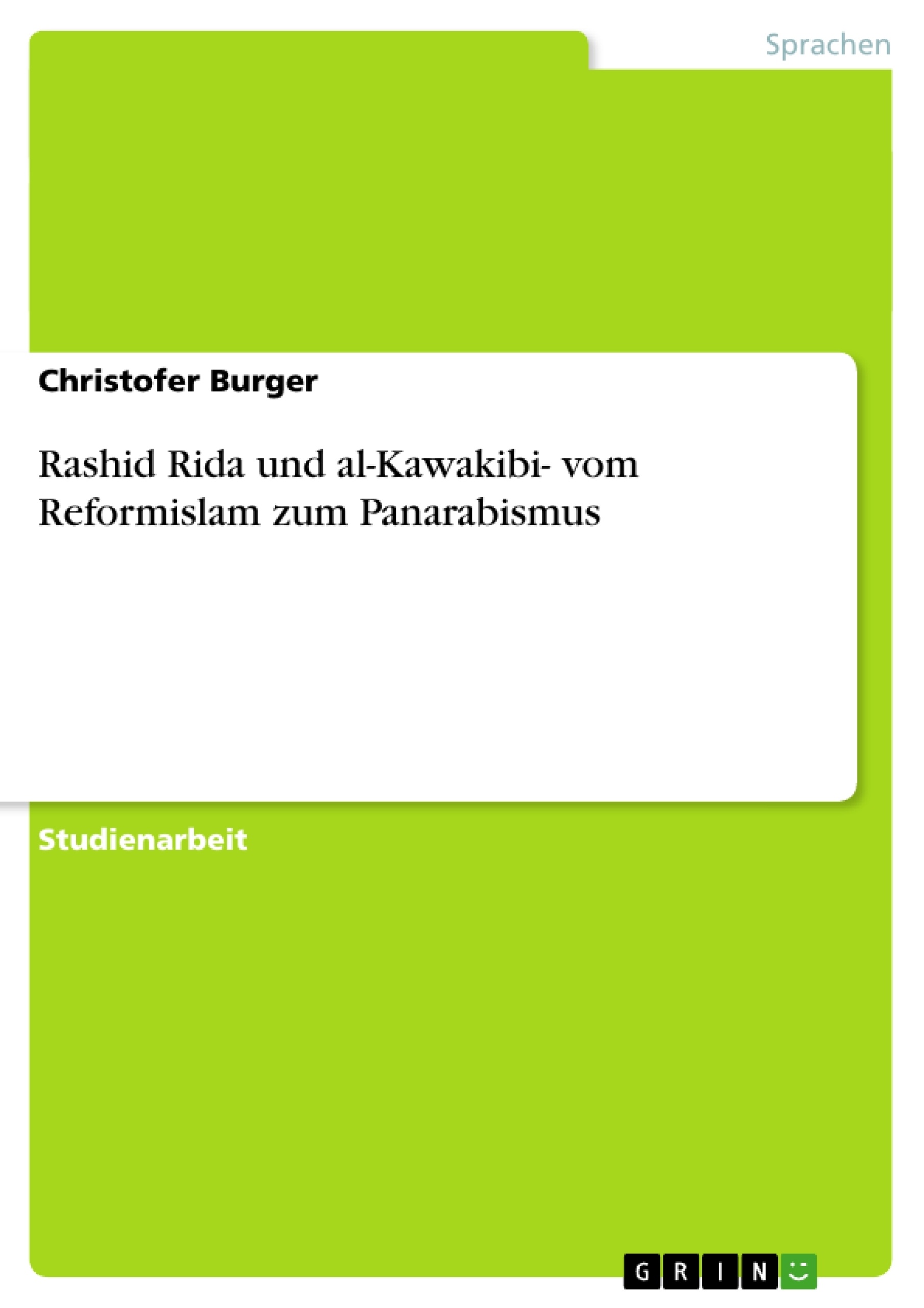In einer Epoche des Umbruchs, in der der Islam durch westliche Kolonialmächte und innere Erstarrung bedroht schien, erhoben sich zwei Denker, um die islamische Welt neu zu gestalten: Abd al-Rahman al-Kawakibi und Muæammad Rañîd Riõà. Diese fesselnde Doppelbiographie enthüllt das Leben und die Ideen zweier Schlüsselfiguren des islamischen Reformismus und Panarabismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Al-Kawakibi, ein unerschrockener Anwalt der Schwachen und Kritiker osmanischer Willkür, forderte eine Rückbesinnung auf die arabischen Wurzeln des Islam und träumte von einem Kalifat ohne politische Macht, einem Hort religiöser Reinheit. Seine Schriften, darunter die flammende Anklage gegen die Tyrannei in "Åabà'i al-istibdàd", inspirierten Generationen von arabischen Nationalisten. Rañîd Riõà, geprägt von den Lehren Muæammad Abduhs, widmete sein Leben der Verbreitung reformistischer Ideen durch seine Zeitschrift "al-Manàr". Zunächst ein Verfechter der Zusammenarbeit mit den Jungtürken, wandte er sich später dem Panarabismus zu und entwarf Pläne für einen unabhängigen arabischen Staat. Doch stets blieb er seinen religiösen Überzeugungen treu, warnte vor säkularen Bestrebungen und verteidigte die unantastbare Autorität von Koran und Sunna. Diese tiefgründige Analyse beleuchtet nicht nur die individuellen Werdegänge von al-Kawakibi und Riõà, sondern auch die ideologischen Strömungen ihrer Zeit, den Zusammenprall von Tradition und Moderne, den Kampf um Freiheit und Einheit in einer Welt des Wandels. Entdecken Sie, wie diese beiden Denker das Fundament für den modernen arabischen Nationalismus legten und bis heute die Debatten über die Zukunft des Islam prägen. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die das komplexe Zusammenspiel von Religion, Politik und Identität im Nahen Osten verstehen wollen. Tauchen Sie ein in die Welt des islamischen Modernismus, des arabischen Nationalismus und der politischen Ideologien des Nahen Ostens. Diese Biographie bietet Ihnen einen detaillierten Einblick in das Leben und Wirken von zwei Schlüsselfiguren, deren Ideen bis heute nachwirken. Erfahren Sie mehr über die Ursprünge des Panarabismus, die Kritik an der osmanischen Herrschaft und die Suche nach einem modernen, gerechten Islam. Eine spannende Reise in die Vergangenheit, die uns hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
Biographien
Abd al-Rahman al-Kawàkibi
wurde 1849 in Aleppo geboren. Er entstammte einer Familie mit einer bedeutenden Tradition in Wissenschaft und Verwaltung. Er besuchte die "al-Kawàkibîya"- Schule, die von einem seiner Vorfahren gegründet worden war. Hier und in Antioch studierte er Rechts- und Geschichtswissenschaften und moderne Naturwissenschaft.
Er arbeitete in Aleppo in der Verwaltung und später als Anwalt, schrieb für die Regierungszeitschrift " al-Furàt"und gründete zwei Zeitschriften, die allerdings bald von der Regierung geschlossen wurden. In dieser Zeit erwarb er sich einen Ruf als Anwalt der Schwachen, als Aktivist gegen Behördenwillkür und als Vertreter eines modernisierten Islam.
Nach anhaltenden Konflikten mit den osmanischen Behörden, die seine Zeitschrift schlossen und ihn der Verschwörung bezichtigten, verließ er 1898 Aleppo, bereiste einen großen Teil der islamischen Welt und ließ sich schließlich 1900 in Kairo nieder. Er hatte Kontakt zu dem Kreis um Rañîd Riõà und Muæammad Abduh. Hier veröffentlichte er seine beiden einzigen Werke, " Umm al-qurà" ("Die Mutter der Dörfer") und " Åabà'i al-istibdàd".("Die Eigenschaften der Tyrannei"), beide unter Pseudonym. "Åabà'i al-istibdàd" ist eine Anklage gegen die Tyrannei im Allgemeinen, eine Beschreibung ihrer Fehler und Folgen und ein Plädoyer für Demokratie und Freiheit. In "Umm al-qurà" wird von einem fiktiven Panislamischen Geheimkongreß in Mekka berichtet, der die Ursachen der Schwäche des Islam konstatiert und zur Lösung ein arabisches Kalifat und eine institutionelle Modernisierung fordert.
Sie wurden auch episodenweise in Rañîd Riõàs Zeitschrift "al-Manàr" abgedruckt.
In seiner Kairoer Zeit wurde er eine bekannte Figur in intellektuellen Kreisen und in den Kaffeehausdiskussionen; mit dem Khedive Abbàs II. soll er persönlich befreundet gewesen sein.
Muæammad Rañîd Riõà (1865-1935)
stammte aus einem kleinen Dorf nahe Tripolis im Libanon (damals Syrien). Er besuchte zuerst die örtliche Koranschule, dann eine staatliche Schule in Tripolis, anschließend die madrasa waåaniyya, wo er durch ihren Gründer und Direktor, Shayï Ïusayn al-Ðisr, zum ersten Mal mit modernistischen Ideen konfrontiert wurde.
Im Winter 1897/98 reiste Rañîd Riõà nach Kairo, wo er sofort Muæammad Abduh aufsuchte, um ihn für seine Idee von einer reformistischen Zeitschrift zu gewinnen. Mitte März 1898 erschien die erste Ausgabe von al-Manàr.
In den Jahren zwischen 1908 (der Wiedereinsetzung der Osmanischen Verfassung) und 1912 arbeitete Rañîd Riõà mit den Jungtürken zusammen an der Gründung einer reformistisch ausgerichteten islamischen Akademie in Istanbul. Nach Widerständen und Intrigen , und nachdem die türkische Regierung das Programm seiner Ansicht nach in eine türkische Propagandainstitution verwandeln wollte, verließ er Istanbul enttäuscht. Er gründete für sein Projekt mit der Unterstützung der ägyptischen Königsfamilie die "Ðamàat al-Dawa wa 'l-Irñàd", und 1912 wurde die Schule schließlich in Kairo eröffnet.
Von den Jungtürken enttäuscht, begann er 1911 gegen sie zu agitieren und gründete eine Geheimgesellschaft mit Pan-Arabistischem Einschlag unter dem Namen "Ðamiyyat al-Ðàmia al-Arabiyya". Sie hatte das Ziel, die Lokalherrscher der arabischen Halbinsel zu vereinigen und den Kontakt unter den arabischen Geheimgesellschaften herzustellen.
Nach den osmanischen Niederlagen im Balkankrieg traute er dem Reich nicht mehr zu, die arabischen Länder gegen den westlichen Imperialismus zu verteidigen und rief in Flugblättern die arabischen Führer zur Einheit und zur Kampfbereitschaft auf.
Im ersten Weltkrieg unterstützte Rañîd Riõà den arabischen Aufstand und wurde 1919 zum Präsidenten des "Syrischen Kongresses" gewählt; nach dem Einmarsch der französischen Mandatstruppen zog er allerdings wieder nach Ägypten.
1922 Reiste er in die Schweiz und durch Deutschland, um Gespräche mit Vertretern des Völkerbunds über den zukünftigen Status der Mandatsgebiete zu führen.
1923 veröffentlichte er "al-ïilàfa aw al-imàma al-u÷mà", in dem er ein arabisches Kalifat mit vor allem religiösen Kompetenzen forderte.
In den folgenden Jahren verschlechterte sich seine Beziehung zum hàñimitischen Königshaus, und schließlich unterstützte er 1924-26 die Machübernahme der Wahhàbiten, die er inzwischen als die Verfechter des wahren Islam ansah. In diesem Zusammenhang setzte er sich für eine Rehabilitation von Ibn Taymiyya und ähnlicher Autoren ein und kritisierte gleichzeitig trotz aller Aufrufe zur Einheit der Muslime die Ñîa und die "abergläubischen" Úýfi-Praktiken.
Ideologischer Hintergrund
Sowohl al-Kawàkibi als auch Rañîd Riõà standen in der Tradition des islamischen Reformismus /Modernismus, der von Ðamàl al-Dîn al-Aføànî und Muæammad Abduh entwickelt worden war. Auf die Konfrontation mit dem als überlegen empfundenen Westen und die Bedrohung des Islam durch die westlichen Kolonialmächte reagierte diese Schule mit der Forderung nach einem modernen, flexiblen Islam. Typische Merkmale des reformistischen Islamverständnisses sind unter anderem:
- Die Orientierung an einem idealisierten "Urislam"
- Der Vorwurf an die traditionellen Rechtsgelehrten, im Interesse von Despoten den "wahren Islam" korrumpiert zu haben.
- Die Ablehnung der normativen Bedeutung traditioneller Auslegungen und des taqlîd, das als Ursache der Erstarrung des islamischen Rechts angesehen wurde.
- Die Forderung nach Wiedereinführung des iðtihàd zur Flexibilisierung des Islam.
- Die Forderung nach Erneuerung des Kalifats und seine Ausstattung mit religiöser Legitimität.
- Übernahme westlicher Errungenschaften in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft , soweit sie mit dem Islam vereinbar sind.
Auf diese Weise sollte der wissenschaftliche Fortschritt dem moralisch überlegenen Islam wieder zu seinem angemessenen Rang verhelfen.
All diese Forderungen finden sich auch bei al-Kawàkibî und Rañîd Riõà wieder. Ihre entscheidende Innovation besteht darin, daß sie als Hauptursache der Korruption des Islam die nichtarabischen Einflüsse identifizieren, allen voran die osmanische Herrschaft.
Politische und Religiöse Vorstellungen
Beide halten die Araber für die eigentlichen Träger des Islam. Al-Kawàkibî hält die Bewohner der arabischen Halbinsel für die Hüter eines unverfälschten Islam. Ihre Isolation, relative Unabhängigkeit und natürliche Armut hätten sie vor Dekadenz und ihren Glauben vor Verfälschung bewahrt.
Daraus leitet er die Forderung nach einem arabischen Kalifat ab. Wie die traditionellen Rechtsgelehrten gesteht er das Anrecht auf die religiöse Führung der Muslime nur einem Angehörigen der Quraiñ zu. Neu ist aber seine Begründung: Er führt 21 Eigenschaften des arabischen Nationalcharakters an, die die Araber dazu prädestinieren.
Im Gegensatz zu allen traditionellen Vorstellungen wünscht sich al-Kawàkibî aber ein Kalifat ohne politische Macht, dem katholischen Papst sehr ähnlich. So soll er eine gewisse Souveränität über den Hijàz erhalten, ansonsten aber nur religiöse Kompetenzen vornehmlich repräsentativer Natur haben. Von vielen Autoren wird er daher als Begründer des säkularen arabischen Nationalismus bezeichnet. Tatsächlich ruft er auch alle Araber, Muslime und Nichtmuslime auf, sich zu einigen und ihr Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen.
Einen arabischen Nationalstaat oder Unabhängigkeit vom osmanischen Reich fordert er allerdings nicht. Er stellt sich einen dezentralisiertes osmanisches Reich vor, das alle islamischen Länder umfaßt, ihnen aber kulturell und politisch weitgehende Autonomie einräumt.
Al-Kawàkibî glaubt, parlamentarische Demokratie und Sozialismus seien schon im Koran angelegt und müßten die Grundlage eines gerechten Staates sein.
Rañîd Riõà stand zunächst Kawàkibis nationalistischen Vorstellungen ablehnend gegenüber. Sein nationaler Partikularismus stand für ihn im Gegensatz zum Islam, er sah darin einen Rückfall in die Stammesloyalität ( aÿabiyya ) der ðàhiliyya. Im Laufe seiner politischen Karriere sah er sich allerdings immer mehr von den Türken enttäuscht, und er entwickelte sich schon deutlich vor dem ersten Weltkrieg zu einem Aktivisten des Panarabismus. Auch in seiner Schrift über das Kalifat von 1923 wendet er sich noch gegen die aÿabiyya im Allgemeinen ; nur im Falle der Araber, die schon durch den Koran bevorzugt seien, stehe sie im Einklang mit dem Islam.
Nach dem Bruch mit den Jungtürken begann Rañîd Riõà 1912 , Kontakt mit arabischen Führern herzustellen, sie zur Einheit aufzurufen und Pläne für eine zukünftige politische Ordnung zu erstellen. Bei der Vorbereitung des arabischen Aufstandes von 1916 schätzte der britische Geheimdienst seine Autorität und die Rolle seiner Geheimgesellschaft als so bedeutend ein, daß er 1915 in Kairo mit ihm Gespräche über einen arabischen Staat führte. Dabei nannte Rañîd Riõà Eckpunkte einer zukünftigen Verfassung. So sollte das arabische Reich föderalistisch und demokratisch sein, mit einem Parlament, einem Präsidenten als Regierungschef und einem gewählten Kalifen als religiöses und Staatsoberhaupt.
Rezeption und Wirkung
Al-Kawàkibî wird in der arabischen Welt wesentlich positiver und aufmerksamer betrachtet, als von den westlichen Orientalisten. In der westlichen Literatur wird er nur wenig berücksichtigt, und seine Wirkung und Originalität werden oft im Sinne von Sylvia G. Haim als gering eingestuft. In Syrien hingegen wird er als Nationalschriftsteller bisweilen in einem Atemzug mit Khalil Gibran genannt, und in einer ägyptischen Umfrage wurde er zu den bedeutendsten arabischen Autoren der Neuzeit gerechnet.
Rañîd Riõà hingegen wird in jeder westlichen historischen Darstellung des arabischen Nationalismus erwähnt. Obwohl die Wirkung seiner Schriften immer im Schatten seines Lehrers Abduh gesehen wird, hatte er doch Einfluß auf spätere islamistische Bewegungen. Noch zu seinen Lebzeiten wehrte er sich erbittert gegen Versuche von Säkularisten, die"Reformation" des Islam bis zur Beliebigkeit zu treiben. Für ihn standen Koran und Sunna nie zur Disposition, und der Arabismus diente nur zur Stärkung des Islam.
Literatur
EI²-Artikel "Rashîd Riõà", "al-Kawàkibî", "Kawmiyya"
Hourani, Albert: Arabic Thought in the Liberal Age 1798 – 1939, Oxford 1970 S. 222-244, S.271-273
Kerr, Malcolm: Islamic Reform. The Political and Legal Theories ofMuæammad AbduhandRashîd Riõà, Berkeley 1966
Tapiero, Norbert: Les Idées Réformistes d'al-Kawàkibi, Paris 1956
Antonius, George: The Arab Awakening, London 1938
al-Husry, Khaldun: Three Reformers. A Study in Modern Arab Political Thought, Beirut 1966
Haim, Sylvia: Arab Nationalism. An Anthology, Berkeley 1964
ead.: Blunt andal-Kawàkibi, in: Oriente Moderno Nr. XXXV (1955), S. 132-143
ead.: Alfieri andal-Kawàkibi, in: Oriente Moderno Nr. XXXIV (1954), S. 321-334
Tauber, Eliezer: Rashîd Riõàas Pan-Arabist before World-War I, in: Muslim World Nr. 79 (1989)
Shahin, Emad Eldin: Rashîd Riõà'sPerspectives on the West as Reflected inAl-Manàr, ibid.
id.: Artikel "al-Kawàkibî", in: "The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World"
Häufig gestellte Fragen
Wer war Abd al-Rahman al-Kawàkibi?
Abd al-Rahman al-Kawàkibi wurde 1849 in Aleppo geboren. Er war ein Gelehrter, Verwaltungsbeamter, Anwalt und Aktivist. Er setzte sich für die Schwachen ein, kämpfte gegen Behördenwillkür und befürwortete einen modernisierten Islam. Er verließ Aleppo 1898 nach Konflikten mit den osmanischen Behörden und veröffentlichte später in Kairo unter Pseudonym seine Werke "Umm al-qurà" und "Åabà'i al-istibdàd".
Was sind die Hauptwerke von Abd al-Rahman al-Kawàkibi?
Seine beiden Hauptwerke sind "Umm al-qurà" ("Die Mutter der Dörfer") und "Åabà'i al-istibdàd" ("Die Eigenschaften der Tyrannei"). "Åabà'i al-istibdàd" ist eine Anklage gegen die Tyrannei, während "Umm al-qurà" einen fiktiven Panislamischen Geheimkongress in Mekka beschreibt, der die Ursachen der Schwäche des Islam analysiert und ein arabisches Kalifat sowie institutionelle Modernisierung fordert.
Wer war Muæammad Rañîd Riõà?
Muæammad Rañîd Riõà (1865-1935) stammte aus einem Dorf nahe Tripolis im Libanon. Er war ein islamischer Gelehrter und Reformer. Er gründete die Zeitschrift "al-Manàr" und arbeitete mit den Jungtürken zusammen, bevor er von ihnen enttäuscht wurde und sich dem Panarabismus zuwandte. Er unterstützte den arabischen Aufstand und forderte ein arabisches Kalifat mit religiösen Kompetenzen.
Was war die Zeitschrift "al-Manàr"?
"al-Manàr" war eine reformistische Zeitschrift, die von Rañîd Riõà gegründet wurde. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung modernistischer Ideen in der islamischen Welt.
Was war die "Ðamàat al-Dawa wa 'l-Irñàd"?
Die "Ðamàat al-Dawa wa 'l-Irñàd" war eine von Rañîd Riõà gegründete Organisation, die eine reformistisch ausgerichtete Schule in Kairo betrieb.
Was war die "Ðamiyyat al-Ðàmia al-Arabiyya"?
Die "Ðamiyyat al-Ðàmia al-Arabiyya" war eine Geheimgesellschaft mit panarabischem Einschlag, die von Rañîd Riõà gegründet wurde, um die Lokalherrscher der arabischen Halbinsel zu vereinigen und den Kontakt unter den arabischen Geheimgesellschaften herzustellen.
Was sind die zentralen Ideen des islamischen Reformismus/Modernismus?
Der islamische Reformismus/Modernismus, vertreten durch Figuren wie Ðamàl al-Dîn al-Aføànî und Muæammad Abduh, fordert einen modernen, flexiblen Islam als Reaktion auf die Konfrontation mit dem Westen und die Bedrohung durch westliche Kolonialmächte. Zu den Merkmalen gehören die Orientierung an einem idealisierten "Urislam", die Ablehnung traditioneller Auslegungen, die Forderung nach Wiedereinführung des iðtihàd, die Erneuerung des Kalifats und die Übernahme westlicher Errungenschaften, soweit sie mit dem Islam vereinbar sind.
Welche Rolle spielten die Araber in den Vorstellungen von al-Kawàkibi und Rañîd Riõà?
Beide sahen die Araber als die eigentlichen Träger des Islam. Al-Kawàkibi sah in den Bewohnern der arabischen Halbinsel die Hüter eines unverfälschten Islam und forderte ein arabisches Kalifat, jedoch ohne politische Macht. Rañîd Riõà war zunächst gegen nationalistische Vorstellungen, entwickelte sich aber später zu einem Aktivisten des Panarabismus, nachdem er von den Türken enttäuscht worden war.
Wie wurde al-Kawàkibi in der arabischen Welt und im Westen wahrgenommen?
Al-Kawàkibi wird in der arabischen Welt positiver betrachtet als von westlichen Orientalisten. Im Westen wird er wenig berücksichtigt, während er in Syrien als Nationalschriftsteller gilt. Rañîd Riõà wird in westlichen Darstellungen des arabischen Nationalismus erwähnt, seine Wirkung steht jedoch oft im Schatten seines Lehrers Abduh.
Welche Literatur wird zur weiteren Erforschung empfohlen?
Empfohlene Literatur umfasst EI²-Artikel "Rashîd Riõà", "al-Kawàkibî", "Kawmiyya", "Arabic Thought in the Liberal Age 1798 – 1939" von Albert Hourani, "Islamic Reform. The Political and Legal Theories ofMuæammad AbduhandRashîd Riõà" von Malcolm Kerr und weitere Werke.
- Quote paper
- Christofer Burger (Author), 1999, Rashid Rida und al-Kawakibi- vom Reformislam zum Panarabismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94861