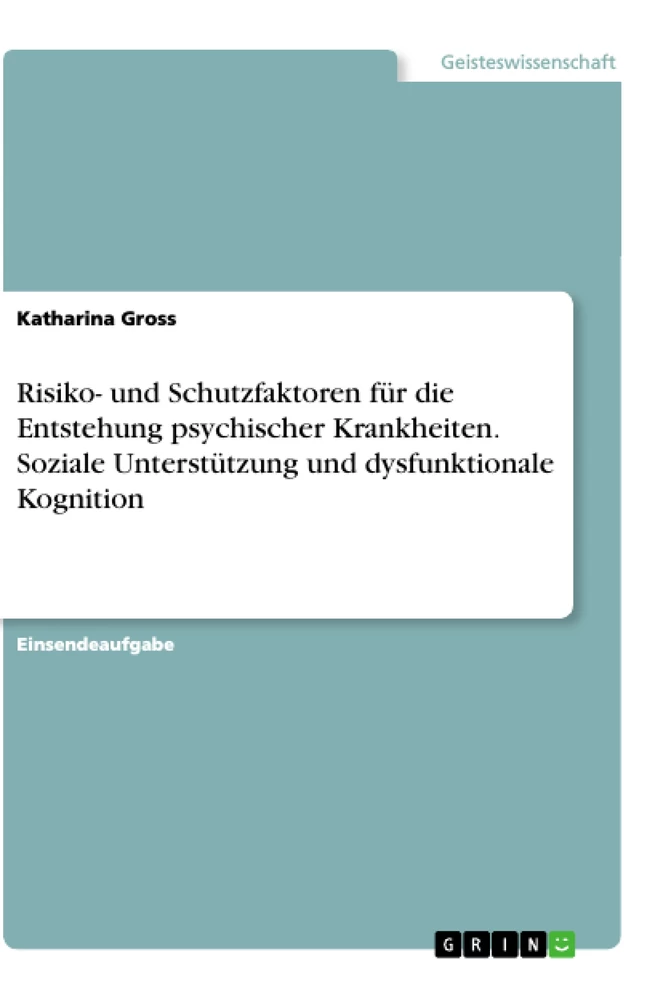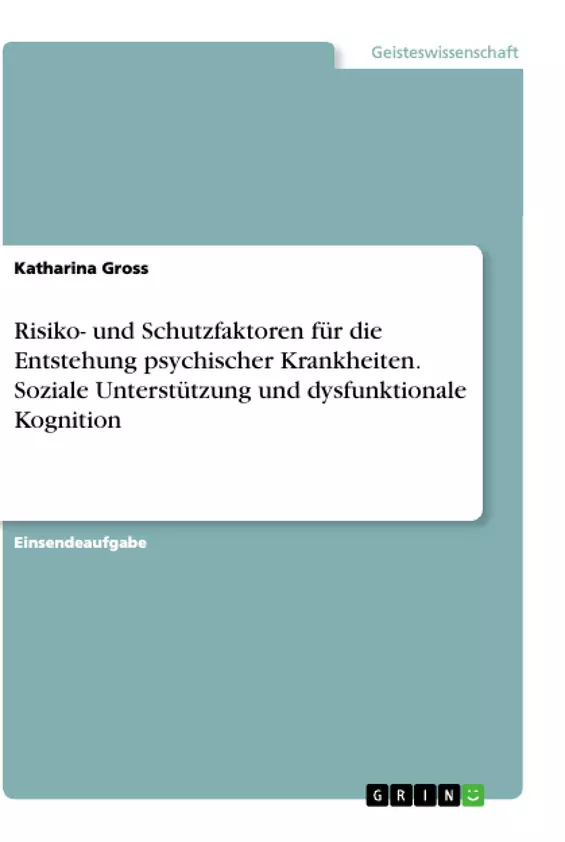In dieser Einsendeaufgabe werden Risikofaktoren diskutiert, die das Auftreten psychischer Krankheiten begünstigen, sowie Schutzfaktoren, die das Auftreten vermeiden können.
Faktoren, die das Auftreten einer psychischen Störung wahrscheinlicher machen, gibt es zahlreiche. Ebenso sind schützende Faktoren vorhanden, welche das Auftreten einer psychischen Störung unwahrscheinlicher machen. Vorweg soll bereits erwähnt werden, dass nicht jeder Mensch, der Risikofaktoren ausgesetzt ist, auch eine psychische Störung erleiden wird. Andersherum ist eine Person, die über viele Schutzfaktoren verfügt, nicht vor einer psychischen Störung gewappnet. Diese Tatsache gilt über Kulturen hinweg.
Ein wesentlicher Risikofaktor, der im Grunde nicht beeinflussbar ist, stellt die genetische Disposition dar. Deutlich wird diese Feststellung bei Studien mit eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Es ist erwiesen, dass bei eineiigen Zwillingen häufiger beide Geschwister bspw. an Schizophrenie oder einer bipolaren Störung erkranken, als dies bei zweieiigen Zwillingen der Fall ist. Nichtsdestotrotz muss eine Krankheit wegen einer solchen genetischen Disposition nicht zwingend zum Ausbruch kommen. Es gibt kein Gen, das für eine bestimmte psychische Störung codiert.
Inhaltsverzeichnis
- Risiko und Schutzfaktoren für die Entstehung psychischer Krankheiten
- Soziale Unterstützung und dysfunktionale Kognition im Kontext psychischer Störungen
- Soziale Unterstützung
- Dysfunktionale Kognition
- Der diagnostische Prozess anhand eines Beispiels
- Bericht des Patienten
- Beschreibung der Symptome und klassifikatorische Diagnose
- Therapieplan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Einsendeaufgabe befasst sich mit dem Thema der Entstehung psychischer Krankheiten und untersucht dabei die Rolle von Risikofaktoren und Schutzfaktoren sowie den Einfluss von sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognition.
- Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen
- Schutzfaktoren, die das Auftreten psychischer Störungen unwahrscheinlicher machen
- Die Bedeutung von sozialer Unterstützung im Zusammenhang mit psychischen Störungen
- Die Rolle dysfunktionaler Kognition bei der Entwicklung psychischer Störungen
- Der diagnostische Prozess und die Erstellung eines Therapieplans
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den zahlreichen Risikofaktoren und Schutzfaktoren, die die Entstehung psychischer Störungen beeinflussen können. Es wird auf genetische Dispositionen, prä- und perinatale Schädigungen sowie das Geschlecht und das Alter als potenzielle Einflussfaktoren eingegangen.
Das zweite Kapitel widmet sich der Rolle von sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognition im Kontext psychischer Störungen. Es werden die verschiedenen Formen sozialer Unterstützung und deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit beleuchtet. Des Weiteren wird die Bedeutung von dysfunktionalen Denkprozessen für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen diskutiert.
Das dritte Kapitel beschreibt den diagnostischen Prozess anhand eines konkreten Beispiels. Es wird die Anamnese des Patienten, die Beschreibung seiner Symptome und die klassifikatorische Diagnose behandelt. Zudem wird ein beispielhafter Therapieplan vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Einsendeaufgabe behandelt zentrale Themen aus der klinischen Psychologie und fokussiert auf die Entstehung und Behandlung psychischer Störungen. Wichtige Schlüsselwörter sind: Risikofaktoren, Schutzfaktoren, soziale Unterstützung, dysfunktionale Kognition, Diagnostik, Therapie, psychische Störungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Risikofaktoren für psychische Krankheiten?
Risikofaktoren sind Bedingungen wie genetische Disposition, traumatische Erlebnisse, chronischer Stress oder soziale Isolation, die die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung erhöhen.
Was versteht man unter Schutzfaktoren?
Schutzfaktoren (Resilienzfaktoren) sind Ressourcen wie soziale Unterstützung, ein stabiles Selbstwertgefühl oder gute Problemlösestrategien, die gegen psychische Störungen schützen.
Welche Rolle spielt die Genetik bei psychischen Störungen?
Es gibt eine genetische Disposition für viele Störungen (z.B. Schizophrenie), aber diese führt nicht zwangsläufig zum Ausbruch der Krankheit; Umweltfaktoren spielen eine entscheidende Rolle.
Was ist eine dysfunktionale Kognition?
Dies sind negative, verzerrte Denkmuster (z.B. Katastrophisieren), die zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Störungen wie Depressionen beitragen können.
Warum ist soziale Unterstützung so wichtig?
Ein stabiles soziales Umfeld wirkt als Puffer gegen Stress und hilft Betroffenen, Krisen besser zu bewältigen und schneller zu genesen.
- Citation du texte
- Katharina Gross (Auteur), 2020, Risiko- und Schutzfaktoren für die Entstehung psychischer Krankheiten. Soziale Unterstützung und dysfunktionale Kognition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/948311