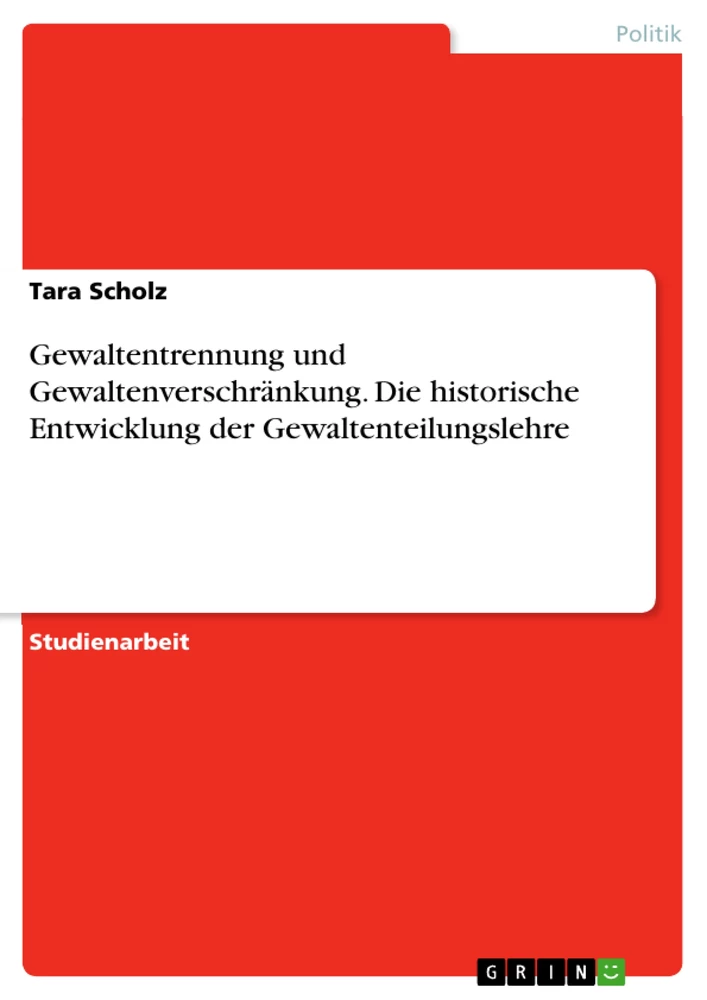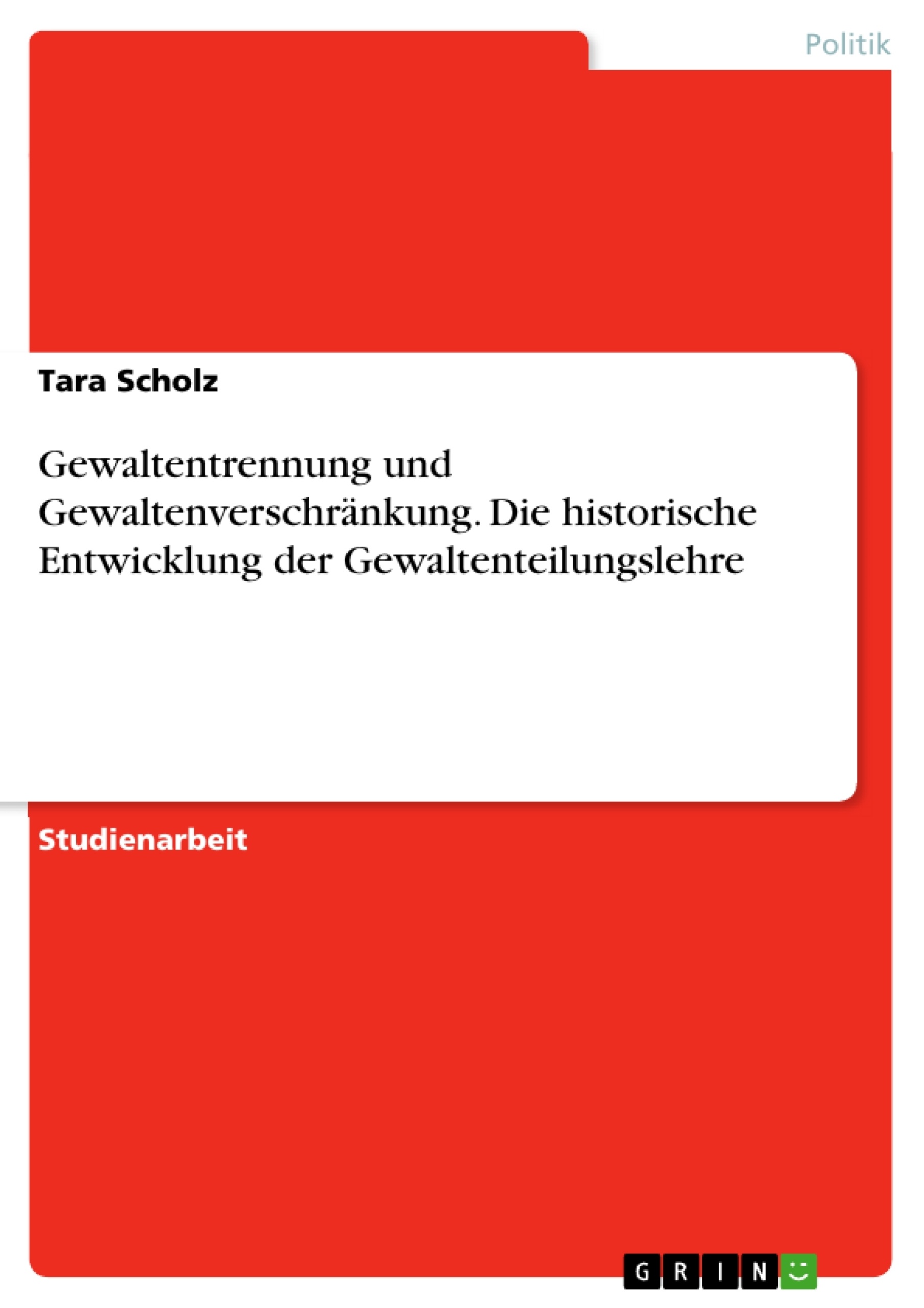In dieser Arbeit stellt sich die Frage, wie der Grundsatz der Gewaltenteilung sich von ihrer ursprünglichen Form bis zu ihrer heutigen Ausprägung überhaupt entwickelt hat und wen man mit ihr in Verbindungen bringen kann. Hat Aristoteles mit seinem Werk „Politik“ den Grundstein der Gewaltenteilungslehre gelegt? Oder muss man ein paar Jahrhunderte in die Zukunft schauen um bei John Locke und Montesquieu die eigentlichen Ursprünge zu finden? Und in welchem Zusammenhang stehen die Federalists zu dem?
Diese Fragestellungen sollen in der vorliegenden Arbeit beantwortet werden.
Der Grundsatz der Gewaltenteilung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Er wird wie folgt in der deutschen Verfassung geregelt:
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. (2) Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. (Art. 20 GG)
Die Hauptaufgabe der Lehre der Gewaltenteilung liegt darin die Macht der Staatsgewalt zu teilen und beschränken. Die einzelnen Teilgewalten die sich daraus ergeben sind die gesetzgebende Gewalt (Legislative), die vollziehende Gewalt (Exekutive) und die rechtsprechende Ge-walt (Judikative), Art. 20 II. Die drei Staatsgewalten dienen der gegenseitigen Machthemmung der Machtkontrolle und sollen sowohl für ein klares Machtgleichgewicht im Staat sorgen.
In Deutschland ist Artikel 20 des Grundgesetzes maßgeblich für die Gewaltenteilung. Die außerordentliche Relevanz kann man schon allein an Art. 79 III GG (Ewigkeitsklausel) erkennen, in dem die Unveränderbarkeit der in Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze – insbesondere der Gewaltenteilungsgrundsatz - normiert sind.
Die Lehre der Gewaltenteilung ist keine Erfindung der Moderne. Sie gilt als „[d]as große Vermächtnis der Vergangenheit“. Laut Tsatsos lassen sich ihre ersten Ansätze schon früh finden und man kann davon ausgehen, dass die Trennung der Kompetenzbereiche von Kirche und Staat einer der ältesten Ausgestaltungen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Literaturbericht
- 1.2 Methode der Arbeit
- 2. Deskription
- 2.1 Aristoteles „Politik“
- 2.2 John Lockes „Two Treatises of Government“
- 2.3 Montesquieus „De l'esprit de lois“
- 2.4 Die „Federalist Papers“ von John Jay, Alexander Hamilton, James Madison
- 3. Die Theorie der Gewaltenteilungslehre im Überblick
- 4. Analyse und Auswertung der Gewaltenteilung
- 4.1 Legislative
- 4.2 Exekutive
- 4.3 Judikative
- 4.4 Die wichtigsten Aspekte der Lehre der Gewaltenteilung
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der Gewaltenteilungslehre von ihren Anfängen bis zur heutigen Ausprägung. Sie analysiert die Beiträge bedeutender Denker und deren Einfluss auf die Gestaltung moderner politischer Systeme. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Gewaltenteilungslehre zu vermitteln und ihre Bedeutung für die Funktionsweise demokratischer Staaten aufzuzeigen.
- Entwicklung der Gewaltenteilungslehre im historischen Kontext
- Analyse der Theorien von Aristoteles, Locke und Montesquieu
- Bedeutung der „Federalist Papers“ für die Gewaltenteilung
- Vergleich der verschiedenen Modelle der Gewaltenteilung
- Relevanz der Gewaltenteilung für die Bundesrepublik Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gewaltenteilung ein und erläutert deren zentrale Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland, wie sie im Artikel 20 des Grundgesetzes verankert ist. Sie hebt die Notwendigkeit der Machtteilung und -beschränkung hervor und benennt die drei Staatsgewalten: Legislative, Exekutive und Judikative. Die Einleitung stellt die Frage nach der historischen Entwicklung der Gewaltenteilungslehre und benennt zentrale Denker, deren Arbeiten im weiteren Verlauf untersucht werden, um die Entwicklung des Prinzips von seinen Ursprüngen bis zur Gegenwart nachzuvollziehen. Die Bedeutung von Artikel 20 GG und seine Unveränderbarkeit (Ewigkeitsklausel) wird hervorgehoben. Schließlich werden die Forschungsfragen der Arbeit skizziert.
2. Deskription: Dieses Kapitel widmet sich der Beschreibung der wichtigsten Werke und Philosophen, die die Gewaltenteilungslehre geprägt haben. Es bietet eine Einführung in die zentralen Ideen und Konzepte dieser Denker, ohne deren Theorien bereits zu analysieren. Der Fokus liegt darauf, den historischen Kontext und die jeweiligen Beiträge der einzelnen Philosophen zu präsentieren, bevor im weiteren Verlauf der Arbeit eine detaillierte Analyse und ein Vergleich ihrer Konzepte vorgenommen wird.
2.1 Aristoteles „Politik“: Aristoteles' „Politik“ wird als Grundlage der Politologie präsentiert. Die Zusammenfassung beschreibt die acht Bücher des Werkes und ihre jeweiligen Schwerpunkte, von der politischen Anthropologie über die Analyse verschiedener Staatsverfassungen bis zur Frage nach der besten Staatsform. Die Bedeutung des „zoon politikon“-Konzepts für Aristoteles' Staatstheorie wird hervorgehoben. Die Kritik an Platon und die Einteilung von Staatsformen in gute und entartete werden ebenfalls erwähnt, um die Komplexität von Aristoteles' Werk aufzuzeigen und seinen Einfluss auf das politische Denken zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Gesamtstruktur und der zentralen Themen des Werkes ohne detaillierte Analyse einzelner Kapitel.
2.2 John Lockes „Two Treatises of Government“: Die Zusammenfassung beschreibt Lockes „Two Treatises of Government“ im Kontext des 17. Jahrhunderts und seiner Kritik an Sir Robert Filmer und dessen patriarchalischem Herrschaftsmodell. Der Fokus liegt auf der Darstellung des ersten Traktats, in dem Locke die Theorie des Naturrechts und des Gesellschaftsvertrags entwickelt. Die Arbeit zeigt auf, wie Locke mit seinen Argumenten die Grundlage für liberal-demokratische Staatsverständnisse gelegt hat. Die Bedeutung seiner Kritik an absolutistischen Herrschaftsansprüchen und seine Konzepte von individuellen Rechten und der Begrenzung staatlicher Macht werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Gewaltenteilung, Gewaltenverschränkung, Aristoteles, Locke, Montesquieu, Federalist Papers, Legislative, Exekutive, Judikative, Staatsgewalt, Machtteilung, demokratischer Staat, Grundgesetz, Artikel 20 GG.
Häufig gestellte Fragen zum Text über die Gewaltenteilungslehre
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit der Entwicklung und den zentralen Aspekten der Gewaltenteilungslehre. Er untersucht die historischen Wurzeln des Konzepts, analysiert die Beiträge bedeutender Denker wie Aristoteles, Locke, Montesquieu und die Federalist Papers, und beleuchtet die Bedeutung der Gewaltenteilung für die Funktionsweise demokratischer Staaten, insbesondere die Bundesrepublik Deutschland.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die historische Entwicklung der Gewaltenteilungslehre, die Analyse der Theorien von Aristoteles, Locke und Montesquieu, die Bedeutung der Federalist Papers, einen Vergleich verschiedener Modelle der Gewaltenteilung und die Relevanz der Gewaltenteilung für die Bundesrepublik Deutschland. Es werden die drei Staatsgewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) ausführlich betrachtet.
Welche Autoren und Werke werden im Text analysiert?
Der Text analysiert die Werke von Aristoteles ("Politik"), John Locke ("Two Treatises of Government"), Montesquieu ("De l'esprit de lois") und die "Federalist Papers" von Jay, Hamilton und Madison. Die Analyse konzentriert sich auf die jeweiligen Beiträge dieser Denker zur Entwicklung der Gewaltenteilungslehre.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel gegliedert: Einleitung, Deskription der wichtigsten Werke und Philosophen, Überblick über die Gewaltenteilungslehre, Analyse und Auswertung der Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Judikative), Fazit und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der zentralen Inhalte.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Gewaltenteilungslehre zu vermitteln und ihre Bedeutung für die Funktionsweise demokratischer Staaten aufzuzeigen. Er untersucht die Entwicklung des Konzepts von seinen Anfängen bis zur heutigen Ausprägung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Gewaltenteilung, Gewaltenverschränkung, Aristoteles, Locke, Montesquieu, Federalist Papers, Legislative, Exekutive, Judikative, Staatsgewalt, Machtteilung, demokratischer Staat, Grundgesetz, Artikel 20 GG.
Welche Rolle spielt Artikel 20 des Grundgesetzes?
Artikel 20 des Grundgesetzes, der die Gewaltenteilung in der Bundesrepublik Deutschland verankert, wird als zentrales Element der deutschen Staatsordnung hervorgehoben und seine Bedeutung für die Funktionsweise des demokratischen Staates erläutert.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt den Inhalt jedes Kapitels stichpunktartig. Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Forschungsfragen. Die Deskription beschreibt die relevanten Werke. Die Analyse bewertet die verschiedenen Konzepte der Gewaltenteilung. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
- Quote paper
- Tara Scholz (Author), 2019, Gewaltentrennung und Gewaltenverschränkung. Die historische Entwicklung der Gewaltenteilungslehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/948204